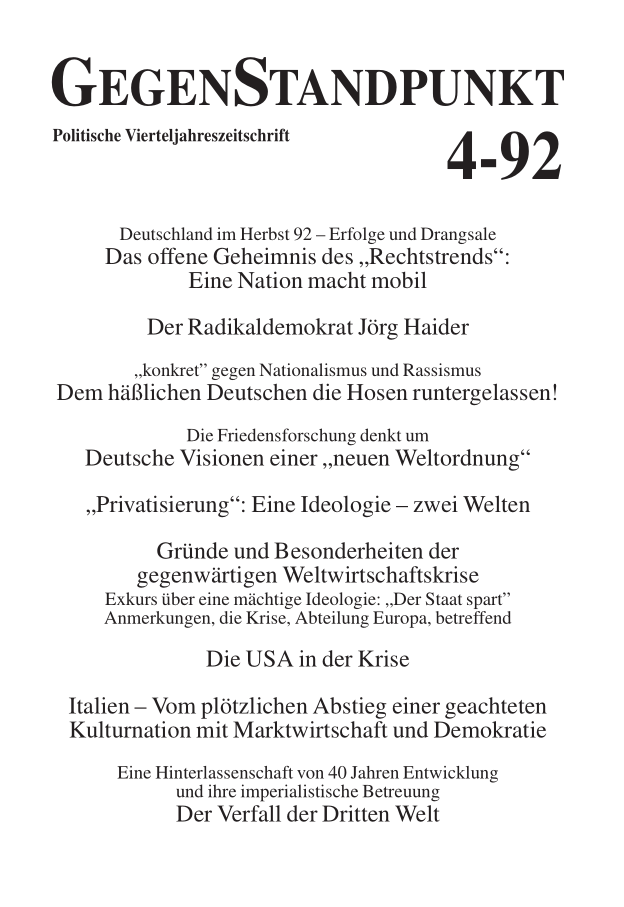Deutschland im Herbst 92 – Erfolge und Drangsale
Das offene Geheimnis des „Rechtstrends“:
Eine Nation macht mobil
Das Ausbreiten des „Ausländer- und Asylantenproblems“ gerät zu einem einzigen Plädoyer gegen das Asylrecht und für die Entfesselung guter staatlicher Gewalt im „Kampf gegen rechts“ (u.a. Kundgebung in Berlin). Deutsche Notstandspolitik: sie muss in allen Fragen bis hin zur Krisenbewältigung wieder „Herr der Lage sein“. Das führt sie u.a. vor an ihrem Problem mit der Staatskasse, indem sie es zum Problem ihrer Bürger macht und darüber die soziale in eine nationale Frage überführt, die als Antwort auf Unzufriedenheit und Rechtsradikalismus v.a. geistige Führung erfordert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- „Staatsnotstand“
- Einigkeit aller Demokraten gegen das Asylrecht
- Rechtsstaatlichkeit auf den Punkt gebracht: Entfesselung der staatlichen Gewalt
- Der „Kampf gegen rechts“: Nationaler Schulterschluß fürs Gewaltmonopol
- Die Berliner Kundgebung und das Recht der Staatsmacht auf ungestörte Imagepflege
- Zur Sache: Grund und Zweck einer betont demokratischen Notstandspolitik
- Ein „Solidarpakt“ für die Staatskasse
- Die „soziale Frage“ heute: Von Nationalisten gestellt, nationalistisch zurückgewiesen
- Die Waffe der Demokratie gegen Unzufriedenheit: „Geistige Führung“
Deutschland im Herbst 92 – Erfolge und Drangsale
Das offene Geheimnis des „Rechtstrends“: Eine Nation macht mobil
„Staatsnotstand“
Zwischen Oktober und November 92 ist in Deutschland ein Notstand ausgebrochen; der Mann, der es wissen muß, weil er die Richtlinien der nationalen Politik bestimmt, hat ihn angesagt. Angeschlossen hat sich eine kurze, heftige Debatte darüber, ob der Kanzler das Wort gebrauchen darf, wo es doch nach dem Buchstaben gewisser Gesetze ganz bestimmten, nicht eingetretenen Fällen vorbehalten ist; mit diesem Einwand hatte sich der parlamentarische Widerspruchsgeist ausgetobt. Die Sache blieb unbestritten: Deutschland ist vielleicht noch nicht im Notstand, aber die Nation hat einen. Das ist jetzt, kraft der Kompetenz des Kanzlers, Richtlinie der Politik.
Dieser Notstand – das ist seiner etwas unscharfen Definition durch die Republikführung genau zu entnehmen – besteht darin, daß erstens zuviele verelendete Ausländer und Bürgerkriegsvertriebene nach Deutschland kommen und Asyl beantragen; daß zweitens der mörderische Volkszorn der rechten Szene der Nation gegen Asylbewerber und andere Ausländer sich so gar nicht beruhigen mag und mittlerweile sogar an jüdischen Gedenkstätten vergreift; genaugenommen aber drittens darin, daß noch immer keine Grundgesetzänderung in Kraft ist, die dem gewalttätigen Haß auf hierher geflüchtete Ausländer die Grundlage entzieht, indem sie kurzen Prozeß mit Asylbewerbern und rasche Abschiebung verordnet.
Die Kombination ist das Bemerkenswerte. Es ist lächerlich anzunehmen, der deutsche Staat geriete in Not, weil etliche Tausend oder auch Hunderttausend armselige Kreaturen von auswärts auf meist abenteuerlichen Wegen ins Land kommen, einen Asylantrag einreichen, der dann unbearbeitet liegenbleibt oder abgelehnt wird, unter absichtlich schlechten Bedingungen untergebracht und unterhalb des Sozialhilfesatzes bis zur Abschiebung durchgezogen werden. Selbst wenn die Regierung nicht bloß die halbe Million noch nicht erledigte Asylbewerber im Auge hat, sondern die wachsende Not in der endlich vom Kommunismus zur Marktwirtschaft befreiten Welt in einen dauerhaft wachsenden Flüchtlingsstrom umrechnet, gegen den sie sich prinzipiell wappnen muß, so ist die Sichtweise doch reichlich absurd, die deutsche Staatsmacht wäre diesen Antragsstellern ausgeliefert – selbst Stoiber weiß, daß es umgekehrt ist. Ebenso abwegig ist die Behauptung, das Anzünden von Ausländerquartieren und der Applaus dafür brächten Deutschland in Not – aber das hat von der Regierung ja auch niemand behauptet. Nach der Richtlinie, die der Kanzler ausgegeben hat, leidet Deutschland an dem Notstand, daß seine führenden Politiker nun schon seit Jahren von der „Asylantenflut“ und der Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung reden, aber nicht entsprechend handeln, obwohl doch mittlerweile das ganze Volk gebieterisch danach verlangt und sogar schon Sympathie mit Jugendlichen entwickelt, die zum Schaden des deutschen Ansehens in der Welt auf eigene Faust Gewalt gegen Ausländer üben. Die regierenden Politiker entwerfen das Bild selbstverschuldeter staatlicher Ohnmacht gegenüber Asylbewerbern, auf deren Überwindung das Volk ein Recht hat und – bisweilen allzu nachdrücklich – pocht; und sie behaupten, daß die deutsche Demokratie sich gefährdet, wenn sie – weiterhin – zu lasch ist, den rechtsradikalen Schlägern zuvorzukommen.
Über die „Sache“ – die Zahl der hereinkommenden Flüchtlinge, seien es Elends-, Bürgerkriegs- oder im engsten Sinn politische Flüchtlinge, die es in der Kommunismus-freien Welt von heute definitionsgemäß eigentlich ohnehin nicht mehr gibt – geht diese Lagebestimmung ersichtlich hinaus. Über diese Leutchen wird zwar beschlossen; nämlich daß sie weg gehören: Wer noch nicht da ist, soll zu Hause zugrunde gehen; den „Altfällen“ soll es problemlos an den Kragen gehen. Sie haben aber das besondere Pech, daß die deutsche Staatsmacht durch sie nichts geringeres erlitten haben will als einen Notstand ihrer Handlungsfähigkeit und ein Zerwürfnis mit ihrem Volk, weil sie ihm Machtentfaltung schuldig bleibt. Vom Standpunkt der Bonner Regierung sind erstens die Flüchtlinge ein Problem, und zweitens ist das Problem Anlaß für eine Machtfrage: Die höchsten Machtorgane fragen sich, ob sie noch Herr der Lage sind.
Ein bemerkenswerter Übergang.
Einigkeit aller Demokraten gegen das Asylrecht
Die Regierung will der „Flüchtlingsflut“ unbedingt grundsätzlich, über das Grundgesetz beikommen, das in Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 ein Asylrecht kodifiziert. Es geht ihr um einen Befreiungsschlag gegen vergangene, gegenwärtige und zukünftige unerwünschte Zuzügler, der denen keine Chance läßt. Daß diese Leute unerwünscht sind und deshalb illegal, sobald sie die deutsche Grenze überschritten haben, soll nicht erst durch den Umstand eines höchstpersönlichen (Nicht-)Anerkennungsverfahrens festgestellt werden müssen. Pauschal zurück ins Elend, aus dem sie kommen; De-facto-Todesurteile gegen Elends-Asylanten als normale Rechtslage, von der unter besonderen Bedingungen individuelle Ausnahmen gemacht werden können: Das spart Verwaltungskosten, Sozialhilfe und Umständlichkeiten beim Abschieben. Human ist es auch: Die ungebetenen Gäste laufen erst gar nicht Gefahr, sich an Lebensbedingungen zu gewöhnen, aus denen sie dann ja doch irgendwann rausgeworfen werden. Und von empörten Deutschen angezündet werden sie dann auch nicht. Soweit die „Sachfrage“.
Das Beharren der Regierung auf einem neuen Grundgesetzartikel hat daneben einen methodischen Aspekt. Die Praktiker des Asylrechts, die statt einer neuen Gesetzeslage den Vollzug der alten anmahnen, finden kein Gehör. Alle wohlmeinenden Vorschläge der SPD-Opposition, die Sache tiefer zu hängen – das Verfahrensrecht auszunutzen, das soeben beschlossene Asylverfahrens-Beschleunigungsgesetz konsequent anzuwenden, den Rechtsweg zu „vereinfachen“, rechtskräftige Abschiebungen auch zu vollstrecken, und was dergleichen sozialdemokratische Menschenfreundlichkeiten mehr sind –, um rasch zu „pragmatischen Lösungen“ zu kommen, werden zurückgewiesen. Einen Beweis nach dem andern hat die deutsche Sozialdemokratie abgeliefert, was ihre Prinzipientreue in Grundrechtsfragen wert ist – sie macht alles mit und sogar voran, nur das Prinzip soll man ihr lassen! –: es nützt ihr nichts, die Regierung will das Prinzip ändern. Und zwar in dem Wissen, daß sie dafür die SPD braucht und daß diese Partei sich wegen ihrer besonderen Art, sich das Verhältnis zwischen Regierungspraxis und Verfassungsidealismus einzuteilen, mit dem Artikel 16 viel schwerer tut als mit dem praktischen Rausschmeißen und Fernhalten von Asylbewerbern. Warum dieser Fundamentalismus von Regierungsseite?
Kenner der demokratischen Szene wissen sofort Bescheid: Die christlichen Regierungsparteien hätten hier ein wunderbares Thema gefunden, um ihre widerstrebenden Konkurrenten als Versager vor einem Problem „vorzuführen“, das „uns allen auf den Nägeln brennt“. Diese Berechnung liegt zweifellos vor, wird ja auch offen genug artikuliert und scheint für Verehrer der demokratischen Herrschaftsform gar kein schlechtes Licht auf deren Legitimationsverfahren zu werfen. Erklärt ist damit aber noch nicht, was es heißt, daß die Regierungsparteien die Auseinandersetzung mit der Opposition in dieser Frage so grundsätzlich führen und, statt gegen die „Genossen“ an den armseligen Flüchtlingen „Tatkraft“ zu beweisen – der Vertrag mit der rumänischen Regierung über die „Zurücknahme“ von zugewanderten Sinti und Roma zeigt, was da ohne Grundgesetzänderung alles geht! –, unbedingt den Konsens des parlamentarischen Gegners für eine Revision des Grundgesetzes haben wollen. Immerhin haben sie damit ja die „Blockade“ erst geschaffen, die sie jetzt als Gesetzgebungsnotstand beschreien.
Kritische Beobachter sehen in dieser berechnenden Härte der Unionsparteien, die über die „normalen“ Konkurrenzgewohnheiten demokratischer Volksparteien hinausgeht, – ausgerechnet! – Nachgiebigkeit am Werk: ängstliches Reagieren auf den Radikalismus im Volk. Meinungsbildend „Der Spiegel“:
„Reps, radikale Schläger und applaudierende Spießer können sich bestätigt fühlen: rechte Randale macht den Bonnern Beine. Die Republik rückt nach rechts – aus Angst vor einem Rechtsruck.“
Diese Erläuterung ist aus mehreren Gründen lächerlich. Sie blamiert sich an den Berechnungen, die – was dieselben Beobachter durchaus auch feststellen – die führenden Bonner Parteien mit der Randale im Volk anstellen. Sie blamiert sich an der gleichfalls jedermann bekannten und auch in diesem Fall so offenkundigen Sitte demokratischer Politiker, sich nur und immer dann auf des Volkes Meinung zu berufen, wenn sie das Gemeinte durchsetzen wollen und die öffentliche Meinung entsprechend gebildet haben – andernfalls ermahnen sie sich zur Tugend der „Unerpreßbarkeit“ –; allein in dem Sinne geben sie den „Anträgen von unten“ recht, die außer ihnen ja ohnehin niemand verbindlich artikuliert. Die Vorstellung von „Politikern auf der Flucht“ blamiert sich aber vor allem daran, daß das Volk unerbittlich „aufgeklärt“ und „informiert“ worden ist, bis schließlich dem Letzten klargeworden war, daß die Nation derzeit keine größere Sorge kennt als das „Asylproblem“. Die regierenden Demokraten haben die „drohende Überfremdung“ zu einer anerkannten Sprachregelung gemacht; sie haben das Augenmerk vom Elend, das da ankommt, ab- und auf die „mißbrauchte“ Rechtslage und das Grundgesetz hingelenkt; sie haben „unhaltbare Zustände“ organisiert, um die Schärfe des Problems sinnfällig werden zu lassen; und von ihnen stammt die Parole, Demokraten könnten in dieser Frage unmöglich „gegen den Willen des Volkes regieren“ – als wäre das in anderen Angelegenheiten nicht ihr ganzes Ethos. Es ist schon seltsam: Eine demokratisch besorgte Öffentlichkeit rätselt herum, woher denn nur die rechtsradikale Stimmung im Volk kommt – angesichts einer politischen Meinungsbildung der folgenden Art:
- Der CDU-Politiker Lummer gibt bekannt, „man könne die Heimat auch durch Masseneinwanderung verlieren. Und ein Recht auf Heimat haben die Deutschen ebenso wie andere Völker.“ Das sitzt. Sein Ressentiment gegen Ausländer läßt ein Deutscher sich nicht verbieten; da besteht er auf seinem Recht auf „Normalität“. 40 Jahre Vergangenheitsbewältigung fordern ihren Lohn. „Auch wir Deutsche haben ein Recht“ – so treten Leute auf, die es gelernt haben, jedem die demokratische „Lehre aus der Geschichte“ um die Ohren zu hauen, daß der neue deutsche Nationalismus, weil nicht mehr der von neulich, auch schon unwidersprechlich gut und gegen jeden anderen berechtigt ist. Sie werden gegen jeden ungemütlich, der nicht das gute deutsche Recht anerkennt, sich gegen die Forderung „Deutschland den Ausländern – Deutsche raus!“ zur Wehr zu setzen, als hätte die jemand erhoben. – Und für die Minderheit, der der Berliner Lummer zu primitiv ist, läßt sich dasselbe auch auf besonnene Art sagen. Parteikollege Biedenkopf, gleich stellvertretend für alle guten Ossis: „Natürlich ist die Stimmung bei den Leuten ausgesprochen schwierig. Sie erleben eine massive Einwanderung… Wir müssen darüber sprechen, wieviele verschiedene Kulturen in eine Gemeinschaft integriert werden können.“
- Partner für dieses „Gespräch“ findet der Mann überall. „Man muß auf die Gefühle im Volk Rücksicht nehmen“, vermeldet der FDP-Außenminister Kinkel mitten in die ausländerfeindliche Landschaft hinein, in der sich besagte Gefühle gerade in ein paar Pogromen ausleben. Dem Mann dürfte geläufig sein, daß Gefühle in der großen Politik an sich sehr wenig zählen, daß aber umgekehrt ein von maßgeblicher Seite ins Recht gesetzter Standpunkt an der „Basis“ einiges hermacht.
- Mitgedacht hat auch Bundesfamilienministerin Rönsch. Sie hat entdeckt, daß im Falle der Asylanten – die sollen ja eh das Land schleunigst wieder verlassen – die „Teilhabe am kulturellen Leben“ überflüssig ist, also nicht bezahlt werden muß. Eine Sparmöglichkeit! Sie will den Sozialhilfesatz für Asylanten um ein Viertel kürzen, so daß ihnen am Ende monatlich DM 76.- Taschengeld bleiben: „Die sonst so wichtige Förderung der Integration von Ausländern ist in diesem Fall nicht nötig.“ Daß sich an den in Container gesteckten Elendsgestalten für den Staat erhebliche Summen sparen lassen, ist weniger wahrscheinlich, als daß sich diese Dame mit dem von Berufs wegen geschärften Sinn für die Familie dazu berufen fühlt, die Ausländer so zu behandeln, wie sie es ihrer Meinung nach verdienen. Schon damit sie gar keine Chance haben, ihr Leben hier angenehmer zu finden als ihr Elend daheim.
- Das muß auch dem SPD-Parteichef Engholm im Kopf umgehen: „Die Akzeptanz der Deutschen – nicht nur der ganz Rechten –, mit Ausländern zu leben, nehme ständig ab. Die Unterkünfte kämen so teuer, daß im nächsten Jahr an öffentlichen Ausgaben gespart werden müsse, die eine breite Schicht der Menschen bei uns betreffen.“ Die Aussage, daß ihm jeder Pfennig für besagte Containerplätze zuviel ist, ist an sich deutlich genug. Seine Akzeptanz ist erschöpft. Der noble Herr, der seinen guten Geschmack als Kenner edler Genüsse oft genug unter Beweis stellt, versteht die Sache jedoch als Mission. Um seine Parteibasis zu überzeugen, rechnet er die Pfennige zu beträchtlichen Staatsausgaben hoch. Und damit seine Botschaft auch ankommt, stellt er das gute deutsche Geld, das der Staat an Ausländer weggibt, in ein Verhältnis zu öffentlichen Ausgaben, die der Staat an seinem Volk einspart. Das tut der Staat zwar ohnehin und nicht wegen der Ausländer. Diese Verknüpfung macht aber das Akzeptanzproblem des Sozialdemokraten auch für all diejenigen interessant, die sich bislang noch nicht unbedingt als Betroffene des „Ausländerproblems“ gesehen haben. Sie dürfen sich bei jeder künftigen Steuererhöhung oder Kürzung der Krankenkassenleistungen die Asylanten als Grund ihrer zusätzlichen Belastung vorstellen.
Und so weiter; die Auswahl ist rein zufällig. Es mag ja sein, daß selbst unter den hochgestellten Politikern der Nation der eine oder andere über den ausländerfeindlichen Terrorismus der rechten Szene, der so gar nicht aufhören will, ernstlich erschrocken ist. Sehr viel verbreiteter dürfte in diesen Kreisen eine „klammheimliche Freude“ gewesen sein – danach zu urteilen, wie begeistert jeder neue Brandanschlag ohne jedes Zwischenargument als Ansporn aufgegriffen worden ist, „endlich“ zu tun, was man schon längst will, nämlich den Artikel 16 zu ändern, mit allen Konsequenzen. Daß diese Reaktion die Absicht der Rechtsterroristen ins Recht setzt, daß sie sogar die Gewalttat als solche wie ein zusätzliches Argument für den Standpunkt der offiziellen Asylpolitik würdigt, ist weder schwer zu begreifen noch ungesagt geblieben. Gebremst hat das keinen, weder Stoiber noch Süßmuth noch Engholm. Der süße Vorschlag einiger Linksliberaler, jede parlamentarische Befassung mit dem „Asylproblem“ bis zur Einstellung der ausländerfeindlichen Randale auszusetzen, um so die fanatisierte Rechte zu ein bißchen Anstand zu „erpressen“, ist gleich wieder in der Versenkung verschwunden. Die Republikführung ist sich parteiübergreifend einig geworden, den terroristischen Umtrieben der Rechten sei nur dadurch wirksam zu begegnen, daß man ihnen durch eine entschlossene Grundrechtsänderung das Wasser abgräbt; andernfalls geriete die Demokratie in Gefahr, weil die Regierenden ihrem rechtsradikal erregten Volk Machtentfaltung schuldig blieben. Die SPD hat sich diesem Notstandsstandpunkt der Regierung angeschlossen – auch wenn sie das Wort „Notstand“ nach wie vor unpassend findet – und im Lichte ihrer antifaschistischen Tradition zurechtgelegt. Der nordrheinwestfälische Innenminister Schnoor: „Ich habe die große Sorge, daß wir, wenn wir jetzt nicht reagieren, den Nährboden für einen neuen Faschismus bereiten könnten.“ Und der Liebhaber toskanischer Landschaften Engholm kann dem nur beipflichten: „Dann übernähmen das Problem andere Kräfte im Land auf eine Art, daß uns die Ohren klingen.“ Auf welche Art wohl? Die beiden sagen doch deutlich genug, daß sie mit ihrer „Problemlösung“ den Faschisten zuvorkommen wollen.
Und spätestens an dieser grundsätzlichen Herangehensweise wird wieder klar, daß die Bonner Politiker unmöglich nur das Asylanten-Abschieben im Auge haben. Dieser „Notstand“ ist auch Mittel zum Zweck. Nämlich dazu, in die Politik den Standpunkt der nationalen Not einzuführen – und im Volk ein entsprechendes nationales Notstandsbewußtsein zu erzeugen, das pur um die Macht der Staatsmacht fürchtet, Machtbeweise verlangt und dafür nichts geringeres als Grund geltend macht als das ungeschminkt Herrschaft einfordernde „Wir sind das Volk!“
Rechtsstaatlichkeit auf den Punkt gebracht: Entfesselung der staatlichen Gewalt
Im Konsens aller ernsthaften Demokraten liest die Republik ihr Grundgesetz neu und kommt zu dem Schluß, daß es mit der alten Rechtslage nicht mehr weitergeht. Der Asylartikel bekommt eine exemplarische Bedeutung: Das Recht, das die Verfassungsväter einem unbestimmten Kreis von Ausländern gewährt haben, begründet staatliche Ohnmacht; denn mit ihm liefert der deutsche Staat sich heranflutenden Elendsflüchtlingen aus. Um ihre Handlungsfreiheit zurückzugewinnen, muß die Staatsmacht ihr Bedürfnis ganz nach vorne rücken und die Verfassung darauf zuschneiden. Prinzipien, deren Unveränderbarkeit das alte Grundgesetz dekretiert, dürfen „kein Tabu“ sein; auch dann nicht, wenn sie früher zum Stolz und zur Ehre der neuen Republik beigetragen haben.
Diesen grundsätzlichen Aspekt der „bitter nötigen“ Änderung des Artikels 16 elaboriert die verfassungsändernde demokratische Mehrheit in Bonn noch grundsätzlicher am Artikel 19, der methodisch das Verhältnis zwischen Staatsmacht und privaten Interessen festlegt: Jeder – dummerweise heißt es noch nicht einmal: jeder Deutsche – hat das Recht, ihn betreffende staatliche Entscheidungen „auf dem Rechtsweg“ überprüfen zu lassen. Es handelt sich hier um ein ziemlich heiliges Prinzip des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat, der alles, was in seiner Gesellschaft geschieht – das Treiben seiner Bürger, das Agieren von Interessenverbänden und Parteien… –, an seinem Recht mißt und nur an ihm messen läßt, unterwirft auch seine eigenen ausführenden Organe und selbst die von ihm eingerichteten Agenturen der Rechtsprechung, die Gerichte, diesem Maßstab. Da werden nicht nur Tat und Gesetz, Sach- und Rechtslage pausenlos sowieso verglichen, damit kein Interesse etwas gilt, das nicht dem Recht entspricht. Ob dieser Vergleich auch ordnungs-, d.h. rechtsgemäß durchgeführt wird, läßt der Rechtsstaat selbst noch einmal nach dem Maßstab des Rechts überprüfen. Für diese Prüfung hat er einen Rechtsweg eingerichtet, der jedem offensteht und Gerichte mit der Aufgabe versieht, über die Urteile von Gerichten zu urteilen. Daß Asylbewerber gegen Ablehnungsbescheide klagen können, war wirklich nie gemeint und wird jetzt zum Anlaß, die Anwendung dieses Prinzips einmal unvoreingenommen zur Debatte zu stellen. Nicht um es wegzuwerfen; wo die Staatsgewalt so gegensätzliche Interessen zu hüten hat und mit ihren Entscheidungen in so heilige Belange wie die des Eigentums eingreift, muß sorgfältig und mit Methode abgewogen werden, welche Interessen wirklich geschädigt und welche berücksichtigt werden sollen. Deutschland, so wie es heute dasteht, kennt aber genügend Fälle, in denen dem Rechtsstaat sein eigenes Verfahren ein wenig kompliziert vorkommt. Beim Bau von Eisenbahnlinien und Autobahnen zum Beispiel, nicht bloß durch die Ostzone, ist das Einspruchs- und Klagerecht Betroffener eine Behinderung des nationalen Interesses; überhaupt wird der gesamte „Aufbau Ost“ nach maßgeblicher Auffassung hauptsächlich durch die verzögernde Wirkung von Rechtsgarantien für jedermann hintertrieben. Das hat mit den Asylbewerbern zwar gar nichts zu tun, um so mehr aber mit der Notstandsdefinition des Bundeskanzlers und dem Konsens aller Demokraten, daß dem Staat in seiner schweren Lage nirgends „die Hände gebunden“ sein dürfen.
Also schaffen sie neues Recht. Und zwar in einer Weise, die – ganz im Sinne kommunistischer Kritik – mal Klarheit stiftet über das Verhältnis zwischen Rechtsgrundsätzen, politischen Absichten und staatlichen Berechnungen. Der Schein, daß das Recht über dem Staat steht und Staat und Gesellschaft gleichermaßen an eherne Prinzipien bindet, kommt dabei nämlich ziemlich unter die Räder. Bemerkenswert sachgerecht hält die deutsche Demokratie die logische Reihenfolge von Zweck und Mittel ein. Sie stellt ihren Handlungsbedarf fest, um danach die Zweckmäßigkeit der vorhandenen rechtlichen Instrumente zu begutachten. Entsprechend richtet sie diese Instrumente ein. Gegebenenfalls werden sie ausrangiert, verändert oder ihr Arsenal erweitert. Was dabei die effektivste Lösung ist, wird unter Beteiligung aller demokratischen Kräfte eifrig diskutiert. Das sorgt für den Dissens zwischen den Parteien, der die Demokratie so lebenswert macht.
- Anläßlich der rechtsradikalen Ausschreitungen wird parteiübergreifend der Ruf nach härterem Zuschlagen laut; zur Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols. Etliche christliche und sozialdemokratische Politiker melden das Bedürfnis nach verschärften Straf- und Strafverfolgungsgesetzen an; auch nach einer Aufstockung von Bereitschaftspolizei und Verfassungsschutz. Dabei ist es ziemlich gleichgültig, ob sie den zusätzlichen Ordnungsbedarf des Staates schon seit längerem in sich verspüren und Typen wie Stoiber und Seiters die passenden Gesetzesvorlagen (Land-friedensbruch-Paragraph, zusätzliche Möglichkeiten des Demonstrationsverbots, Möglichkeiten der präventiven Verhaftung, Vorfeldbeobachtung etc.) in ihren Schubladen liegen haben, oder ob der Drang, der Staat möge seiner Exekutive mehr genehmigen, erst anläßlich der Ausschreitungen entwickelt wurde. Schärfere „Gesetze gegen rechts“, wie sie einige Sozialdemokraten gefordert haben, sind schließlich auch nichts anderes als schärfere Gesetze, reichen also über den Anlaß hinaus. Die Sache ist jedenfalls eindeutig: Zur Beaufsichtigung der Gesellschaft fordern diese Politiker ein Mehr an staatlicher Gewalt. Der Rechtsstaat soll sich dieses Mehr an Gewalt genehmigen. Bestehendes Recht, sofern es diese Genehmigung nicht beinhaltet, soll umgestoßen werden. – So etwas fordert in einer streitbaren Demokratie natürlich zum Widerspruch heraus. Und zwar genau zu dem und nur zu dem, den der ehemalige SPD-Chef Vogel für seine Partei formuliert hat: „Dabei (bei der Sicherung des Gewaltmonopols) erscheint mir die Suche nach neuen Instrumenten und zusätzlichen Regelungen weniger dringlich als der entschlossene Einsatz der bereits vorhandenen und bewährten Mittel.“ Der zusätzliche Bedarf an staatlicher Gewalt für die gewachsenen Ansprüche der Demokratie, ihr Innenleben zu beaufsichtigen, wird von der deutschen Sozialdemokratie ausdrücklich bestätigt. Auch die instrumentelle Sicht des Rechts teilt sie mit den regierenden Christen. Sie ist nur der Auffassung, daß das bestehende Recht dem Staat bereits alle Freiheiten gewährt, die er nun in Anspruch nehmen will und soll. Und daß es höchste Zeit ist, sie auszuschöpfen.
- Aus anderem Anlaß und nach demselben Muster will sich die Demokratie noch ein paar weitere Freiheiten genehmigen. Das „organisierte Verbrechen“ läßt den Staat nicht ruhen. Das liegt einerseits daran, daß er es prinzipiell zu seinen Aufgaben zählt, darauf zu achten, daß gegen seine Gesetze nicht verstoßen wird. Er ist die Gewalt, die die Klassengesellschaft einrichtet und ihr Funktionieren beaufsichtigt. Als diese Gewalt verbietet er einiges von dem, was in dieser Gesellschaft aus durchaus anerkannten Motiven – Gelderwerb, Eifersucht, Konkurrenz um die politische Macht – üblich ist. Zuwiderhandlungen gegen seine Verbote bezieht er auf sich, sein Recht ist verletzt, so daß er sich aufgerufen sieht, tätig zu werden. Für die Verfolgung von Verstößen gegen sein Recht und für die Bestrafung der Täter, mit der er das Recht wiederherstellt, tut er das Nötige. – Nun ist auch auf diesem Feld der Rechtspflege zusätzlicher Handlungsbedarf in Sicht. Und zwar aufgrund einer neuen Sichtweise des Verbrechensalltags: Die Staatsmacht fragt sich schon wieder, ob sie nicht durch zu lasche Handhabung ihrer Macht ihre Macht verspielt und am Ende sogar eine Konkurrenz zu sich zuläßt. Die Frage, ob es in Deutschland eine Mafia oder sogar schon die Mafia gibt und manchen anderen kriminellen Sumpf, auf die auch der zuständige deutsche Staatsanwalt im Fernsehen noch keine rechte Antwort geben konnte, meldet den Verdacht an, es könnte eine Verbrecherszene in Deutschland geben, weil der Staat sie nicht von vornherein im Griff hat und überhaupt seine Gesellschaft zu wenig beaufsichtigt. Das schreit nach neuen Ermittlungsgesetzen. Unter so schönen Titeln wie „polizeigerechterer Einsatz von verdeckten Ermittlern“, „Ermöglichung von milieugerechtem Verhalten“ und „Möglichkeiten sanktionsfreier Regelverletzungen“ werden derzeit Gesetze diskutiert, die es Polizeibeamten im Ermittlungsdienst erlauben sollen, sich in ihrem Verhalten der Verbrecherszene anzupassen, die sie ausforschen sollen. Die durch die Verfassung verbürgte Unverletzlichkeit der Privatwohnungen ist als unzulässige Behinderung polizeilicher Ermittlungstätigkeit zu werten und daher durch den Gesetzgeber außer Kraft zu setzen; strittig ist allenfalls, wie weit die „Lauschangriffe“ gehen dürfen. Auch die Datenschützer haben längst ein Einsehen mit den staatlichen Kontrollbedürfnissen. Im Namen des Grundrechts haben sie sich zu Wort gemeldet und den Vorschlag gemacht, nur den Begriff der „Wohnung“ enger zu fassen, damit das Kontrollrecht des Staates weiter reicht und das Grundrecht des Bürgers im Prinzip erhalten bleibt. – Vieles von dem, was der Staat sich und seinen Ermittlungsbehörden da genehmigen will, ist – jedermann bekannt – geübte Praxis. Bemerkenswert ist es dennoch. Zum einen, weil die rechtsförmliche Legitimierung dieser Praxis ihr natürlich einen Aufschwung verleiht. Das ist schließlich bezweckt, wenn solche Gesetzesänderungen betrieben werden. Zum anderen, weil es durchaus interessant ist, wie der Staat mit seinen eigenen Rechtsprinzipien verfährt. Überschreiten die staatlichen Organe bei der Verfolgung ihres Auftrags die Grenzen des Rechts, so führt das nicht zur Kritik seiner ausführenden Organe, sondern zu einer Kritik des bestehenden Rechts. Die begleitenden öffentlichen Einwürfe und Diskussionen führen die Logik, nach der rechtsstaatlich denkende Demokraten sich zu der neuen Linie hinentschließen, mustergültig vor: Ein regierender Politiker erklärt eine Rechtslage für überholt, weil sie ihn in seinem Tatendrang behindert; die Freunde des bestehenden Rechts bestreiten nicht den „Handlungsbedarf“, betonen aber, daß die geltenden Grundsätze und Gesetze ihm längst gerecht werden; wenn es so ist, spricht aber auch nicht mehr viel gegen eine „klarstellende Ergänzung“ der Rechtslage, die das angemeldete Bedürfnis der Staatsmacht zur Vorschrift erhebt. Nach diesem Muster macht die SPD mit allen ihren „Flügeln“ wieder einmal alles mit, was „mit Sozialdemokraten nicht zu machen“ ist.
- Auch die Justiz tut mit und scheut sich nicht, „juristisches Neuland“ zu betreten, wo politische Bedürfnisse der Nation rechtsstaatlich befriedigt werden wollen: Sie bewährt sich in der Abrechnung mit der menschlichen Hinterlassenschaft der alten DDR. Hunderttausende frühere Bürger dieses Staates werden aus ihren Berufen entfernt; nicht, weil kein Unternehmen sie lohnend einsetzen kann – das trifft andere Millionen Ost-Bürger –, sondern weil sie im alten Staat nach dessen Rechtslage so loyal und übereifrig mitgemacht haben, wie das hierzulande auch von jedermann im allgemeinen und Beamten im Besonderen erwartet wird. An den verbliebenen Personen exekutiert der Rechtsstaat sein moralisches Verdikt über den „Unrechtsstaat“; großenteils auf Grundlage von „Akten, die die Justiz in einem Rechtsstaat gar nicht hätte“ (Behördenleiter Gauck); die unabhängigen Richter in den Berufungsinstanzen geben ihren Segen dazu. Grenzsoldaten, die das seinerzeit geltende und gar nicht aus dem völkerrechtlichen Rahmen fallende DDR-Grenzgesetz exekutiert haben, werden wegen Totschlag verurteilt; nicht nach dem Buchstaben des bundesdeutschen Rechts, weil dessen rückwirkende Geltung ausgeschlossen worden ist; auch nicht nach dem Geist der DDR-Gesetze, weil die ja die Verhinderung illegaler Grenzübertritte befahlen; die schöpferische Lösung bringen „die Menschenrechte“ – was allgemein als „rechtsdogmatische Sensation“ vermerkt wurde. Aus den völkerrechtlichen Grundsätzen des Menschenrechts strafrechtliche Konsequenzen abzuleiten, ist nämlich unter Juristen gar nicht vorgesehen – und der imperialistischen deutschen Nation so richtig würdig. Wie es die Juristen vom Bundesgerichtshof mit ihrer verdrechselten Konstruktion geschafft haben, den Vorwurf der Rechtsbeugung zu entkräften und gleichzeitig das Recht entsprechend den politischen Absichten neu auszugestalten, wurde ihnen von der Öffentlichkeit gedankt. Sie haben damit ein Urteil gesprochen, das „Folgen für 1200 noch anhängige Verfahren“ haben wird und „den Weg befestigt“, auf dem Honecker seiner Strafe zugeführt wird. Denn das ist überhaupt die rechtsstaatliche Spitzenleistung der deut-schen Justiz: den ehemaligen DDR- und SED-Chef auf die Anklagebank setzen; dabei täglich zehnmal dementieren, was jeder als den wahren Zweck des ganzen Unternehmens weiß und was ja auch bloß seine öffentliche Beliebtheit begründet, nämlich daß es um die formvollendete, aktenkundige, rechtsverbindliche Kriminalisierung des ehemaligen „realen Sozialismus“ geht; und diesen Zweck mit einer rechtsstaatlichen Würde durchziehen, an der jedes bedenkliche Wort über den Sinn dieses Schauprozesses einfach abtropft – die Justiz hat ja noch nicht einmal das Fernsehen hinbestellt, das hat sich sein Teilnahmerecht im Gegenteil erst rechtsstaatlich erkämpft: So, in glaubwürdiger Arbeitsteilung zwischen den Institutionen des öffentlichen Rechts, inszeniert eine funktionierende Demokratie ihre Schauprozesse! Und wozu? Damit vom feindlichen Staat und System im Rückblick nichts anderes übrigbleibt als eine nationale Schande – das ist die siegreiche Demokratie sich schuldig, und nebenbei ist es eine kleine moralische Dienstleistung gerade für ihre neuen Bürger, die unterm SED-Regime anders, aber nicht unbedingt schlechter gelebt und nach Gemütlichkeit gestrebt haben als unterm demokratischen Kapitalismus und deswegen ihr neues nationales Glück noch immer nicht so richtig fassen können.
- Der PDS, die sich noch immer zu ein paar ausgewählten „guten Seiten“ jenes untergegangenen „Unrechtsstaats“ bekennt, wird – vorerst – nicht der Prozeß gemacht. Das regt manchen aufrechten Demokraten auf, hat jedoch seinen guten Grund. Sie wird von der Demokratie anders fertig gemacht. Durch den Urteilsspruch eines deutschen Gerichts ist bereits grundsätzlich festgestellt, daß sie als Rechtsnachfolger des DDR-Unrechts mit ihrer Parteikasse für Entschädigungen von DDR-Unrecht einzustehen hat. Und zu all diesen Einsätzen hat mit Sicherheit kein politischer Auftraggeber die unabhängige deutsche Justiz erst drängen müssen. Umgekehrt wird sie auch niemand davon abhalten müssen, den Verbandsvorsitzenden der deutschen Industriellen wegen Aufforderung zum Verfassungsbruch zur Rechenschaft zu ziehen, weil er seinen Unternehmern vorgeschlagen hat, radikale politische Gesinnung von Arbeitnehmern mit Entlassung zu ahnden. Auch der Kanzler braucht nicht zu fürchten, daß die Rechtskonstruktion, die seinen Kollegen Honecker vor Gericht gebracht hat, analog auf ihn angewandt wird und er sich für die Leichen verantworten muß, die die Praxis des deutschen Asylrechts fordert – aber natürlich sind die Strafgelder gegen Schiffsbesatzungen wegen eingeschleppter Asylbewerber keine „Kettenanstiftung“ zum Totschlag, auch wenn sie für die Seeleute der Grund sind, blinde Passagiere zu erschlagen und ins Meer zu werfen, was in der christlichen Seefahrt mittlerweile zur gängigen Übung geworden ist. Und kein Verfassungsrichter wird der CSU den Prozeß machen, weil sie das Asylgrundrecht ganz abschaffen will, notfalls auch noch durch einfaches Gesetz, obwohl das Grundgesetz in Artikel 19 Absatz 2 verbietet, „ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt“ anzutasten; oder weil sie bloß ein bißchen darüber nachdenkt, im Zuge der allgemeinen Effektivierung der Rechtslage an den Rechtsgrundsatz des Artikels 103 heranzugehen, der die Bestrafung einer Tat an ihre Strafbarkeit „zum Zeitpunkt der Tat“ bindet – was gerade bei der Abrechnung mit der menschlichen Hinterlassenschaft der DDR die Sache doch wirklich nur aufhält… Schließlich ist die Justiz, bloß weil unabhängig, nicht auch weltfremd. Ganz und nur dem Recht ergeben, sorgt sie dafür, daß die rechtsstaatlichen Normen den politischen Absichten genügen, die mit der Dringlichkeit von nationalen Notlagen auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Denn das ist der Standpunkt, den die deutsche Staatsgewalt in ihrer Unzufriedenheit mit der geltenden Rechtslage einnimmt – den nächsten „Gesetzgebungsnotstand“ nach Art des „Asylproblems“ bahnt die Regierung bereits in der Frage der Bewegungsfreiheit deutscher Truppen an, die die Nation auch wieder ausgiebig beschäftigen wird. An Asylanten und Ausländern, am organisierten Verbrechen und am Drogenkonsum, am Rechtsradikalismus – und den „Linksextremisten“ natürlich –, an wirklichen oder vermuteten „Seilschaften“ aus DDR-Zeiten und sogar noch an Baugenehmigungsverfahren entdeckt die deutsche Demokratie derzeit nicht mehr bloß Notwendigkeiten einer ordentlichen Politik, sondern eine notstandsähnliche Ohnmacht der Staatsmacht, die deswegen unbedingt entfesselt werden muß. Was läßt diesen Staat so radikal werden?
Der „Kampf gegen rechts“: Nationaler Schulterschluß fürs Gewaltmonopol
Kein Zweifel: Der Radikalismus seiner rechten Szene geht dem deutschen Staat zu weit. Die „politische Klasse“ – wie man ja nun auch in Deutschland sagt, nachdem es endgültig keine gesellschaftlichen Klassen mehr gibt – meint es ernst, wenn sie sich von Gewalttätern distanziert, die Ausländer zusammenschlagen und gelegentlich umbringen, Asylantenheime anzünden und, noch schlimmer, jüdische Gedenkstätten schänden. Mit aller Entschiedenheit ist man dagegen – und unter was für Gesichtspunkten!
Als erstes waren sich die tonangebenden Kreise der Republik darüber einig, wer als das eigentliche Opfer des ausländerfeindlichen Terrors zu betrachten ist: die deutsche Demokratie; als zweites stand fest, wie die Täter einzuschätzen seien: in der Hauptsache unpolitische, orientierungslose, im Suff zu derben Scherzen aufgelegte junge Leute mit einigen wenigen neonazistischen, was soviel heißen soll wie: unbegreiflich bösen Anführern. Zusammengefaßt in der Diagnose des „Spiegel“-Titels: „Wut auf den Staat“.
Es nützt den rechten Schlägern also nichts, daß sie sich gerne mit Deutschlands Nationalfarben ausstatten und unter der Parole „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!“ marschieren: Ein politisches Werturteil als Grundlage ihres schlichten Gemütslebens, eine „Wut“ unter dem ja wirklich nicht der Privatsphäre entstammenden Gesichtspunkt der Volkszugehörigkeit bzw. -fremdheit, eine gewisse Parteilichkeit für den Staat in der Mitte Europas, all das wird ihnen nicht zugebilligt. Vielleicht halten die Meinungsführer dieser Nation einen Nationalismus, der den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, tatsächlich für so normal und menschennatürlich, daß sie das Politische daran, die Herkunft der Staatsgesinnung aus der Parteilichkeit für die politische Gewalt, gar nicht entdecken können. Auf alle Fälle finden sie diese Gesinnung dermaßen in Ordnung, daß sie fest entschlossen sind, sie den Extremisten dieser Gesinnung schlicht abzusprechen – sie stünden sonst ja auch vor der schwierigen Aufgabe, einen politischen Unterschied zwischen der offiziellen Politik – für Deutschland, gegen die „Asylantenflut“ – und der rechtsextremen Bürgerinitiative – gegen „herbeigeflutete“ Asylanten, für die Deutschen – auszumachen. So will die deutsche Öffentlichkeit am rechtsradikalen Schlägertum ganz dezidiert nur das Schlägern und nicht seinen politischen Inhalt und Grund zur Kenntnis nehmen und verwerflich finden. Nur die private Gewalt wollen sie bemerken, die sich unberechtigterweise über die rechtmäßige des Staates hinwegsetzt. Über die Politisierung von Demokraten gibt das einigen Aufschluß: Rechtsfragen beim Zuschlagen scheinen bei denen zu den obersten Maßstäben der Urteilsbildung zu gehören.
Diese Kritik – am unbefugten, bloß privaten „Aufklatschen“, das sich womöglich auch noch organisieren könnte – kommt allerdings sehr machtvoll und grundsätzlich daher: als Sorge um die Demokratie, die nämlich unter drangsalierten und erschlagenen Asylbewerbern insofern leidet, als dadurch ihr Gewaltmonopol Schaden nimmt. Das muß verteidigt, und dafür muß es nachdrücklich eingesetzt werden: In diesem Standpunkt sind sich von Stoiber und der CSU bis zu den letzten Linksliberalen im Lande alle Parteien und öffentlichen Meinungen anläßlich „Rostock“ und der Folgen einig geworden. Das ist insofern bemerkenswert, als die Demokratie, zu deren Verteidigung ihre Führer und Wortführer sich aufrufen, gar nicht zuallererst selber asylantenfreundlicher als die Rechten zu werden braucht; es geht eben wirklich um nichts anderes als darum, daß unbefugte Gewalt zu unterbleiben hat. Alle Gesichtspunkte, die den politischen Gebrauch der Staatsmacht, womöglich ihre Verwendung im Sinne humanitärer Ideale, betreffen, sind belanglos, wenn die Verteidiger der Demokratie grundsätzlich werden. Dann geht es auch den Linksliberalen um die Souveränität als solche und sonst nichts. Dieser Standpunkt wird auch dadurch nicht ziviler, geschweige denn menschenfreundlicher, daß er sich auf armselige Flüchtlinge als Opfer der „Gewaltmonopolverletzung“ durch rechte Terroristen beruft; er offenbart damit nur seine zynische Seite – denn zynisch ist es, in der rechtsradikalen Hatz auf alles Undeutsche vor allem eine Versündigung am Monopol des Staats auf Gewaltanwendung zu sehen; zumal eben dieser Staat sich auf eine anständige Behandlung der in seinem Namen angegriffenen Flüchtlinge gar nicht festlegen lassen will, sondern das Gegenteil festlegt. Schließlich nimmt sich die demokratische Staatsmacht gerade in aller Form die Freiheit, unter Einsatz ihrer Monopolgewalt flächendeckend und systematisch illegale Zuzügler „aufzuklatschen“ und massenhaft ins Elend abzuschieben.
Mittlerweile finden aber selbst letzte Linke im Land nichts mehr dabei, angesichts der Gewalttätigkeit der Rechten ganz grundsätzlich auf die Polizeigewalt des Staates zu setzen, der den Rechtsradikalen ihr politisches Anliegen überhaupt erst eingegeben und ihnen darin recht gegeben hat und deswegen auch schon mal einen Übergriff als Jugendsünde, eine Übungshandgranate vor dem Asylantenheim als groben Bundeswehr-Unfug verzeiht. Links ist es in Deutschland heutzutage, gegen die – in der Sache doch gut begründete – Toleranz zu protestieren, die Polizei und Justiz oft genug gegenüber rechten Schlägern walten lassen, in den parteiübergreifenden Ruf nach „unnachsichtiger Härte gegen Gewalttäter auch von rechts“ einzustimmen und, wenn dieser Antrag nicht hart genug erfüllt wird, rückblickend Ungleichbehandlung zu beklagen und den politischen Polizeichefs den furchtbaren Vorwurf der „Einäugigkeit“ entgegenzuschleudern. Diese Linken bemerken noch nicht einmal mehr, daß sie der gewaltsamen Abfuhr, die derselbe Staat im Namen seines Gewaltmonopols ihnen und ihrer Sache – ob das nun Abrüstung oder Umweltschutz war – erteilt hat, im Nachhinein recht geben. Und auf den Grund gewisser Unterschiede bei der Selbstverteidigung des Staates gegen rechte Gewalttäter und gegen linke Umtriebe kommen sie erst recht nie: Gegen die Rechtsradikalen verteidigt der Staat tatsächlich nur sein Monopol auf Gewalt; linke Trillerpfeifen dagegen werden wegen der politischen Absicht, die Staatsmacht als bloße Bedingung für höhere Zwecke in Anspruch zu nehmen und daran auch zu relativieren, als Verstoß gegen die zivilisierenden Leistungen des staatlichen Machtmonopols gedeutet und, notfalls mit Hilfe gewagter Analogieschlüsse, unter den Tatbestand „privater Gewalt“ subsumiert. Aber dieser Unterschied interessiert „Linke“ sowieso nicht mehr, die solche „höheren Zwecke“ gar nicht mehr vertreten und den Staat daran messen und verbessern wollen, sondern die mit der deutschen Staatsgewalt, wie sie ist, „gegen rechts“ endgültig einig werden wollen, über alle früheren Zerwürfnisse hinweg. Im Zeichen der „Gefahr von rechts“ und des allgemeinen „Wehret den Anfängen!“ verständigen sich die Demokraten aller „Lager“ darauf, für den Staat und sonst nichts zu sein; und ein „Schönwetter-Demokrat“ ist im heutigen Deutschland nicht mehr, wer im Verdacht steht, bei der erstbesten Herausforderung der Staatsmacht dem demokratischen Procedere abzuschwören, sondern umgekehrt derjenige, der sich nachsagen läßt, er würde der Demokratie nicht umstandslos jedes Notstandsrecht zubilligen.
So fügt sich der demokratische Schulterschluß gegen die rechtsextreme Militanz bruchlos ein in die ausgesprochen extreme Generallinie der deutschen Politik, überall und umfassend der Gefahr staatlicher Ohnmacht vorzubeugen.
Die Berliner Kundgebung und das Recht der Staatsmacht auf ungestörte Imagepflege
Wenn Asylbewerber schlecht behandelt werden, dann ist das eine Sache; da geht die Staatsmacht beispielhaft voran und kann Eigenmächtigkeit nicht leiden. Wenn jüdische Gedenkstätten geschändet werden, so ist das eine andere Sache; dann geht auch die alltägliche Ausländerfeindlichkeit von unten endgültig zu weit; denn dann richtet sich das alles gegen Deutschlands Ehre und Ansehen in der Welt, und da verstehen die Führer der Nation keine „groben Späße“. Wenn dann aber die Spitzen des Staates und Säulen der Demokratie eine nationale Großkundgebung nach Berlin einberufen, um „der Welt zu zeigen, daß das Bild vom häßlichen Deutschen nicht das richtige ist…“ (Demo-Aufruf), und eine kleine linke Szene – „300 Demonstrations-Terroristen“ (Bürgermeister Diepgen) – macht die Show kaputt, weil sie sich medienwirksam vor die Rednertribüne postiert, trillerpfeift und sogar Eier wirft, dann ist der Skandal perfekt.
Dann geht als erstes die Fernsehübertragung, angelegt auf nationale Feierstunde mit Bundespräsident und sonstiger „hochkarätiger“ Politikerprominenz in eine stundenlange giftige Hetze gegen den „Terror von links“ – „so schlimm wie der von rechts…“ – über, die gewisse Zweifel am Alphabetisierungsgrad des ZDF-Moderators und seines Helfers von der Bundeswehrhochschule München weckt. Konnten die die Transparente nicht lesen, die ihre eigenen Kameras immerhin ins Bild gerückt haben? Auf denen stand doch ein nicht ganz leicht zu nehmender Einwand gegen die Veranstaltung, einschließlich der gestörten Präsidentenrede, nämlich die Bezichtigung der zur Imagepflege angetretenen führenden deutschen „Biedermänner“, in der Ausländerfrage die „Brandstifter“ zu sein. Oder haben die Moderatoren vor lauter gerechter Empörung über die gestohlene Show den Vorwurf der Heuchelei an Politiker, die Menschlichkeit predigen und daraus erklärtermaßen ihr gutes nationales Gewissen beim massenhaft wirkenden Abschiebungsurteil gegen Elendsflüchtlinge schöpfen, überhört? Denn damit war doch zumindest klar, daß die Störung nichts mit dem Anliegen der ausländerfeindlichen Rechten zu tun hatte, auch nicht „objektiv“, sondern gegen die objektiv gegebene politische Übereinstimmung zwischen Asylpolitikern und rechtsradikaler Szene gerichtet war.
Doch gegen den unmißverständlichen Inhalt der Anti-Demonstration blieb die organisierte Öffentlichkeit bemerkenswert immun. Sie hielt es treu mit dem Zweck der Demonstration: ein Bild vom guten Deutschland abzuliefern. Der Inhalt: ein Bekenntnis zum Artikel 1 des Grundgesetzes, der erklärtermaßen gar nichts mit der wirklichen Asylpolitik und der staatlichen Ausländersortierung und sonstigen „politischen Streitfragen“ zu tun hat und haben soll; der die Menschenwürde des Asylbewerbers vielmehr dahingehend definiert, daß nur private Gewalt ihr schadet, der großartige deutsche Staat hingegen sie per definitionem gar nicht antasten kann; der also – was Kommunisten schon immer behauptet haben – am Gattungswesen Mensch und seiner „Würde“ nichts als ein denkbar unantastbares Kompliment an den deutschen Staat ausdrückt. Die Form: Führung redet zu gleichgesinntem und -gestimmtem Volk, welches sich zahlreich versammelt.
Eine Großkundgebung für den Staat und sein Gewaltmonopol war geplant; und damit stand von vornherein fest, welche Lehre aus ihrer Störung zu ziehen war. Eine etwas andere nämlich als die, die z.B. in Rostock genauso schnell, nämlich auch schon vorher fertig war – nach dem Rostocker Muster hätte es heißen müssen: Behandelt endlich die Asylbewerber anständig, dann werden auch die Trillerpfeifen überflüssig! Aber es wurde eben kein Asylantenheim angezündet, sondern ein Staatsakt gestört. Und damit sieht nicht bloß die „Frankfurter Allgemeine“ „klarer. In Deutschland besteht nicht nur die Gefahr des Rechtsextremismus, wie uns die Linke weismachen will, sondern nach wie vor auch die des Linksextremismus und der staatszerstörenden ‚autonomen‘ Machtgier.“ (10.11.) Auch „die tageszeitung“ trauert dem „einmaligen Ereignis“ einer Einheitsfront gegen rechts von Kohl bis zur „deutschen Linken“ hinterher, als wäre der Konsens etwas wert – der taz eben schon, nämlich die Chance, „die Politiker beim auf dieser Demonstration gesprochenen Wort zu nehmen“, als wäre da anderes gesprochen worden als die Mahnung, alle Gewalt dem Staat zu überlassen, und als ließen sich Politiker bei irgendeinem anderen Wort nehmen; nun bleibt dem Blatt die Hoffnung, daß die „politische Klasse“ ihr Wort auch von alleine hält. Dem ZDF wird „wie in Rostock klar“, daß der „Angriff der Terroristen nicht gegen Ausländer, sondern gegen unseren Staat“ gerichtet ist – das stiftet immerhin Klarheit, was Demokraten alles nicht unterscheiden wollen, wenn es um eine „Demonstration für eine wehrhafte Demokratie“ (der Berliner Bürgermeister) geht, nämlich noch nicht einmal faschistische Brandsätze von antifaschistischen Heuchelei-Vorwürfen. Und der Bundeswehrprofessor aus München zieht schon vorweg sein Resümee: Die Politik ist am Ende, wenn sie sich Störern geschlagen geben muß und nicht durchsetzen kann, was sie will.
In diesem Sinne folgt der Einordnung des Staatsverbrechens gegen die Berliner Staatskundgebung die Manöverkritik. Erstens am Ablauf: Man hätte das verhindern müssen! Wozu hat man denn den Verfassungsschutz, der alles schon vorher wußte? Wozu hat man alle polizeilichen Mittel, wenn sie nicht erfolgreich dafür eingesetzt werden, den Festakt einer demonstrativen Begegnung zwischen Führung und Massen als garantiert keimfreie Jubelveranstaltung ablaufen zu lassen? Der Bundespräsident sogar muß sich die Kritik gefallen lassen, er hätte zu sehr an seinem Redemanuskript gegen die rechten Ausländerfeinde geklebt, statt gegen die eigentlich Bösen, die linken Störer, „in die Offensive zu gehen“ (wieder der Bundeswehr-Historiker, Spezialist für deutschen Ausländerhaß, deswegen besonders befugt zur Gleichsetzung von Neo-Nazis mit Rest-Linken; er war an diesem großen Tag ziemlich flächendeckend im deutschen Fernsehen vorhanden). Liberale Journalisten fordern rückwirkend „demonstrationserprobte Gewerkschafter“ in den vorderen Reihen und merken gar nicht oder finden das ganz normal, daß sie das niedere Fußvolk der einen großen Tarifpartei als Jubeltruppe und Hilfspolizei der Staatsspitze in Anspruch nehmen. Gleichfalls von freiheitsliebenden Journalisten wird die Polizeiführung hochnotpeinlich befragt, der Hinweis auf die „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ als Ausflucht zerpflückt, bis der Polizeichef als liberaler Exot in der Runde die Anwälte der freien Öffentlichkeit zurückfragt, ob sie denn einen Vorbeimarsch nach altem DDR-Muster gewollt hätten?! Die einzig ehrliche Antwort wäre „Jawohl!“ gewesen. In diesem Sinne kritisiert dann im zweiten Durchgang das Parlament die Fernsehleute und die Presse sich selbst: Die Medien hätten den paar Störern überhaupt erst Wirkung verschafft – kleiner ZDF-Skandal am Rande: ein eindeutig Linksradikaler durfte 1 Minute lang klare deutsche Sätze gegen die Politiker und ihre Show live zum Besten geben; da hatten Engert und Wolffsohn anschließend einiges zu schimpfen! –, statt sofort auf die brave Kundgebungsmehrheit umzuschwenken und den Protest am besten totzuschweigen. Als wären sie darin nicht geübt! Die freie Öffentlichkeit läßt sich an ihrem Staatsauftrag messen; klagt sich selber an, die fürs bestellte Bild nötige Selbstzensur versäumt zu haben – und tut ihr Bestes, den Schaden wieder gutzumachen: Im Großen und Ganzen, teilt sie unisono mit, war die Demo doch ganz gelungen. Ein paar Störer dürfen den demokratischen Massenaufmarsch und seine erbauliche Wirkung nicht kaputtmachen, also können sie es letztlich auch nicht.
Mit anderen Worten: Reichlich totalitär besteht die deutsche Demokratie darauf, sich selber glanzvoll zu inszenieren, wenn ihre Führung das für nützlich hält. Wenn ihr danach ist, „die Meinungsfreiheit aus den Amtsstuben heraus auf die Straße zu tragen“, wie es der Bundespräsident treuherzig formuliert hat – der Mann weiß eben, wo die wahre Meinungsfreiheit wohnt! –, dann muß die Zustimmung klappen; nicht organisiert, das wäre ja Diktatur, sondern auf Abruf freiwillig, spontan gefälligst und ohne falschen Zwischenton.
Weshalb der „politischen Klasse“ – mit Ausnahme ihrer bayerischen Niederlassung – im Herbst 92 nach so etwas zumute war, sagt sie selber offenheraus: Es geht ihr um „Deutschlands Ansehen in der Welt“. Es gibt eben Leute, und um ihren Staat besorgte Demokraten gehören allemal dazu, denen fällt bei ausländerfeindlicher und erst recht antijüdischer Randale als erstes die Ehre der Nation ein; und auf die lassen sie nichts kommen.
Nun geht es den Rechtsradikalen um die deutsche Ehre zweifellos auch. Als Deutsche mit einer nationalen Ehre mögen sie die Gedenkstätten nicht, mit denen die BRD sich – hübsch symbolisch – von den „Perversionen“ ihres Vorgängerstaates distanziert; stattdessen mögen sie Heldenverehrung auf SS-Friedhöfen. Originell sind sie damit so wenig wie mit ihrem „Ausländer-Aufklatschen“. Daß für das neue Deutschland mit der Nachkriegszeit und der „Spaltung“ auch die Zeit des Sich-Schämens vorbei ist, das ist seit längerem anerkannte Mehrheitsmeinung. Nach dem Untergang der DDR ist die nationale Erkenntnis hinzugekommen, daß die SED-Kommunisten, an der demokratischen Elle gemessen, nicht besser als die Nazis waren – diese also auch nicht schlimmer als vieles auf dieser Welt – und ihr realsozialistischer Antifaschismus „von oben verordnet“, also verkehrt, am Ende ein besonders arglistiges Unterdrückungsinstrument. Daß er, weil „verordnet“, nichts wert war, soll sogar nach seriöser sozialpsychologischer Lehrmeinung den neuen Ausländer- und Judenhaß im Osten erklären – als bräuchte ein Deutscher schon eine besonders gediegene antifaschistische Erziehung, um sich mit der Anwesenheit von Juden auf deutschem Boden abzufinden; als wäre diejenige, die die Bundesrepublik ihrem Volk verabreicht hat, weniger „verordnet“ oder gar besser gewesen als die der DDR; und als wäre der „drüben“ vorgeschriebene Antifaschismus nicht erst durch die neue deutsche Nationalideologie in Mißkredit geraten, wonach die SED nichts auch nur halbwegs Gutes hinterlassen haben kann, nur Verbrechen und Unterdrückung. Mindestens das sehen die Neonazis im Osten genauso; und die gesamtdeutsche Rechte ist überhaupt vom gültigen deutschen Nationalbewußtsein nicht weit weg, wenn sie auch mit der moralischen Hinterlassenschaft des verlorenen Weltkriegs aufräumen will, nachdem eine entschlossene Staatsführung schon die anderen Kriegsergebnisse so weitgehend „in Ordnung“ gebracht hat.
Mit ihrer penetranten Art, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen, liegen die Rechtsradikalen freilich ganz daneben: Sie stören das Bild vom gebesserten Deutschland, das mit der ganzen Welt, vor allem mit seinen einstigen Feinden im Reinen und mit allen anständigen Staaten gut Freund ist. Und dieses Bild ist keineswegs überflüssig geworden, seit Deutschland mit seiner neuen Größe Politik macht, im Gegenteil. Zwar sind die Machtmittel dieser Nation alles andere als moralischer Art; es stimmt nicht einmal, daß die Härte der DM von auswärtigen Käufer- oder Investitionsentscheidungen abhinge, die von Sympathien fürs deutsche Volk gesteuert würden – ein gutgemeinter Einfall, mit dem Vertreter der deutschen Wirtschaft ihren Beitrag zur Bremsung der neuen Ausländerfeindlichkeit und zugleich, zwei Fliegen mit einer Klappe, zur Schuldfrage in Sachen Abschwung Ost geleistet haben wollen. Und wenn Deutschland mit seinen Nachbarn zur neuen Weltmacht Europa werden will, zu einer imperialen Union nach deutschen Bedingungen, dann sind für den Erfolg oder Mißerfolg dieser Politik handfeste Abhängigkeiten ausschlaggebend – Machtverhältnisse, die den unter nationalen Gesichtspunkten ewig widersprüchlichen Berechnungen der beteiligten Partner schließlich ein Ende machen. Gerade weil aber die Vorteilsrechnungen, nach denen andere Staaten mit Deutschland gemeinsame Sache machen, immer zweischneidig sind und im Fall der europäischen Union ganz besonders widersprüchlich ausfallen, ist für die deutsche Welt- und namentlich Europapolitik Deutschlands guter Ruf eine wichtige Größe. Denn überall werden Ansprüche an und Bedenken gegen andere Nationen an nationalistischen Sympathiegesichtspunkten entlang artikuliert und politisch ausgetragen – der britischen Öffentlichkeit wäre ja kaum ein schlagender Einwand gegen die Währungsunion nach Frankfurter Modell eingefallen, wenn sie nicht an Hitler hätte erinnern können. Und wenn unentschiedene Regierungen den immer prekären Beschluß, sich unwiderruflich mit ihrer europäischen Führungsmacht zusammenzutun, am Ende vom innenpolitischen Meinungsstreit abhängig machen, dann entfalten womöglich Imageprobleme eine politische Wirkung, statt daß der politische Einfluß wie von selbst auch das Image zurechtrückt. Deswegen treten deutsche Politiker auch recht fordernd auf, nicht bloß in Währungs-, Handels-, Militär- und ähnlichen Fragen, sondern auch, was das Bild betrifft, das das Ausland sich von Europas Mitte macht; offensiv verbittet man sich unpassende Erinnerungen an die Ära der Hakenkreuze und Lederstiefel, die bei den Nachbarn noch immer für Ressentiments gut ist. Um so unpassender, wenn ein guter Teil der eigenen Jugend diesem nicht totzukriegenden Feindbild vom faschistischen Deutschen Material liefert. Die Staatsführung höchstpersönlich sieht sich da herausgefordert, schlechte Meinungen über Deutschland zurückzuweisen; klarzustellen, daß niemand das Recht hat, an Deutschlands Lauterkeit zu zweifeln; sich demütigende Vorbehalte gegen die Nation und feindselige Erinnerungen an den Judenmord – bloß wegen „ein paar Unverbesserlichen“… – weltöffentlich zu verbitten. Denn so ist es ja nicht, daß die offizielle Imagepflege etwas mit kleinlautem Auftreten zu tun hätte oder gar mit dem moralischen Gefühl der Scham: Wenn der Bundeskanzler öffentlich „Schande“ empfindet, dann nimmt er seine Richtlinienkompetenz in Anspruch und Deutschlands Ehre gegen jede Demütigung durch auswärtige Vorwürfe in Schutz und stellt klar, daß man den Deutschen so nicht mehr kommen kann.
Natürlich gibt es Patrioten, die an dieser Vorwärtsverteidigung der nationalen Ehre immer noch ein Moment von Entschuldigung und Defensive entdecken, das sie für unwürdig halten. Die Rede ist diesmal nicht von den Skinheads, obwohl die das auch so sehen, sondern vom bayerischen Ministerpräsidenten und seiner CSU, die am Demonstrationsaufruf der nationalen Prominenz die Tatkraft vermißt haben. Ganz kann es ihnen nicht entgangen sein, daß es in Berlin ausnahmsweise mal nicht ums „Handeln“, sondern ums Erscheinungsbild gehen sollte. Wenn es ihnen wie eine Verleugnung der eigenen Macht vorkam, dafür eine machtvolle Kundgebung durchzuziehen, dann werden sie also wohl auch gemeint haben, ihnen würde dort zugemutet, irgendwie bei der Weltöffentlichkeit Abbitte zu leisten.
Da sind die anderen demokratischen Parteien nun allerdings schon weiter. Sie haben ihr Volk als Mittel entdeckt, um ganz ohne falsche Bescheidenheit nationale Botschaften in die Welt zu setzen; und dabei bleibt es auch nach und trotz der „terroristischen“ Störung. Die hat, richtig eingeordnet, sogar noch einen Dienst geleistet: Von der durchaus unterschiedlichen Meinung der angeblich 300.000 Demonstrationsteilnehmer über die säuberliche Scheidung zwischen Artikel 1 und Artikel 16 des Grundgesetzes war hinterher gar nicht mehr die Rede; die „übergroße Mehrheit“ wurde von den Veranstaltern gegen die „Handvoll Störer“ in Schutz und damit total für den von oben vorgegebenen Kundgebungszweck in Anspruch genommen: Schulterschluß mit der Staatsmacht – wie in den guten alten Zeiten des kalten Kriegs, als die Insassen der Freiheitsinsel Berlin/West sich in Großkundgebungen um ihren Regierenden Bürgermeister scharten; das war das erklärte Vorbild. Als wären die alten Notzeiten wiedergekommen, soll das deutsche Volk, und zwar das ganze wiedervereinigte, es nicht mehr mit Arbeiten und Wählen-Gehen genug sein lassen, sondern sich, wenn es bestellt wird, freiwillig und brav vor und mit seiner Führung aufstellen, für die nationale Sache. Und das nicht nur, wie jetzt, aus Anlaß einer Gefahr für Deutschlands Ruf in der Welt, sondern nach Bedarf; das haben die Veranstalter versprochen.
Solche Einsatzbereitschaft läßt ein nationaler Führungsstab demonstrieren, wenn er vorhat, sie noch ganz anders auszunutzen als für eine öffentliche Show.
Zur Sache: Grund und Zweck einer betont demokratischen Notstandspolitik
Deutschland hat sich viel vorgenommen; aber mit dem festen Vorsatz ist das Vorhaben noch nicht gelungen. Die Regierung reklamiert weltweit „gestiegene Verantwortung“; doch das, was mit diesem schönfärberischen Etikett umschrieben wird: mehr anerkannter und respektierter deutscher Einfluß in der Welt, auch in Gewaltfragen und mit adäquaten Gewaltmitteln ausgeübt, das will erst noch errungen sein. Die „europäische Union“ soll zustande kommen, eine Weltmacht zu deutschen Bedingungen; doch es wird zunehmend unabsehbar, ob und wie die Nachbarn unter die Ambitionen der politisch aufstrebenden „Mitte Europas“ zu versammeln sind. Diese „Mitte“ ist zudem selbst noch nicht, was sie hätte werden sollen, nämlich ein um die beträchtlichen Potenzen der ehemaligen sozialistischen DDR verstärkter kapitalistischer „Exportweltmeister“; eine Wirtschafts-Weltmacht, um die der Rest der EG sich wie von selbst herumgruppiert und die sich nur noch mit den Allergrößten messen muß: Ökonomisch entwickelt sich die Angliederung der neuen Ostzone fürs erste zum unabsehbaren Schulden- und Schadensfall. Und das alles mitten in eine langwierige Weltwirtschaftskrise hinein, die andere Staaten zwar früher geschädigt hat, die aber längst auch auf die DM-Ökonomie durchschlägt.[1]
Das alles zusammen ist Grund genug für die Regierung, den Standpunkt des Notstands in die deutsche Politik einzuführen. Zum Anlaß dafür nimmt sie Drangsale der Nation, die für die Sache der Nation und die Gefahr, daß sie scheitert, wirklich nicht unbedingt entscheidend sind; das immer gigantischer aufgemachte „Asylantenproblem“ vor allem mitsamt seinen mittlerweile erreichten Fortsetzungen. Diese Problemlagen werden nicht „pragmatisch“ „entschärft“, sondern unter einem prinzipiellen, gewissermaßen methodischen Gesichtspunkt zugespitzt; auf die Frage nämlich, ob die Staatsmacht überhaupt noch Herr der Lage ist. Um diese Sorge geltend zu machen, muß die von den Verantwortlichen empfundene Not für sich genommen gar nicht gravierend sein; die Logik der Zuspitzung funktioniert sehr gut auch über die Sorge: was denn aus Deutschland werden soll, wenn die Staatsmacht noch nicht einmal mit einem so kleinen Problem – wie z.B. dem Abschieben von Zigeunern oder der vorbeugenden Verhaftung von ein paar Rechts- und Linksradikalen oder einem beschleunigten Planfeststellungsverfahren für ein Autobahnbauvorhaben: unter diesem Gesichtspunkt alles ein- und dasselbe – im Handumdrehen fertig wird. Bemerkenswert ist da weniger der Stoff, an dem, als vielmehr der regierungsamtliche Anspruch, der an diesem Stoff aufgemacht und in den Rang einer unabweisbaren Selbstverständlichkeit erhoben wird. Dieser Anspruch geht auf unmittelbaren und ungeschmälerten Erfolg jeder staatlichen Willenserklärung, so als wäre jede Verzögerung und Relativierung, ja überhaupt schon der Unterschied zwischen Absicht und Ergebnis gleichbedeutend mit Ohnmacht.
Für diese Anspruchshaltung wird mit allen demokratischen Mitteln der nationale Konsens hergestellt. Vor allem die parlamentarische Opposition wird herangezogen; nicht um auf einem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ einen „unbefriedigenden Kompromiß“ zuzugestehen, sondern um mit verfassungsändernder Mehrheit den Standpunkt der nationalen Zuspitzung und Scharfmacherei zu billigen und mitzutragen; und wenn das erreicht ist, dann soll nicht etwa die Opposition am Erreichten herumkritisieren, sondern die Regierung Unzufriedenheit deutlich machen, weil ihr immer noch „die Hände gebunden“ wären. So wird das Parlament an einem Maßstab gemessen und auf einen Anspruch festgelegt, den zu anderen Zeiten die Faschisten mit der Abschaffung des Parlamentarismus durchgesetzt haben: Einheitsfront für die totale Durchschlagskraft nationaler Anliegen zu sein. Die Sozialdemokratie trägt das alles mit, indem sie genau diesen Anträgen der Koalition die heute gültigen Kriterien für ihr seit jeher oberstes Ziel entnimmt, das in seiner methodischen Abstraktheit die Sache gut kennzeichnet, um die es geht: „Regierungsfähigkeit“ pur! Das wahlberechtigte Volk, das die Faschisten einst gewaltsam „gleichgeschaltet“ haben, wird in die Ausformung dieser Anspruchshaltung der Staatsmacht demokratisch einbezogen; zuerst und vor allem durch die entsprechende Meinungsbildung am Thema Asyl. Sogar der Protest gegen den neu aufgeweckten militanten Rechtsextremismus wird gleich vereinnahmt: für einen Schulterschluß für das staatliche Gewaltmonopol, demonstriert auf einer Kundgebung, die explizit an den Maßstäben eines Vorbeimarschs gemessen wird.
Das ist der Rechtsruck in Deutschland. Oder besser gesagt das, was als Rechtsruck der Nation immer noch eine beschönigende Umschreibung erfährt. Es ist nämlich gar nicht der Witz, daß die demokratische Politik in einem breiten Spektrum linker und rechter Standpunkte ein wenig die Mitte verfehlt. Die Staatsgewalt verpflichtet die Nation in einer Weise auf sich, die für Standpunkte der ehemals linken Art, Forderungen nach einem volksnützlichen Gebrauch der Gewalt oder, als angebliche Garantie dafür, nach ehrlichem Respekt vor demokratischen Verfahrensidealen, einfach keinen Raum läßt. Sie entwickelt Bedürfnisse, die der Faschismus gegen die demokratische Herrschaftsart befriedigt hat; und die Führer der Nation, die regierenden wie die loyal mitmachenden, erlegen sich die Bewährungsprobe auf, mit ihren Mitteln und Methoden, demokratisch, diese Bedürfnisse zu befriedigen und so jeden neuen Faschismus glatt überflüssig zu machen.
Natürlich wird dadurch weder die Annexion der DDR zum Bombenerfolg für die D-Mark noch die Bundeswehr zur weltweit gefragten und siegreich agierenden Eingreiftruppe noch ein Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Bonner Regierung frei. Aber das Mittel, das die Staatsmacht zur Bewältigung aller Notlagen aufzubieten hat: sie selbst, wird auf diese Weise geschärft. Und darauf: auf die Entfesselung ihrer Macht, kommt es der Republikleitung an.
Ein „Solidarpakt“ für die Staatskasse
Die Nation hat ein Problem mit ihren Kassen. Und ob sie es dadurch löst oder nicht: Ihre Führung versteht es, ihr Problem zu dem ihrer Bürger zu machen.
- Da ist die letzte Steuererhöhung noch nicht in Kraft – ab 1993 ist alles 1 % mehr wert –, und schon ist die nächste Steuererhöhung beschlossene Sache. „Der Bundestag hat beschlossen… angekündigt wurde…“, nach diesem Muster sind die täglichen Meldungen gestrickt. Die „Stunde der Wahrheit“, von der Opposition seit den Zeiten des nationalen Jubels über die deutsche Einheit gefordert, wird von der Regierung wahrgemacht. Kaum ist es raus, daß ab 1995 ein paar weitere Prozentpunkte aus den privaten Geldbeuteln in die Staatskasse fließen, meldet die deutsche Öffentlichkeit Einspruch an. „Bild-Zeitung“ und „Süddeutsche Zeitung“ werfen am selben Tag die Frage auf: Warum erst 1995? Die Politiker kriegen den Vorwurf zu hören, daß sie aus kleinlichen parteipolitischen Berechnungen die Notwendigkeiten des Staates sträflich vernachlässigen: Wo der Staat das Geld heute schon braucht und ein einsichtiges Volk nicht mit einer „Lücken-Lüge“(Frankfurter Allgemeine) von Neuem betrogen sein will. Das sind so Sachen, die einem zu denken geben: Der Fanatismus der Staatsmoral, der nichts gelten läßt als die Notwendigkeiten des Staates, überholt den Staat, der seine Notwendigkeiten praktiziert und dabei nur auf seine Berechnungen Rücksicht nimmt. Daß die nicht wahltaktischer Natur, sondern von der ernsten Sorge getragen sind, die faux frais, die der Staat beansprucht, könnten den Reichtum der Nation überstrapazieren, aus dem er sich bedient, steht zwar auch in der Zeitung, wird aber nicht gelten gelassen, weil die Staatsaufgaben, die den Reichtum der Gesellschaft beanspruchen, absolut gesetzt werden.
- Die Beiträge zu den Sozialkassen werden um das eine und andere Prozent erhöht und außerdem umgeschichtet mit der Perspektive, daß für die Zukunft längst geplante Erhöhungen um so stärker ausfallen. Die Leistungen des Sozialstaats werden um ein paar Prozent gekürzt. Das betrifft Zahlungen im Krankheitsfall, den Sozialhilfesatz überhaupt und dann noch einmal den für Asylanten im besonderen, das BAFöG etc. Man muß ja nicht nostalgisch werden, wenn man bemerkt, wie dieser Staat mit seinem sozialen Netz umgeht. Die Opfer der Ökonomie, die er einrichtet, zu betreuen; dabei den Gesichtspunkt der Funktionalität einer Arbeiterklasse walten zu lassen, die durch die kapitalistische Benutzung dieser Klasse ständig gefährdet ist; dafür aus dem Lohn Zwangsbeiträge in die Sozialkassen fließen zu lassen – das ist so menschenfreundlich auch wieder nicht. Ebensowenig das Prinzip, nach dem er seit geraumer Zeit mit seinen Sozialkassen verfährt: Der Sozialstaat muß gerettet werden, durch drastische Einsparungen an ihm. Bemerkenswert ist es dennoch, wenn dann eines Tages im Jahre 1992 in der „Süddeutschen Zeitung“ die Schlagzeile zu lesen ist: „Kürzungen im Sozialbereich sollen Etat-Loch stopfen“. Dann haben nämlich die Sozialkassen höchst offiziell eine neue Zweckbestimmung erhalten. Vom Sozialstaat bleiben dann nur die Kassen, für die der Staat vermehrt Beiträge einsammelt, die er ihrer sozialstaatlichen Funktion entkleidet und zur Bewältigung seiner Finanzprobleme einsetzt. Der deutsche Staat stellt damit seinen Gesichtspunkt der Rücksichtnahme auf seine arbeitende Klasse unter harte Bedingungen.
- Daß es sich bei alledem um Abzüge vom Lohn handelt, von dem die Leute irgendwie leben müssen, ist kein Geheimnis. Es ist nur nicht der Rede wert in einer Nation, die beschlossen hat, ihre wachsenden faux frais aus dem Lohn zu bestreiten. Es gilt daher überhaupt nicht als Schande, daß auch die Lohnhöhe selbst in den Dienst der nationalen Sache gestellt wird. Sie darf nämlich erstens deswegen nicht steigen, weil die Regierung längst jeden erhofften Zuwachs an deutschem Bruttosozialprodukt für den „Transfer in die neuen Bundesländer“ verplant hat – genauer gesagt für ihren Haushalt, der gleich aus zwei Gründen enorm anschwillt: weil die Einführung kapitalistischer Verhältnisse ein teurer Spaß ist, und weil sie außerdem nicht wunschgemäß klappt und deswegen noch viel teurer wird. Und zweitens ist der in der Nation gezahlte Lohn schon in seiner bisherigen Höhe ein einziges Problem, weil das Bruttosozialprodukt absehbarerweise gar nicht mehr wächst, obwohl über etliche Prozent Zuwachs längst verfügt ist. Nun läßt zwar ein nationaler Lohnverzicht noch lange nicht das Bruttosozialprodukt wieder kräftiger sprudeln, allenfalls die Unternehmensgewinne steigen – wenn „die Märkte“ es hergeben, was sie aber zur Zeit gar nicht tun… –; und steigende Gewinne werden keineswegs für den „Aufbau Ost“ konfisziert, beseitigen also gar keine „Lücke“ im Staatshaushalt, so wie die Milchmädchenrechnung mit dem nach Osten verschobenen Zuwachs es darstellt. Was aber felsenfest feststeht, ist das kapitalistische Standardrezept für jede Lebenslage, daß niedrigere Löhne für „die Wirtschaft“ besser sind als höhere; und weil vom Wohlbefinden „der Wirtschaft“ alles abhängt, insbesondere was der Staat sich leisten kann, sind Lohnsenkungen nicht bloß Arbeitgeberforderung, sondern nationales Programm – erstens im Prinzip immer, zweitens erst recht, wenn der Staat besonders viel nationalen Überschuß für seine Wachstumsprogramme verbraucht, drittens ganz speziell bei „abwärts gerichteter Stagnation“ (so die „5 Weisen“ über die gegenwärtige Wirtschaftslage der Nation). Die wird zwar auch nicht wieder aufgerichtet, wenn mit dem Sparen bei den Leuten ernstgemacht wird, die jetzt schon zu wenig Autos kaufen und deswegen wahrscheinlich gerechterweise von der nachlassenden Konjunktur auf die Straße gesetzt werden. Aber um ein Konjunkturrezept in dem Sinn, um einen sicheren Weg zum nächsten Boom, geht es sowieso nicht, wenn die Nation sich Lohnsenkungen verordnet. Die passieren in so einer Lage sowieso, weil die Zahl der Lohnempfänger von den Unternehmern in Eigeninitiative produktiv gesenkt und bei den verbleibenden Mitarbeitern das Verhältnis von Lohn und Leistung „verbessert“ wird, an beiden Enden des Verhältnisses. Immerhin, soweit das Maß der „Verbesserung“ ein öffentlich ausgetragener Streitfall ist, tut es seine Wirkung, wenn die Nation Lohnsenkungen zur vaterländischen Pflicht erklärt – zumindest bei den Löhnen; was aus der Konjunktur wird, das wird man sehen.
- Speziell für die neuen Bundesländer soll es unbedingt „nominelle Lohnkürzungen“ geben. Die heißen nicht deswegen so, weil sie bloß nominell wären, sondern weil sie die Lohnsumme betreffen, die selber bloß „nominell“ ist, weil sie „reell“ dauernd entwertet und geschmälert wird, durch steigende Preise und höhere Abgaben an die verschiedenen Staatskassen. Die Osttarife also, die sowieso um 40 Prozent unter den maßgeblichen Tarifabschlüssen der Gewerkschaften liegen, sollen entweder freiwillig oder per „Öffnungsklausel“ in einem Gesetz nach unten korrigiert werden, weil die Nation ihren Aufschwung nicht hinkriegt und dafür den Lohn haftbar macht. Die „explodierenden Lohnkosten“, die die Wirtschaftsprüfer der Nation drüben in der Zone entdeckt haben wollen, beziehen sich schließlich nicht auf steigende Löhne, sondern auf den Umstand, daß das Geschäft auch mit dem staatlich eingerichteten Niedriglohnniveau nicht läuft und deswegen jeder Lohn, der gezahlt wird, zu hoch ist. Daß die Löhne nicht die Ursache für die ausbleibenden Geschäfte im Osten der Republik sind, ändert nichts daran, daß sie deswegen gesenkt werden. Die deutsche Nation will mit ihrem Angriff auf den Lohn ein Geschäftsleben drüben erzwingen – mitten in der „Rezession“, die inzwischen zugegebenermaßen „vor der Tür steht“.
Der Befund aus dieser Liste läßt sich auch denkbar schlicht zusammenfassen. Man kann die Prozente nämlich zusammenzählen, um die der Lohn in den verschiedenen Abteilungen gekürzt wird. 20 bis 30 Prozent werden es schon sein, die die Nation und ihre ehrgeizigen Vorhaben in Zukunft jeden mehr kosten. Es ist nämlich gar nicht so, daß die Regierung mit dieser Liste Forderungen aufgestellt hätte, die sie einer Gegenseite präsentiert, und dann geschaut würde, was sich gegen die durchsetzen läßt. Die Anspruchshaltung der Regierung ist etwas weitergehend. Die Mannschaft um Kohl fordert „alle Deutschen, Bund, Länder, Gemeinden, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kirchen sowie alle Gruppen der Gesellschaft“ zu einem „Solidarpakt“ auf, der dem Zweck dient, die bereits feststehenden Ansprüche der Nation – „Einsparungen in einer Größenordnung, wie wir sie im Westen nicht mehr gewöhnt sind, werden dabei unausweichlich“ (Schäuble) – in einer gemeinsamen „äußersten Kraftanstrengung, zu der alle Beteiligten – vom Staat über die Sozialpartner bis zum Steuerzahler – aufgerufen sind“ (Frankfurter Allgemeine), zu realisieren. Die Gewerkschaften sehen sich da zurecht angesprochen. Schließlich geht es, auch wenn Gott und die Welt als „Ansprechpartner“ aufgeführt werden, um nichts als die Lohnfrage und deswegen vor allem um den Anspruch von oben an die Gewerkschaft, sie möge sich dafür einspannen lassen, gemeinsam mit der Regierung deren Angriff auf den Lohn gegen ihre eigene Basis durchzusetzen. Die Demokratie wird hier sehr übersichtlich: Sie stellt klar, daß sie Gewerkschaften zuläßt, weil und sofern sie als Instrument zur Sicherung des inneren Friedens nützlich sind, den die Nation mit ihrem unbedingten Willen zu kapitalistischem Erfolg fortlaufend aufkündigt. Der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik erklärt den Klassenkampf von oben, wenn er anläßlich der Forderung nach einer Öffnungsklausel den Gewerkschaften folgendes zu bedenken gibt:
„Meine Besorgnis ist, daß die Tarifparteien auf dieses Signal nur schwerfällig reagieren und letztlich ihre Ordnungsfunktion verloren gehen könnte.“
Der Wirtschaftsminister geht dann noch etwas weiter und erläutert das Szenario des anvisierten Solidarpakts, um den Gewerkschaften zu verdeutlichen, wie ernst er seine Sorge meint:
„Der Kernbeitrag des Staates zum Solidarpakt ist die Wiederherstellung solider Staatsfinanzen… Hauptbeitrag der Gewerkschaften und Arbeitgeber zum Solidarpakt muß ein Einschwenken in der Lohnpolitik West und ein Umschwenken in der Lohnpolitik Ost sein… Allerdings muß den Gewerkschaften klar sein, daß sie den Staat letztlich zu gesetzlichen Beschränkungen der Tarifautonomie zwingen würden, wenn sie sich einem Pakt lohnpolitischer Vernunft in einer Zeit verweigern, in der der Standort Deutschland auf dem Spiel steht.“
Für die Durchsetzung der klaren Arbeitsteilung, die der Solidarpakt meint – der Staat bestimmt, auf was die Arbeiterklasse zu verzichten hat –, kann sich Möllemann durchaus Alternativen vorstellen. Für den Fall, daß sich die Gewerkschaften für die Durchsetzung des staatlichen Angriffs auf den Lohn nicht hergeben, kündigt er Schritte gegen sie an. Das ist doch mal ein kompetenter Beitrag zum „Systemvergleich“ zwischen Liberalismus und faschistischer Gleichschaltungspolitik.
Zum Glück für Demokratie und sozialen Frieden ist es aber gar nicht so, daß die Regierung mit ihrem unverschämten Anspruch an die Gewerkschaft bei der nun auf entschlossenen oder auch nur irgendeinen Widerstand stößt. Die Stellungnahme des DGB und des Chefs der – vergleichsweise „radikalen“ – IG Metall Steinkühler zum Regierungsvorhaben lautet: Nicht gegen, sondern mit uns. Mit ihrem Solidarpakt stößt die Regierung bei einer Gewerkschaft auf offene Ohren, der es schon bislang geläufig gewesen ist, das Lohninteresse ihrer Mitglieder dem Erfolg des nationalen Interesses unterzuordnen. Und dem es deswegen nun, da dieser Erfolg in Frage steht, auch an vorderster Front mit einleuchtet, daß der nationale Notstand jeden Eingriff in den Lohn gebietet. Was diese nationalistische Arbeitervertretung an dem von der Regierung betriebenen Solidarpakt einzig stört, ist nicht die Sache. Sie hat vielmehr ein Problem damit, daß durch das Vorgehen der Regierung ihr höchster Wert ramponiert wurde. Ihr wurde bei der Beschlußfassung die Anerkennung als mitbestimmende Kraft versagt. Unter ihrer Mitbestimmung beschlossen, wäre ein Solidarpakt viel solidarischer gewesen. Seither bringt sich die Gewerkschaft bei jeder zusätzlichen Steuer, die die Regierung beschließt, mit der Warnung ein: „Solidarpakt gefährdet!“ Sie beharrt allen Ernstes gegenüber einer Regierung, die sie für den Pakt einspannen will, darauf, daß ohne ihre Mitbestimmung in Sachen Lohnsenkung nichts geht. Mit ihrer Mitbestimmung also alles. Mancher Politiker sieht denn auch die abweisenden Töne, die in ihrem Mitbestimmungsanpruch beleidigte Gewerkschafter derzeit spucken, eher realistisch. Blüm bescheinigt Steinkühler ausdrücklich „gesamtstaatliches Verantwortungsbewußtsein“. Er weiß, daß der Einspruch der Gewerkschaften nicht grundsätzlich gemeint ist, weil es in der Sache keinen Gegensatz gibt:
„Das wird sich zeigen, wenn man mal den Pulverdampf des öffentlichen Streits wegläßt. Macht den Gewerkschaften den Weg zum Solidarpakt nicht zu schwer.“
Er wird schon Recht haben bei einer Arbeitnehmervertretung, die über sich zu der Auffassung gelangt ist:
„Die regulierenden und bindenden Kompetenzen der Gewerkschaften werden derzeit in einem Maße gebraucht wie kaum in der 40jährigen Geschichte der Bundesrepublik“;
die auf ihrem Kongreß eine Entschließung verabschiedet hat,
„nach der eine Beteiligung auch der Arbeitnehmer an der solidarischen Finanzierung der Deutschen Einheit ausdrücklich befürwortet wird“;
und die sich auch vorstellen kann,
„Ersparnisse von Arbeitnehmern für die Finanzierung der Einheit (zu) mobilisieren.“ (Handelsblatt)
Angesichts solcher Angebote wären staatsautoritäre „Lösungen“, wie der Liberale Möllemann sie als letzte Möglichkeit in die Diskussion einbringt, gar nicht von Vorteil. So, wie der DGB heute beieinander ist, ist das, was der Staat von seinen Lohnarbeitern will, unter dessen Mitwirkung zu erreichen, also bequemer und effektiver.
Mit ihrer anderen Klasse, dem Eigentum und seinen Repräsentanten, hat die deutsche Staatsmacht es nicht so einfach. Die sollen nämlich mehr Geld verdienen und tun es nicht nach Wunsch. Vor allem gehen sie nicht in der national erwünschten Weise in die Ostzone der Bundesrepublik, um dort ihr Geld zu mehren, obwohl der Staat alles dafür tut. Das finden die Führer der Republik einigermaßen unverständlich. Ihre Angelegenheit ist es ja auch nicht, den Unterschied zu begreifen zwischen der Einrichtung eines kapitalistenfreundlich niedrigen Lohnniveaus und der Gretchenfrage der Kapitalisten, ob ein Geschäft in der Zone in Sicht ist, für das es sich lohnt, überhaupt einen Lohn zu bezahlen. Die Aufgabe, zu der sich Politiker berufen sehen, ist vielmehr, mit der Macht, über die sie verfügen, dafür zu sorgen, daß „die Wirtschaft“ die Leistung erbringt, die die Nation von ihr erwartet. Sie treiben daher Wirtschaftspolitik. Aus deren Sicht kritisieren sie heute, daß die Unternehmer im Osten des Landes nicht investieren, obwohl die Nation ihr hinzugewonnenes Territorium und die darauf ansässige Mannschaft für gar nichts anderes vorgesehen hat als für die Erweiterung des nationalen Geschäftslebens. So manchem demokratischen Politiker kommt da der Einfall, den Kalkulationen der Unternehmer auch durch ein bißchen Zwang auf die Sprünge zu helfen: Wer drüben nicht investiert, der soll dafür bezahlen, mit einer „Investitionsabgabe“ oder „Zwangsanleihe“. So ganz die liberale Tour, den Dienst der Wirtschaft an der Nation zu fördern, ist das nicht. Die sieht gewöhnlich vor, daß der Staat für die Geschäftsbedingungen sorgt, die „die Wirtschaft“ ausnutzt; und zwar nach ihren Kalkulationen. Das ist dann auch der gemeinte Dienst der Kapitalisten an der Nation. Sie vermehren ihren Reichtum, an dem die Nation partizipiert. Mit der Einführung einer Investitionspflicht für Unternehmer, deren Nichterfüllung Zwangsabgaben nach sich zieht, würde der Staat den nationalen Dienst der Wirtschaft gegen deren Kalkulationen erzwingen. Und das ist ein Widerspruch, den sich Deutschlands demokratische Politiker nicht leisten mögen. Überhaupt nicht deswegen, weil es undemokratisch wäre und ein wenig an die Kriegswirtschaft der Nazis erinnern würde; und auch nicht deswegen, weil es nicht ginge, Kapitalisten zum Investieren zu zwingen, wenn sich das Investieren für sie nicht lohnt. Sondern deswegen, weil sie vom Nutzen dieser Maßnahme für die Nation nicht überzeugt sind. Politiker, die das Argument beherrschen, daß Steuererhöhungen die Konjunktur des nationalen Geschäftslebens gefährden, das der Nation den Reichtum einspielt, auf den sie scharf ist; die deswegen Belastungen des produktiven Kapitals unbedingt vermeiden wollen und ihre Steuererhöhungen sozial gerecht aus den privaten Geldbeuteln bestreiten – die kennen auch den Haken einer solchen Zwangsabgabe: Sie geht gegen das Kriterium des lohnenden Geschäfts und stellt den nationalen Dienst der Wirtschaft in Frage, den sie bezweckt. Mit Gewalt ist zwar viel fürs Geschäft zu machen, aber nicht so einfach das Geschäft; und daß die Staatsmacht diesen Unterschied zu respektieren hat, das haben Deutschlands demokratische Führer schon seit längerem geradezu zur nationalen Systemfrage gemacht. Die bedingungslose Freisetzung des kapitalistischen Geschäfts halten sie jedenfalls für ihr bundesdeutsches Erfolgsrezept. Von dem lassen sie nicht ab, bloß – oder ausgerechnet da – wo es in eine Krise gerät. Viel eher beschuldigen sie sich, zu wenig „Handlungsfähigkeit“ im Sinne dieses deutschen Erfolgswegs an den Tag gelegt zu haben – nämlich gegen die Löhne und die leidigen „Lohnersatzleistungen“ und die „überflüssigen“ Sozialausgaben und die Subventionen, die dem Erfolg auf der Tasche liegen.
So kriegt das nationale Notstandsbewußtsein wenigstens eine klare Linie.
Die „soziale Frage“ heute: Von Nationalisten gestellt, nationalistisch zurückgewiesen
Mit den Erfolgen ihrer Wirtschaftspolitik ist nicht nur die politische Führung unzufrieden. Die Betroffenen sind auch nicht gut darauf zu sprechen. Von Widerstand dagegen ist zwar weit und breit nichts zu sehen; die Gewerkschaften sind damit befaßt, ihr Fußvolk bei der Stange zu halten. Artikuliert und politisch definiert wird die schlechte Stimmung im Volk aber durchaus – ein wenig außerhalb des gewohnten „demokratischen Konsens“ und immerhin so, daß die etablierten demokratischen Parteien sich gewisse Sorgen darum machen, ob sie nach den nächsten Bundestagswahlen noch so bequem unter sich sind wie gewohnt. Denn eine Opposition, die sich für ihr Bild der Lage auf die zunehmend miesen materiellen Verhältnisse im Osten wie im Westen des einig Vaterlands beruft, kommt, ausgerechnet, von rechts.
Interessanterweise findet die demokratische Öffentlichkeit, bis hin zu den sozial engagierten gewerkschaftlichen Sittenwächtern der deutschen Demokratie, einen „Zusammenhang“ zwischen materieller Unzufriedenheit und Rechtsradikalismus völlig normal. Die Gewerkschaft hat es schon immer so gesehen und gesagt und davor gewarnt, daß Armut und Arbeitslosigkeit der politischen Rechten nützen; in Bezug auf die deutsche Ostzone ist der „Rückschluß“ von rechtsextremer Randale auf „soziale Ursachen“ längst zum Gemeinplatz geworden; Slumgebiete werden umgekehrt von vornherein als „Nährboden für Rechtsextremismus“ und rechte Wahlerfolge eingestuft. Und dem braven Bürger, auch im Westen, der seine Wahlstimme nie an eine „radikale Partei“ verschwendet hat, fallen heutzutage zu jedem materiellen Ärgernis „die Republikaner“ als mögliche Lösung ein.
Das ist inzwischen also normal. Aber warum? Denn schlüssig in dem Sinn ist das ja nicht. Der Fernsehreporter, der Berliner Jugendliche ins Mikrophon sagen läßt, sie hätten „genug eigene Probleme“ und „bräuchten“ nicht auch noch das „Problem“ der Asylanten, müßte ja nur nachfragen, welches Problem diese flotte Jugend denn bedrängt und, wenn es denn schon Geldmangel, Wohnungsnot oder Arbeitslosigkeit ist, wer ihnen das wirklich beschert – ein sachlicher Zusammenhang zu den Elendsflüchtlingen wäre schlechterdings nicht herzustellen. Doch solche banalen Nachfragen stellt die kritische Öffentlichkeit nicht. Beleidigter Nationalismus als Antwort auf alle Lebensprobleme: das leuchtet ihr „irgendwie“ bedingungslos ein, genauso wie den Rechtsradikalen selbst. Entsprechend unklar bleibt, was da eigentlich so einleuchtet.
Theoretisch gesehen ist es nämlich immerhin ein Fehlschluß und in praktischer Hinsicht ein hoffnungsloser Mißgriff, schlechtes Abschneiden in der „Marktwirtschaft“ – und das ist nun einmal der schlichte Inhalt aller „sozialen Problemlagen“ – auf die eigene Nationalität zu beziehen, so als enthielte die Staatsbürgerschaft ein Versprechen auf erträgliche Lebensbedingungen, womöglich sogar auf Erfolg. Notlagen entspringen noch allemal dem Gegensatz zwischen Geld-Haben und Nicht-Haben, zwischen Arbeiten-Lassen und Für-Lohn-Arbeiten – was die Alternative, ohne Arbeit zu verelenden, immer einschließt –, zwischen Preise-Machen und Zahlen-Müssen – was Nicht-Zahlen-Können einschließt –, zwischen Grundbesitz und Miete-Zahlen usw.; also den ökonomischen Verhältnissen, die der „eigene“ Staat, die politische Macht der „eigenen“ Nation, einrichtet und mit aller Gewalt in Schwung hält. Eben diese Nation ist, wenn es schon um Not und Lebenschancen gehen soll, kein gemeinnütziger Verein, sondern eine Klassengesellschaft, eine immerwährende Konkurrenz zwischen Leuten, die jede Menge Mittel haben, und sehr viel mehr anderen, die selber bestenfalls benutztes Mittel sind, nämlich sofern sie das interessante Glück haben, für den Reichtum der anderen gebraucht zu werden. Der „eigene“ Staat mit seiner Gewalt ist dafür unerläßlich, das ist wahr: Nützlich ist er gerade darin, daß er seinen Insassen diese Konkurrenz als ihr Überlebensmittel, also einen „Lebenskampf“ mit Gewinnern und vielen Verlierern aufnötigt; Gegensätze, die ohne totale Rechtssicherheit keinen Moment Bestand hätten. Die Art des Nutzens staatlicher Gewalt steht damit ebenso fest wie, wer ihn hat.
Die unbemittelten Dienstkräfte dieses Systems, seine Lohnarbeiter, haben das auch einmal so gesehen; und sie waren teilweise geneigt, sich gegen den Staat zu stellen, der für lauter ökonomische Sachzwänge zu ihrem Schaden sorgt, und gegen den Nationalismus, der das Recht auf Zugehörigkeit zu diesem Staat über dessen sozialen Inhalt stellt. Da war die „soziale Frage“ eine Sache der staatsfeindlichen Linken. Die politischen Parteien der Arbeiterbewegung haben sich dann allerdings am Gegensatz zwischen den Opfern des ökonomischen Systems und der Staatsmacht, die es in Kraft setzt und hält, zunehmend staatstreu zu schaffen gemacht. Sie haben Mindestforderungen fürs Überleben der abhängig arbeitenden Klasse aufgestellt, an deren Erfüllung doch auch dem härtesten Klassenstaat gelegen sein müßte; die Staatsgewalt, die fürs Funktionieren des kapitalistischen Reichtums sorgt, haben sie zum Ansprechpartner für ihr bescheidenes Ziel gemacht, auch die Armen im Lande funktionsfähig zu halten; sie haben darauf bestanden, daß sie doch irgendwie zusammengehören, der Klassenstaat und seine Arbeiterklasse – zwar im Gegensatz, aber doch verbunden, „in einem Boot“ – und daß Proletarier insofern doch auch Bürger sind. Statt sich gegen den Staat zu stellen, von dem die Arbeiter nichts haben, haben die Linken Ansprüche an den Staat vorgetragen, der die Leistungen seiner Arbeiter noch zu wenig würdigt. So wurde die „soziale Frage“ sozialdemokratisch.
Dieser Standpunkt hat – nicht nur – in Deutschland Karriere gemacht. Seine politischen Vertreter wurden als konstruktive Kraft im Staat anerkannt; sie haben ihn selbst geleitet und alle Notwendigkeiten des „marktwirtschaftlichen“ Systems eingesehen, von den Kriegskrediten bis zur Konjunkturpolitik. Die Forderung, der Staat sollte sich mit seiner Gewalt für die Lohnarbeiter nützlich machen und könnte nur insoweit mit Anerkennung durch die werktätigen Massen rechnen, wurde stückweise aufgehoben in den Standpunkt, daß der demokratische Staat den Nutzen seiner minder bemittelten Bürger fürs nationale Ganze schon kennt und gerecht würdigt und ihnen zukommen läßt, was ihnen – eben als Bürgern der minder bemittelten Art – zusteht. Die Forderung nach dem demokratischen Recht der Arbeiter, für die eigenen Interessen zu kämpfen, wurde abgelöst durch die umgekehrte Sicht, daß alle materiellen Interessen auch schon grundsätzlich, gewissermaßen von der Methode her, definitiv bedient seien durch die Rechte, die der demokratische Staat seinen wahlberechtigten Bürgern gewährt. Damit wurden die Parteien der Linken, gemessen an den früheren Einteilungen, politisch rechts: Sie gehen davon aus und bestehen auch darauf – nicht anders als die seit jeher rechten Parteien –, daß das arbeitende Volk sich wie alle anderen Bürger durch den Staat, wie er ist, grundsätzlich gut bedient weiß und deswegen nicht gegen ihn um seinen Lebensunterhalt streitet, sondern sich für die politische Macht einsetzt, die alles, also auch seine Lebensbedingungen im Griff hat.
Diese Gleichung zwischen Arbeiterinteressen und Staatsmacht hat die Sozialdemokratie gemeinsam mit ihren rechten Gegenspielern dermaßen erfolgreich durchgekämpft im Volk, daß niemand mehr so einfach seine Armut zum Anlaß nimmt, den sozialen Inhalt seiner staatsbürgerlich-demokratischen Rechtslage einmal genauer ins Auge zu fassen. Die Unzufriedenheit ist so wenig geschwunden wie ihre materiellen Gründe; aber vorgetragen wird sie schon seit langem nur noch in der von den staatstragenden Parteien vorformulierten Beschwerde, die regierende Partei ließe es offenbar an der schuldigen Fürsorge für ihre ureigenste Dienstmannschaft fehlen, sei zu nachgiebig gegenüber minder berechtigten Interessen, wahre bei den Lasten, die sie verordnet, nicht die ausgleichende Gerechtigkeit. Mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der Staatsmacht wird zum Universalgrund aller Schädigungen, die ein Bürger, durch wen auch immer, erleidet und die er schon gar nicht mehr als Schädigung seines Interesses, sondern als Benachteiligung und Verkürzung eines ihm zustehenden Rechts begreift. Die „soziale Frage“ ist damit erledigt; sie ist ersetzt durch die nationale Sorge, ob die Nation machtvoll genug dasteht oder sich Fesseln anlegen läßt – also genau die Sorge, mit der die Nutznießer der Klassengesellschaft und geborenen Freunde des Klassenstaats, vertreten durch ihre von Anfang an „rechten“ Parteien, seit jeher und mit gutem Grund das Wirken ihres Staates begleiten. So finden sich die verschiedenen Klassen und „Schichten“ in der Parteilichkeit für ihre Nation – und scheiden sich politisch wieder unter ganz anderen Gesichtspunkten und an ganz anderen als der „sozialen Frage“. Vom Standpunkt der klassenübergreifenden Abstraktion, daß alle von der Macht des Staates abhängen – „irgendwie“ –, lassen sich Erfolge und Drangsale der Nation nämlich unterschiedlich gewichten; die politischen Konkurrenten führen es vor. Deren Meinungsstreit kann ein jeder mit seiner höchstpersönlichen Unzufriedenheit begleiten, sie in den Werbesprüchen der einen oder anderen Seite besser aufgefangen sehen – und allenfalls am Grad der Unzufriedenheit kommt noch heraus, wieviel die verschiedenen Leute im Alltag der kapitalistischen Konkurrenz so wegstecken. So ist die Unzufriedenheit beschaffen, die den etablierten Parteien ihr Echo im Volk sichert, wenn sie darum streiten, in wessen Händen die Staatsmacht am besten gedeiht.
Dieses Echo läßt zur Zeit zu wünschen übrig. Die altgedienten Demokraten arbeiten sich gerade zur großen Einigkeit über nationale Notstandslagen hin – da tritt eine Konkurrenzpartei auf, die die nationale Problemlage noch viel dramatischer findet, und hat auch noch Erfolge. Ein Falscher nutzt die politisierte Unzufriedenheit – also muß es sich um eine staatsabträgliche „Verdrossenheit“ handeln. Dabei haben die in Bonn so harmonisch konkurrierenden Parteien selber den Leitfaden für genau den „Bürgerzorn“ vorgegeben, der ihnen jetzt wahltaktisch ein wenig aus dem Ruder läuft. Sie haben den alten Bundesbürgern alle neuen Belastungen für Deutschlands neue Größe als Solidarbeitrag zugunsten der frisch annektierten Ostdeutschen erklärt und damit das nationalistische Rechtsbewußtsein des altgedienten BRDlers aufgeregt, der gar nicht einsehen kann, weshalb „seine“ Staatsgewalt Leuten verpflichtet sein soll, die noch gar nicht so lange dazugehören. Sie haben den neuen Bundesbürgern ein nationales Anrecht auf materielle Gleichstellung mit den alten bescheinigt, das aber nicht per Beschluß, nur auf dem Weg einer – mittlerweile unabsehbar – langwierigen Angleichung zu erfüllen wäre; die sollen sich also als Deutsche und sonst nichts definieren und zugleich Abstriche an diesem Status akzeptieren. So kommt es, wie es kommen muß: Die einen fürchten nicht so sehr um ihren „Besitzstand“ – würden die alten Bundesbürger ernstlich den ins Auge fassen, dann würde ihnen zumindest auffallen, daß es bei ihnen gar keinen irgendwie gleichen oder gemeinsamen „Besitzstand“ gibt, sondern weit größere Unterschiede als zwischen „Ost“ und „West“ –; worum sie fürchten, ist viel eher ihr exklusives nationales Anrecht auf, was auch immer ihren wirklichen „Besitzstand“ darstellt. Die andern fühlen sich, wenn ihnen danach ist, – auch dann, wenn ihr privater „Lebensstandard“ den westdeutschen Durchschnitt längst übertrifft – beleidigt als „Deutsche zweiter Klasse“. Der Aufruf an alte wie neue Bürger, Solidarität zu über, stachelt alle Beteiligten dazu an, auf andere zu deuten, die beim Opfer-Bringen viel eher an der Reihe sein müßten; diese trostlose Übung in berechnender Gerechtigkeit wird dann glatt noch als Materialismus verdächtigt. Und um das Dauerthema des deutschen Herbstes 1992 wieder zu Ehren zu bringen: Allen Volksteilen wird jede Zusatzbelastung als ehrenvoller Dienst an der deutschen Sache vorstellig gemacht – und die Anwesenheit von armseligen Ausländern als unerträgliche Last für den Staat und Mißbrauch seiner großzügigen Rechtslage. Die Rechnung geht immer auf. Mit tödlicher Sicherheit werden sich gut betuchte sächsische Steuerzahler mit bayrischen Arbeitslosen und umgekehrt darüber einig, daß das ja wohl ein Skandal ist: Die Nation, hört man, leidet Not, und was muß man sehen? Ausländer, nichts als Ausländer!
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Es gibt erstens keinen Sachzwang, weder Gen noch Umwelt, daß sprachfähige Deutsche solche ekelerregenden Schlüsse ziehen. In der Demokratie ist zweitens auch niemand polizeilich gezwungen, sich an dem politischen Leitfaden zu orientieren, den die politische Führung, mit welcher Berechnung auch immer, ausgibt. Und wenn es drittens ums Überzeugen ginge, dann stünden die regierenden Demokraten mit ihrem Ausländer-raus-Programm wie mit ihrer inneren Aufrüstung überhaupt auf verlorenem Posten. Aber der moderne bürgerliche Staat funktioniert eben überhaupt anders; und deswegen ist auf linientreue Reaktionen des Publikums so furchtbar viel Verlaß. Gerade die Demokratie präsentiert sich ihren Bürgern als deren absolut klassenloses „Gemeinwesen“; mit ihrem gesamten Procedere baut sie das falsche Bewußtsein auf, alle durchs kapitalistische Geschäftsleben und das dazugehörige Gesetzbuch geschaffenen Lebensbedingungen wären „uns alle“ betreffende „Probleme“ bzw. „Problemlösungsversuche“; sie stellt sich dar als die allgemeine Fassung aller privaten Lebensprobleme, wo sie in Wirklichkeit mit ihren allgemeinen Rechtsvorschriften Probleme und Chancen, je nach dem, für die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen stiftet. So gewöhnt sie ihre Bürger daran, alle eigenen Sorgen „von oben herab“, vom Standpunkt einer allgemeinen Ordnungsstiftung, als Fall einer allgemeinen Problemlage zu betrachten und in diesem Sinn umgekehrt die öffentlich ausgerufenen Probleme als welche zu verstehen, um die jeder Regierte sich letztlich genauso verantwortungsbewußt kümmern muß wie die Regierenden. Zur Belohnung für diesen Standpunktwechsel – von den eigenen Sorgen zu denen, die die Staatsgewalt hat, nicht zuletzt mit ihren Bürgern! – gewährt die Demokratie die Freiheit, die amtierenden Politiker für Flaschen zu halten, die nichts Ordentliches zuwege bringen. Das ändert an der Kompetenzverteilung zwischen „oben“ und „unten“ nichts und bietet dem mündigen Bürger unvergleichlich besseren Grund, sich den Kopf seiner Vorgesetzten zu zerbrechen, als jede Verherrlichung der amtierenden Herrschaft ihm je bieten könnte – aus dem Ressentiment gegen „die da oben“ erwächst umgekehrt sogar die solideste Begeisterung für Macher, die „denen“ mal zeigen, wie ordentlich regiert gehört. Und schon wieder ist die Demokratie auf dem Posten: Auch dafür stellt sie ein Angebot an „starken Männern“ bereit, die die höchst politische „Politikverdrossenheit“ der regierten Massen für ihren Wahlerfolg funktionalisieren und dafür den verärgerten Wählern das schöne Gefühl verschaffen, mit ihrem Wahlzettel den Herrschenden einen saftigen Denkzettel ausgestellt zu haben.
Bewerber für diese Rolle gibt es immer genügend, auch derzeit und natürlich auch bei der parlamentarischen Opposition. Derzeit aber eben auch bei einer Rechtspartei, die mit der in einer Demokratie verlangten Glaubwürdigkeit geltend machen kann, daß sie den jetzt offiziell ausgerufenen „Asylnotstand“ schon seit Jahren anmahnt. Eine Herausforderung für Demokraten, die sowieso den deutschen Staat vor einem selbstverschuldeten Machtverlust retten wollen, daß den Rechtsextremen die Spucke wegbleibt.
Die Waffe der Demokratie gegen Unzufriedenheit: „Geistige Führung“
Zurück zur Unzufriedenheit im deutschen Volk. Die „Klassenfrage“ ist und bleibt demokratisch eliminiert; die verbliebenen „sozialen Fragen“ sind definitiv in pur nationale Rechtsfragen verwandelt; geschädigte Interessen melden sich, wenn überhaupt in der Politik, rein nationalistisch zu Wort, als Gerechtigkeitsproblem und Zweifel an der „Handlungsfähigkeit“ und Tatkraft der Regierenden, und auch das noch in Abhängigkeit von den Berichten zur Lage der Nation, die die Republikführung herausgibt. In dieser Lage entdecken demokratische Politiker an dem – von ihnen! – aufgeregten Nationalismus ihrer guten Deutschen „unbewältigte soziale Problemlagen“ und kennen Anlässe zu materieller Unzufriedenheit; schwarz-rot-golden fanatisierten Jugendlichen halten sie verständnisvoll die Hölle der „sozialistischen Plattenbauweise“ und fehlender Discos zugute, obwohl die Knaben gar nicht nach einer Villa mit Musik, sondern die Beseitigung von Negern verlangen; einem „rechtsradikalen Wählerpotential“ entnehmen sie die Erkenntnis, daß es im goldenen Westen auch jede Menge Slums gibt.
Warum das? Denn so ist es ja wirklich nicht, daß ausgerechnet die Führer der Nation von der nationalistischen Sicht der Dinge auf die materiellen Interessen zurückkommen wollten, die in der „Marktwirtschaft“ auf der Strecke bleiben; und um einen Kampf für diese Interessen, gegen das Setzen auf starke Männer in einem starken Staat, geht es erst recht niemandem, der auf einmal verständnisvoll die Existenz „sozialer Mißstände“ einräumt.
Den guten Demokraten, die von Rechtsradikalismus auf soziale Not „schließen“ – und diese allemal unschwer antreffen, wenn sie nachschauen! –, geht es erklärtermaßen darum zu verhindern, daß ein Falscher diese Not „politisch mißbraucht“ – im Klartext: daß ein anderer als sie, womöglich eine Partei außerhalb des etablierten Kartells, durch berechnendes Deuten auf „Mißstände“ für sich Stimmung macht und Stimmen holt. Dann liegt nämlich eine „geschürte“ und keine „berechtigte Unzufriedenheit“ vor – letztere erkennt man eben daran, daß sie sich auch wieder zufrieden gibt, wenn Politiker aus dem etablierten demokratischen Parteienspektrum berechnend wohlwollendes Verständnis zeigen, daß sie also demokratisch berechenbar bleibt. So werden von kompetenter Seite „Mißstände aufgedeckt“, elende Lebensumstände als „sozialer Sprengstoff“ gewürdigt, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot als guter Grund für eine schlechte Meinung anerkannt, um jede Unzufriedenheit erstens demokratisch zu monopolisieren – und zweitens zurückzuweisen.
Denn dem anerkennenden Zuspruch folgt sogleich die Belehrung: daß das materielle Elend zwar subjektiv schlimm sein mag, aber objektiv unumgänglich ist – wegen der „Marktgesetze“, und weil „alles nicht so schnell geht“ –, außerdem notwendig – für die Nation und ihren Erfolg –, also ehrenhaft, wenn es ohne größere Unzufriedenheit ausgehalten wird. Unzufriedenheit ist folglich unmoralisch, zeugt von einem „Anspruchsdenken“, das schon dadurch seiner Haltlosigkeit überführt ist, daß es nicht zufriedengestellt wird, und muß im Namen und zugunsten der Nation zurückgewiesen werden. Das demokratische Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition bewährt sich hier einmal mehr als Arbeitsteilung bei der Scharfmacherei gegen materielle Bedürfnisse von unten: Die Regierung agitiert gegen „überzogene Ansprüche“ und „unpassende Verteilungskämpfe“, erstens immer und zweitens erst recht immer dann, wenn sie gerade neue Belastungen des „Lebensstandards“ ihrer Massen einleitet; die Opposition beschimpft die Regierung, daß sie zuwenig gegen „das Anspruchsdenken“ unternimmt, sondern immer noch Geld ans Volk wegzahlt. Und die wie immer konstruktive öffentliche Meinung wird hemmungslos:
„Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Das wird für alle schmerzhaft sein. Aber es ist nicht einzusehen, warum es uns so schwerfallen sollte, freiwillig zur Erhaltung des inneren Friedens Verzichte zu leisten, die jeder im Falle eines Krieges selbstverständlich auf sich nimmt.“
Dieses Maß für einen friedensgemäßen Lebensstandard hat nicht etwa der letzte Reichskanzler postum zur aktuellen Lage beigesteuert, sondern der vorletzte Bundeskanzler gemeinsam mit den sozialliberalen Spitzen der besseren Gesellschaft von Dönhoff bis Thierse in einem Manifest, das man für 12 Mark sogar kaufen kann.
Diese moralische Zurechtweisung ist in der deutschen Notstandsrepublik mittlerweile zur Basis für einen bemerkenswerten politmoralischen Überbau geworden, in und mit dem die demokratischen Politiker ihren Abwehrkampf gegen eine womöglich nicht mehr steuerbare, d.h. von ihnen ausnutzbare Volksunzufriedenheit führen. Einfühlsam stellen sie ihrem verdrossenen Volk eine Diagnose, die mit „Arbeitsplatzverlust“ und „Wohnungsnot“ anfängt und zielsicher bei „Verunsicherung“, „Sinnverlust“, „Orientierungslosigkeit“ und „Zukunftsangst“ landet. So wird der Unzufriedenheit nicht von vornherein jedes Recht bestritten – bloß jeder materielle Grund und Gegenstand. Sie wird als, ihrem eigentlichen politischen Wesen nach, psychische Mangelerscheinung im Volk genommen; als Defizit an sozialer Volksgesundheit, das nach ihnen, den verantwortlichen Herrschaften, als Therapie verlangt: nach „geistiger Führung“. Alle Kritik der demokratischen Opposition an der Regierung – die sowieso bloß von der „Steuerlüge“ bis zur „Tatenlosigkeit“ und wieder zurück reicht, also nichts als Klartext in Sachen Staatsnotstand anmahnt – faßt sich, wenn sie ganz ätzend werden will, in dem Vorwurf zusammen, Kohl ließe es daran fehlen – Beweis: Gäbe es sie, die „geistige Führung“, dann gäbe es zwar immer noch nicht genügend Wohnungen, aber das Übel der „Zukunftsangst“ gäbe es nicht! Dabei ist nach Auskunft der Regierung gerade diese ideelle Ware von ihr jederzeit reichlich und in bester Qualität zu haben. Freilich ist und bleibt da auch der Bundespräsident skeptisch…
Die Frage, welche Regierungstätigkeit mit „geistiger Führung“ eigentlich gemeint ist, wäre falsch gestellt. Es geht um höhere Qualifikationen des Regierens – „Handlungsfähigkeit“, „Führungsstärke“, „Ehrlichkeit“ vor allem und dergleichen mehr –, die allesamt ein demokratisches Erfolgsideal umschreiben, das es in sich hat. „Geistige Führung“ unterstellt nämlich das regierte Volk als total manipulierbare Manövriermasse, nicht bloß seine nützlichen Taten, sondern auch noch seine Einstellungen und Stimmungen als Verfügungsmasse der Regierenden. Die Forderung danach mißt den nationalen Herrschaftsstab an dem Anspruch, die regierten Massen zu einer gleichgesinnten Körperschaft geformt zu haben, die auf jedes Wort von oben hört und sich ganz freiwillig, ohne inneres Widerstreben – was der bürgerliche Geist sich bei „Geist“ eben so denkt – lenken läßt. Der Vorwurf, die Regierung hätte ihre Führungspflicht versäumt, wenn einmal manifeste Unzufriedenheit auftritt, will beim Volk gleich gar kein anderes Interesse erkennen als das, von seiner Regierung gesagt zu bekommen, was Sache ist, und keine andere Meinung als die, man müßte sie von oben mitgeteilt bekommen – lauter wüste Vorwürfe im Grunde an das Ding, das man „Volk“ nennt, aber alles nicht kommunistisch, sondern gut gemeint. Eben so: Unzufriedenheit ist eine staatsabträgliche Stimmung, die auf ein gestörtes Führungs-Gefolgschafts-Verhältnis schließen läßt, also von einer tatkräftigen Regierung durch mehr von oben verordnete Volksgemeinschaft bereinigt werden muß.
Das Ganze bringt dem Staat weder Wirtschaftsaufschwung noch Steuern, weder Europa noch Blauhelmeinsätze; aber darum geht es auf dieser Ebene sowieso schon längst nicht mehr. Daß die Demokratie praktisch, in Fragen des nützlichen Dienstes der Massen und des rechtlichen Zugriffs der Staatsmacht, zeigt, was sie kann, ist vorausgesetzt, wenn der Streit um mehr „geistige Führung“ das politische Ideal dazu aufstellt. Wo Demokraten ihrem Staat eine Ordnung verpassen, die keinem Rechtsradikalen die Chance läßt, noch viel „verbessern“ zu wollen, da bekennen sie sich auch dazu, fordern die totale Erledigung jeglichen Widerspruchsgeistes durch Gefolgschaft bis in „Geist“ und Stimmungslage hinein, messen erfolgreiches Regieren am Ideal des total ergebenen Volkes und führen ihre zutiefst demokratischen Auseinandersetzungen an dieser Meßlatte entlang, die sie mit jedem Faschisten teilen. Sicher, würde ein Hitler das Hin und Her demokratischer Politik mit dem Ruf nach „geistiger Führung“ attackieren – was er ja mal getan hat –, wüßten alle Demokraten Bescheid; aber wenn sie selber ihn erheben, wenn sie mitten in ihrem Meinungsaustausch den „schlechten Eindruck“ mangelnder Tatkraft und schwatzbudenhafter Zerstrittenheit fürchten, den sie damit machen könnten, und wenn sie einander zur Ordnung rufen, dann ist alles in Ordnung. Würde einer wie Hitler damals alle gesellschaftlichen Kräfte „gleichschalten“, dann wäre das eine Katastrophe; aber wenn sie selber die nationale Führung danach beurteilen, ob die Einschwörung aller gesellschaftlichen Kräfte und des Volkes überhaupt auf einen unbedingten nationalen Konsens und „Solidarpakt“ fraglos gelingt, dann ist das die angemessene demokratische Qualitätsprobe. Würde ein Nazi die Volksgemeinschaft gegen staatsfeindliche Kräfte mobilisieren, die bloß Unzufriedenheit stiften und schüren, läge ein Fall von Volksverführung vor; wenn sie dasselbe tun, dann verhindern sie Ver- durch „geistige Führung“.
Mehr noch: Sie „wehren den Anfängen“ und bekämpfen den „alten Ungeist“. Denn das ist ja das Allerschönste an der nationalen Einheitslinie der bundesdeutschen Demokraten: Sie haben eine Opposition kleinzuhalten, die noch nationaler und staatsfanatischer sein will als sie. Es kommt glatt als „Kampf gegen rechts“ daher, wenn alle deutschen Verantwortungsträger sich zu dem Beweis zusammentun, daß sie mit ihren demokratischen Vorgehensweisen genau das Staatsideal am allerbesten erfüllen, das unbefriedigte Nationalisten sonst zu den anderen, faschistischen Methoden greifen läßt. In ihren selbstgewählten historischen Analogieschlüssen sprechen sie es selber offen aus: „Weimarer Verhältnisse“, ein Scheitern der Demokratie an rechtsradikalen Maßstäben nationaler Geschlossenheit und einer bedingungslos durchsetzungsfähigen Staatsmacht, das lassen sie in ihrer neuen gesamtdeutschen Republik nicht zu. Sie haben sich vorgenommen zu zeigen, wie gut die Demokratie sein kann – im Ziel, den Faschismus auf dem Feld der gemeinsamen Erfolgskriterien zu beschämen.
Ja, gewiß: Die BRD ist immer noch „der liberalste Staat, der je auf deutschem Boden…“ usw. Aber was heißt das schon? Die zuständigen Demokraten sind dabei, das klarzustellen.
[1] Die politische Ökonomie der Wirtschaftskrise und ihre politische Abwicklung in einem der meistgeschädigten EG-Partnerländer sowie in den zu einem neuen Aufbruch entschlossenen Amerika sind Schwerpunktthema des vorliegenden Bandes. Die besondere ökonomische und wirtschaftliche Problemlage Gesamtdeutschlands ist in der vorigen Ausgabe in der „Zwischenbilanz einer friedlichen Eroberung“ eingehender behandelt worden.