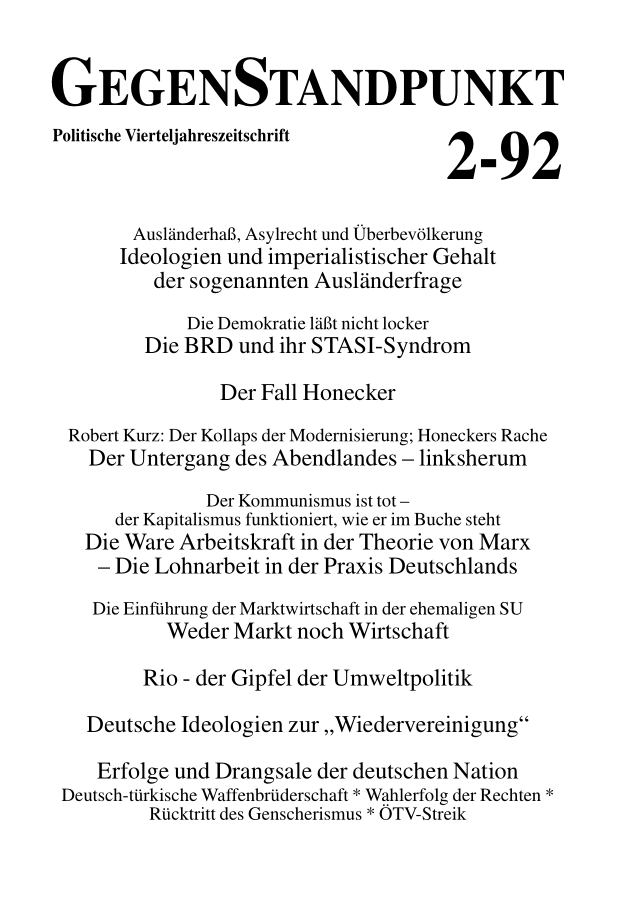Deutschland im Frühjahr 1992
Erfolge und Drangsale einer Nation
Die „Asylwahl“: Regierung und Opposition behaupten ihr Monopol auf Wählerstimmen gegen ‚Extremisten‘. „Große Koalition“: Demokraten bekennen sich dazu, dass die Konkurrenz um die Macht keine Behinderung ihrer Ausübung sein darf. Politischer Personenkult: Die Übersetzung des Erfolgs der Nation in den Charakter der Amtsinhaber. Waffenlieferungen an die Türkei: ‚Wer liefert, der bestimmt, auf wen geschossen wird‘. Das EU – Weltmachtprojekt und die Ambitionen der BRD. Genschers Rücktritt, Tarifrunde…
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die „Asylwahl“
- Brauchen und wollen wir eine Große Koalition?
- Personalia als Signale
- Was wirklich los war – oder: Die BRD und ihre SachfragenDie Exportnation nimmt ihre Rechte wahr
- Die BRD als Nachbar I: Einmischung auf Einladung
- Die BRD als Nachbar II: Europäischer Internationalismus
- Die BRD als Nachbar III: Einmischung in die Umwelt
- „Die gewachsene deutsche Verantwortung“
- Der Rücktritt Genschers
- Rückwirkungen auf die Heimat: Die Tarifrunde
Deutschland im Frühjahr
1992
Erfolge und Drangsale einer
Nation
Gewisse Wiederholungen sind nicht zu vermeiden. Diese Nation führt ein politisches Leben, das mit seinem Schematismus sämtliche schöngeistigen Anhänger von Orwell ins Exil treiben müßte. Aber die halten – im Lichte der negativen Utopie, die nun schon geschlagene acht Jahre überfällig ist – das wiedervereinigte Deutschland wohl eher für eine Spielwiese des Non-Konformismus. Auf der tummeln sich lauter Akteure und Statisten der politischen Macht, denen einfach nichts anderes einfällt als die Forderung nach „entschiedenem Handeln“ und „konsequenter Führung“. Der Anlaß mag das Gemetzel in Jugoslawien sein oder die Staatskasse, die Arbeitslosenstatistik oder ein Wahlergebnis – zielstrebig landet der deutsche Sachverstand bei dem Befund, die zum Führen Berufenen hätten jetzt aber und endlich einmal zuzupacken. Mit ihrer berüchtigten Vielstimmigkeit dringen die Demokraten jeder Couleur schlicht auf Vollzug – egal, was da gerade wieder verbrochen wird. Die Leistungen von Politik und Geschäft werden offenbar so umstandslos für fällige und unwidersprechlich gute Taten gehalten, daß als Kritik nur die Aufforderung in Frage kommt: „Schluß mit dem Zaudern! Her mit dem fälligen Ukas!“
In diesem Pochen auf „Entscheidung“, das Untätigkeit und Versäumnisse als das größte Übel bei der Ausübung der politischen Herrschaft geißelt, hat der zügellose Nationalismus sein Patent-Rezept gefunden. Er wittert ausgerechnet am Gebrauch der Macht immerzu fahrlässige Ohnmacht – und stiftet mit dieser von allen politischen Vorhaben absehenden, aber auf alle „Sachfragen“ angewandten Methodenkritik seine ganz eigenen Affären.
Die „Asylwahl“
zu zwei Landtagen, im Norden und im Süden, war so eine Affäre, in der die deutschen Demokraten ihren guten Geschmack bewiesen. Kaum waren die Stimmen ausgezählt und die rechten Parteien auf etwa 10% gekommen – wovon die mitregierenden Liberalen gewöhnlich nur träumen –, absolvierten Moderatoren und Politiker auf allen Kanälen erst Pflicht, dann Kür. In der Pflicht wurde ein bißchen gepöbelt und Abscheu vor den Rechtsradikalen demonstriert; alle Welt konnte sehen, daß es für aufrichtige Demokraten eine kaum zu ertragende Zumutung ist, mit solchen Leuten auch noch reden zu müssen. So kam Schönhuber in den Genuß, von politischen Würdenträgern regelrecht angepflaumt zu werden – und er konnte ihnen 1. das Angebot machen, doch wenigstens in aller Kürze zu erklären, was seine Partei eigentlich Verkehrtes oder Demokratiewidriges im Schild führe; dazu waren sich alle zu schade. So weit käme es noch, daß Demokraten verpflichtet wären, ihre Gegner zu widerlegen! 2. hat Schönhuber ganz vornehm und gar nicht wie ein gemeiner, ungehobelter Extremist, sondern im besten Stil eines erfolgreichen Demokraten darauf hingewiesen, daß die 10% immerhin von Wählern stammen, also von den in der Demokratie hochgeschätzten Statisten in der ebenso geschätzten Veranstaltung der Ermächtigung. Darauf haben dann die Herren & Damen Demokraten mit einer „Analyse“ der Wahlen reagiert.
Zur Vorbereitung der Kür wurde die Pflicht noch durch die Fernsehjournalisten abgerundet. Sie sendeten Beiträge über die fehlende innerparteiliche Demokratie bei den Republikaner, zeigten, daß Schönhuber schwitzt, wenn er lange Reden hält – und daß die Vergabe von Posten bei den REPs ungefähr so geht wie bei den anderen Parteien auch. Dann wurde geklärt, was verkehrt gelaufen ist bei den Wahlen. Diese „Analyse“ hat dann ans Licht gebracht, was wackere Demokraten so „betroffen“ macht, wenn der Wähler sein Kreuz bei rechten Extremisten abliefert.
Erst einmal ist ihnen in ihrer staatsmännischen Verlogenheit das Geständnis gelungen, daß sie weder an Schönhuber noch an seinen Wählern etwas auszusetzen haben. Dieselben Stars des politischen Gewerbes, die in der Konfrontation mit dem Herausforderer von rechts so taten, als wäre es unter ihrer Würde, ihn irgendeines Unrechts auch noch zu überführen, gaben nun etwas ganz anderes zu Protokoll: Sie können und wollen ihren rechten Konkurrenten gar nicht kritisieren! Sie wurden nämlich selbstkritisch: „Die Politik nimmt Themen, die die Menschen bewegen, nicht oder zu spät auf.“ Diese merkwürdige Diagnose zeugt nicht gerade von großer Distanz zu einem, dessen politische Positionen man für zutiefst verwerflich hält. Wollte man ihm das Kompliment erstatten, er hätte – als rechter Extremist! – die Schwäche der Parteien „der Mitte“ aufgedeckt?
Offenbar schon, denn der täglich mit den Führern der
Nation über deren Sorgen korrespondierende
Meinungsbildner Ulrich Wickert von der ARD hat die
„Asylwahl“ als „Protestwahl“ gekennzeichnet. Und hohen
Herren aus Bonn seine Fragen mit der Definition des
Protestwählers unterbreitet: „Protestwähler sind Leute,
die sagen: Ich habe das Gefühl, ich werde von den
Regierenden nicht regiert.“ An Zustimmung zu diesem
Befund ließen es die mächtigen Christen und Sozis nicht
mangeln. Sie gaben der „Analyse“ völlig recht, nannten
kurzerhand die Reaktion der Protestwähler irrational,
aber verständlich
– um ein Gelübde abzuliefern:
Rasches und entschlossenes Handeln
ward
versprochen – also genau das, was die Rechten und ihre
Wähler ausdrücklich eingeklagt haben!
Bleiben noch ein paar Kleinigkeiten nachzutragen. Der Erfolg Schönhubers beruht natürlich darauf, daß „die Politik“ die „Themen“ – die nicht oder zu spät aufgenommenen – gründlich breitgetreten und zu einer Schicksalsfrage der Nation erklärt hat, damit und bis sie „die Menschen“ bewegten. Und das „Irrationale“ an der „verständlichen“ Wählerreaktion besteht schlicht darin, daß die 10% das bequeme Parteiengefüge durcheinanderbringen – sie fehlen denen, die gewohnt sind, in jeder Wahl den sicheren Wählerauftrag unter großem Getöse abzuholen. Deswegen sind die etablierten Konkurrenten wieder einmal der Auffassung, daß „demokratische Gemeinsamkeit gefordert“ sei. Und wenn sie tatkräftig die „menschenbewegenden“ Themen „aufgenommen“ haben, mit denen Republikaner zu Unrecht und auf ihre Kosten erfolgreich sind, braucht sich niemand mehr den Kopf darüber zu zerbrechen, wie demokratisch die Rechten sind oder wo die demokratische Mitte liegt.
Schließlich kann man sich auch gleich dem „Thema“ zuwenden, das vor, in und nach den betreffenden Landtagswahlen bei Wählern und Gewählten so viel Handlungsbedarf hervorrief. Dann liest man den Ausländerartikel in dieser Nummer und versäumt darüber die andere Nummer im Nationalzirkus; die hat zwar auch einen Inhalt, löst ihn aber genauso konsequent in Wohlgefallen auf. Ein- und ausgeführt wird in der obersten Etage der politischen Kultur seit ein paar Wochen die Frage:
Brauchen und wollen wir eine Große Koalition?
An diesem hintersinnigen Rätsel brauchen Außenstehende nicht teilzunehmen. Abgewinnen können ihm nur Mitarbeiter des volkseigenen Betriebs „Deutsche Einheit“ etwas. Denn nur die sind motiviert für eine Problemstellung des Typs: „Schafft es die Regierung, oder schafft sie es besser, wenn die Opposition, statt an der Regierung herumzumäkeln und Alternativen zu propagieren, es mit der Regierung gemeinsam tut?“
Interessant und Ansporn zu einer gründlichen Befassung ist dieses Problem vor allem für die, welche mit dem „es“ kein Problem haben. Das sind erstens die Regierungsparteien, zweitens die Opposition, und drittens die Sprachrohre der Nation, die sich das Sorgerecht um den Gesundheitszustand ihres Staates, um die Intaktheit seiner Organe und Potenzen so zur zweiten Natur haben werden lassen, daß sie nur in einem Fall kritisch werden – wenn das Objekt ihres professionellen Mitgefühls in Schwierigkeiten gerät. Dann sagen sie sogar einmal der Regierung etwas Schlechtes nach, da sie es so weit hat kommen lassen.
Das ‚es‘ ist im übrigen kein Geheimnis. Es besteht zur Zeit hauptsächlich in der strapazierten Staatskasse, die – wg. Einheit – noch auf absehbare Zeit außerordentliche Kosten tragen und dennoch solide Grundlage für die europa- und weltweiten Händel Deutschlands bleiben soll. Das könnte für manchen interessierten und betroffenen Zeitgenossen ein guter Grund sein, das Funktionieren der Staatsfinanzen einmal näher zu beleuchten – ist es aber nicht. Das kommt daher, daß die genannten drei Instanzen – Regierung, Opposition und organisierte Öffentlichkeit – beschlossen haben, daß aus den Finanznöten der Nation sowieso nur eines folgt: Der „Bürger“ hat mit seinem Geldbeutel dafür geradezustehen. Also ist der Titel „Opfer“ wegen der Wichtigkeit der Sache ganz oben im Regierungsprogramm. Und auf der Grundlage dieser für unausweichlich befundenen und längst feststehenden Folgerung aus der Lage, und nur auf Basis dieser Beschlußlage hebt das Räsonnieren darüber an, wie die Regierung beschaffen sein müßte, um sich das Prädikat „uneingeschränkt handlungsfähig“ zu verdienen.
Der heftige Antrag auf Verwirklichung dieses schönen demokratischen Ideals kommt bei seiner Begründung natürlich ganz ohne nähere Befassung mit besagtem „es“ aus; und schon gleich ohne die ansonsten für Nationalisten recht bedeutsame Frage, wer und was sich deutschem Tatendrang ernsthaft in den Weg stellt. Die Behinderung, die mit „Führungsschwäche“, „Zerrüttetheit“ und „Machtverlust“ der Regierung umschrieben wird und eine große Koalition in Betracht ziehen läßt, beschränkt sich auf das demokratische Procedere. Alles, was sonst im schulischen und außerschulischen Sozialkundeunterricht als Gütezeichen demokratischer Verfaßtheit der Politik verkauft wird, wird jetzt für ziemlich zweckwidrig erachtet. Daß die Opposition, wg. Bundesrat, immer mal gefragt werden muß; daß sie mit ihrer Alternative beim Volk für sich wirbt und Stimmung gegen die Regierung macht; daß diese laut Demoskopie jetzt nicht die Mehrheit kriegen würde, im übrigen als Koalition Differenzen austrägt und „nur “ Kompromisse zustandebringt – eben alle hochgepriesenen „Einschränkungen“ der Macht, die auch dem Volk im Falle der Unzufriedenheit so wahnsinnige Chancen bieten, sich bemerkbar zu machen, ziehen gewisse Zweifel auf sich.
Glücklicherweise kommt der eingeforderte Sinn von Wahlen – die Politik soll nach und aufgrund von Wahlen frei sein von Rücksichten – auch so zustande. Die Gewählten entscheiden nämlich selbst, ob sie es mit einer Notlage zu tun haben und sich die Macht höchstförmlich auch noch teilen im Kabinett. Und was den Willen der großen Oppositionspartei SPD angeht, so hat sie ja mit dem Ungetüm einer „kooperativen Oppositionsstrategie“ einen Weg gefunden, der von der Regierung betreuten deutschen Sache zumindest nicht in die Quere zu kommen. Sie bringt in ihrer gesprächsorientierten Regierungsbeteiligung „ohne Haftung“ nur einen Gegensatz zur Mannschaft von Kohl zum Ausdruck: Es gilt den Leuten, die man zu schröpfen vorhat, das auch zu sagen! Im Unterschied zu Kohl, der zu lange an seinen optimistischen Parolen festhält, mit denen er eine Wahl gewinnen konnte, steht die SPD auf „Ehrlichkeit“; darunter versteht sie die Ansage der Zumutungen, die der größer gewordene Staat gegen seine Untertanen beschließt, und zwar mit dem hervorgehobenen Zusatz, daß es anders nicht geht. Engholm und Lafontaine halten die Betonung der Notwendigkeit erstens für „aufrichtig“, auch wenn sie außer „Einheit“ keinen Grund nennen und ihre Gründe für die Notwendigkeiten, die sie dem guten Volk aufherrschen wie Kohl auch, nicht sagen; zweitens führen sie ein Element der psychologischen Massenbetreuung in die politische Auseinandersetzung ein, das den Vertretern der Öffentlichkeit sofort einleuchtet: Wer gesagt kriegt, was ihm blüht, hat keinen Grund mehr, enttäuscht zu sein. Und das Recht verwirkt, den Regierenden, die es doch gesagt haben, einen Vorwurf zu machen. Als Wähler hat er das sichere Gefühl, „regiert zu werden“, so daß er sich „unberechenbare“ Protestwahlen sparen kann. Kanzler und Kabinett haben zwar den Nachteil, daß sie nicht die ersten waren, die sagten, wie das Volk für die „Einheit“ geradestehen muß, aber jetzt sind sie auch „ehrlich“ und nutzen den Vorteil, der sich daraus ergibt, daß sie regieren.
Es wird also einiges getan – dafür, daß sich aus der Konkurrenz um die Macht keine Behinderung der Politik ergibt; auch dafür, daß die Einheit von Staat und Volk erhalten bzw. wiederhergestellt wird, was schließlich die Grundlage dafür abgibt, daß die Politik macht, was sie will. Und dennoch reißen bei den ängstlichen Beobachtern der Bonner Szene, die stellvertretend für uns alle und zu unserer Meinung Nutzen die Erfolgschancen der Politik sondieren, die Zweifel nicht ab. Das kommt davon, daß sie immerzu alle
Personalia als Signale
werten. Und gar nicht merken, was sie mit ihrer dèformation professionnelle (dt.: Berufskrankheit, mental) da anrichten, um anschließend selbst darauf hereinzufallen. Es sind nämlich sie, die politischen Journalisten, die in ihrem Eifer immerzu darauf bestehen, daß das Volk seine selbstgewählte Elite ehrt, fürchtet und liebt; sie führen das ganze Jahr Eignungsnachweise, wenn sie das Personal der Macht danach beurteilen, ob es seine Sache gut macht und das Handwerk beherrscht. Jeden Erfolg in der Ausübung des Amtes schreiben sie dem Charakter des Inhabers aufs Konto, und jeder Mißerfolg bildet den Auftakt zur Frage nach der richtigen Besetzung. Als hätten sie keine Ahnung davon, daß die Leistungen eines Außenpolitikers etwas mit der Ausstattung der Nation zu tun haben und der auswärtigen Konkurrenz dazu, nehmen sie die Zuordnung von (Miß-)Erfolgen zu Naturell und Geist der jeweiligen Figur bitter ernst. So sehr sind sie daran interessiert, die Illusion des Wählers zu erzeugen, zu teilen und am Leben zu erhalten, er könne bei der Ermächtigung von Parteien und Personen den Auf- und Abstieg der Nation entscheidend bestimmen und womöglich noch etwas anderes verkehrt machen als überhaupt zu wählen, daß sie auch laufend die Umkehrung zelebrieren. Dann machen sie eine Gestalt aus der Führungsriege persönlich haftbar dafür, daß die Nation einen Rückschlag hinnehmen muß. Und in dem Bedürfnis, dem lieben Volk die Glaubwürdigkeit seiner Herrschaft deutlich zu machen, vergessen sie auch nie, persönlichen Verfehlungen hinterherzusteigen und das Vertrauen ab und an zu demontieren. Die Skandale, aus denen die Politik stets unbeschadet hervorgeht, führen dann zu einem Rücktritt. Die Matadoren der Öffentlichkeit haben für die Sauberkeit der Politik gesorgt, wenn sie diese von der Belastung durch ein „schwarzes Schaf“ befreien konnten.
Die Überzeugung, die mit dieser Mission verbunden ist, bestätigt sich dann auf ziemlich kindische Art, wenn Journalisten die Wirkung ihrer Art „Information“ aufgeregt besichtigen. Sie unterhalten das Publikum nach allen Regeln der Kunst, die Personenkult heißt, und entnehmen dann glatt den Umfrageergebnissen in Sachen „Sympathiepunkte für Politiker“ nicht etwa den Niederschlag ihrer täglich veröffentlichten Geschmacksurteile. Sondern exakt den Grad des Gelingens und der Verlegenheit, in den sich die Politik des Landes hineinmanövriert hat. Das führt zu so aufregenden Interviews des Typs: „Herr Minister, ihre Beliebtheitskurve ist um 6 Punkte gesunken – worauf führen Sie das zurück?“ Während härtere Knochen aus der politischen Szene immerhin noch in der Lage sind, die „Stimmungsmache“ im Lande, auch die Undankbarkeit der Bürger, die so denken, sowie deren mangelnden Sachverstand zu bemängeln, glauben die Meinungsmacher ziemlich fest an ihre Methode; ihr Umgang mit der Politik kommt ihnen als ein äußerst seriöses Bemühen vor, die Höhen und Tiefen der Machtausübung zu durchleuchten. Auch wenn die tatsächlichen Unternehmungen der Staatsgewalt dabei zur Fußnote verkommen und die „Vertrauensbildung“ ungeheures Niveau erreicht.
Die Rücktritte des Verteidigungs- und Außenministers waren für den politischen Kultus gleich ganz entscheidende Signale, denen man ad personam hinterhersteigen mußte. Denn soviel stand fest: Die leidige Affäre, die zum Rücktritt Stoltenbergs – der hatte „die Verantwortung übernommen“ – geführt hat, gebietet unbedingt, daß der neue Mann auf der Hardthöhe gefragt werden muß: „Ist dieses schwere Amt überhaupt noch zu führen?“ Und wenn der gute Volker Rühe bekennt, er würde sich auf die sicher nicht leichte Aufgabe sehr freuen, dann ist das doch ein gutes Omen; vierzehn Tage später spricht er vor den Generalen der Bundeswehr, wobei ein bißchen Kriegsbeteiligung und die dafür nötige innere Ordnung der Truppe zur Sprache kommen. Und das Interview zum Tage entlockt dem „jungenhaften Minister“, der „Schwung“ besitzt (ein General), schon wieder ein Bekenntnis. Rühe fühlt sich der Aufgabe gewachsen, und es macht ihm Spaß. Die Kurden werden dafür Verständnis haben.
Beim Rücktritt Genschers wäre der deutsche Journalismus fast in Versuchung geraten, der Affäre eine politische Bedeutung beizumessen. Manche Fragen und Kommentare waren geeignet, die aktuellen Neuerungen und – mitfühlend wie immer – Schwierigkeiten der deutschen Außenpolitik zu ergründen. So weit ist es dann doch nicht gekommen, bei der Analyse der Bedingungen, die Genscher seinem Kinkel hinterläßt. Auf die Banalität, zu fragen, wie weit deutsches Geld und deutsche Gewalt reichen, wollte sich dann doch keiner einlassen. So primitiv mag man die gestiegene Verantwortung dann doch nicht abhandeln.
Geholfen hat bei der Vermeidung jeder sachlichen Erörterung der Ambitionen und Instrumente deutscher Außenbeziehungen eines auf jeden Fall. Die Klärung der Nachfolge vom Ohrenmann, mit dessen Scheiden Karikaturisten ernste Probleme haben und diese auch bekunden, war eine echte Gaudi. Unterhaltungswert besaß die Frage nach der Qualifikation der Kandidaten, sie mußten Auskunft darüber geben, ob sie sich dem Amt gewachsen fühlen, und der „Entscheidungsprozeß“ in der FDP veranlaßte die Zeitung zu einer extrem bürgernahen, aber gerechten Kritik: „Ungekonntes Gekungel können die Bürger nicht ertragen.“
Die Radikalität, mit der die vierte Gewalt ihre Verantwortung wahrnimmt, bewährte sich auch an der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes, in der es im Grunde um eine Nebensache ging. Nämlich um den Lohn einer ansehnlichen Zahl armer, aber ehrlich gebliebener Leute. Da die zuständigen Arbeitgeber eine Aufbesserung nicht vornehmen wollten, war die Definition der Aufgabe, die sich den Beteiligten stellte, ohne die Lohnfrage viel besser zu haben. Alle möglichen Leute mußten „ihr Gesicht wahren“ (bei den Gesichtern ein fragwürdiges Bild), und am Schluß verlangten die Anwälte des ewigen Gleichklangs von Amt und Vertrauen, gewissermaßen zur Abrundung der Lohnrunde – einen Rücktritt.
Was wirklich los war – oder: Die BRD
und ihre Sachfragen
Die Exportnation nimmt ihre Rechte
wahr
Zum Wechsel im Verteidigungsministerium hat kein „Skandal“ geführt. Dieser deutsche Etikettenschwindel wird folgenden Tatsachen nicht gerecht:
– Die Bundesrepublik hat interveniert. Bei der türkischen Regierung, der sie in treuer Waffenbrüderschaft jede Menge brauchbaren Tötungsgeräts liefert. Sie hat sich beschwert über einen Mißbrauch des im Rahmen ihrer „restriktiven Waffenexportpolitik“ (Genscher) verkauften Materials. Der Mißbrauch bestand darin, daß die Türken mit deutschen Waffen Kurden massakrieren.
– Die Türkei hat diesen Vorwurf wörtlich genommen und beteuert, daß mit deutschen Waffen auf Kurden nicht losgegangen würde.
– Das hat in Deutschland zwei Reaktionen
hervorgerufen. Erstens sind ein paar Filmteams vor Ort
aufgekreuzt, um Bilder von Einsätzen zu beschaffen, bei
denen schon deutsche Panzer und Gewehre zum Zug kamen.
Zweitens wurde diese Verwendung deutschen
Friedenswerkzeuges als Vertragsbruch
tituliert.
– Die türkische Seite hat eingesehen, daß damit die Phase der Affäre, in der man Heucheleien der Diplomatie wörtlich nehmen kann und entkräften zugleich, beendet ist. Sie ist dazu übergegangen, sich auf die souveränen staatlichen Hinterfüße zu stellen und die dazu nötige Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Wehren wollte sie sich gegen das Recht auf Einmischung, das die bundesrepublikanischen Lieferanten beansprucht hatten. Eingekleidet hat die Türkei diesen Schritt in Argumente, die in anderen Zusammenhängen und von anderen Nationen vorgebracht, durchaus moralisches Gewicht bewiesen haben. Sie ist den Deutschen mit einem Hitler-Vergleich gekommen und hat ihre Kurdenvernichtung als Kampf gegen den Terrorismus legitimiert.
– Die deutsche Nation hat die moralische Offensive mit einer Gegenoffensive beantwortet. Der Hitler-Vergleich wurde als absurd zurückgewiesen, aber gleichzeitig bestand man in Bonn darauf, daß Waffenexport an Partner allemal das Recht beinhalte, die Verwendung der gelieferten Güter, im Rahmen der Partnerschaft, mitzubestimmen. Im Falle der Lieferungen von Kriegsgerät ist also ein gewisser Eingriff in die Souveränität der belieferten Nation im Kaufpreis einbeschlossen.
– Diese Botschaft hat die Nation sehr zielstrebig überhört. Es war nämlich die Wahrheit über Grund und Zweck des Waffenexports. Was jedermann über die USA und schon gleich über die Russen, die von gestern, weiß, gilt auch für das demokratische Deutschland. Waffenexport ist nicht nur ein Mittel zum Geldverdienen, sondern auch eine entscheidende Größe, wenn es um den Einfluß auf andere Nationen und ihren Kurs geht. „Restriktionen“ beim Waffenexport umschreiben die Bedingungen, die der Exporteur von seinem Interesse her dem Importeur aufmacht oder nicht erfüllt sieht.
– Die Kurden haben in der ganzen Affäre die Rolle eines Vorwands eingenommen. Das sieht man einerseits daran, wie der deutsche Staat, ganz Partner der Türkei, mit diesem Menschenschlag verfährt, sobald er zum Bestandteil unserer Ausländerfrage wird. Andererseits hat Genscher in seiner unnachahmlichen Art folgendes zu Protokoll gegeben: „Die Glaubwürdigkeit der deutschen Außenpolitik gewinnt, wenn sie sich als Anwalt von Minderheiten, von Menschenrechten versteht.“ Das erklärt die Bemühung um Glaubwürdigkeit, nicht aber den Leitfaden deutscher Außenpolitik. Der kommt aus dem deutschen Interesse, überall Einfluß zu nehmen und darüber zu wachen, was aus solchen Staaten wie der Türkei werden darf. Für den deutschen Geschmack hat sich die Türkei in einer Region, wo wir mit unseren Partnern schon um Einfluß ringen (siehe nicht nur Irak, Iran etc., sondern auch die Zerfallsprodukte der Sowjetunion), etwas zu aktiv betätigt.
– Inzwischen ist die Sache behoben, weil die streitenden Parteien sich darauf geeinigt haben, sich abzusprechen. Wie es sich für Partner gehört, ist die Politik der Türkei natürlich immer auch eine die Deutschen zu Recht interessierende, weil betreffende Sache. So ist auch der moralische Kurswert der Kurden in Deutschland ganz plötzlich wieder gesunken.
Die BRD als Nachbar I: Einmischung auf Einladung
Solch häßliche Töne wie neulich in der deutsch-türkischen Partnerschaft sind gegenwärtig nur noch im Verhältnis zu Serbien zu haben; diese Nation gibt es als einen Rest Jugoslawiens, weil Deutschland kräftig die Aufmischung des Balkanstaates betrieben hat und auf Veränderung der Grenzen beharrte. Der Regierung in Belgrad, die „die Grenzen respektieren muß“, kommt die BRD mit einer Diplomatie der Nicht-Anerkennung und Isolierung, der nur noch die Kriegserklärung fehlt. Letzteres wird hierzulande als empörende Ohnmachtsbezeugung und Hilflosigkeit gewertet; denn eigentlich müßten „wir“ die Serben, die sich zuerst der Auflösung des Staates widersetzt haben und jetzt den Krieg fortsetzen, um ihre verbleibende Staatsmacht möglichst groß werden zu lassen, entwaffnen. Das leisten die Erpressungsmanöver nämlich nicht. Deshalb heißen die Nationalisten von Serbien so ziemlich als letzte bei uns auch „Alt-Kommunisten“ – anders können gute Deutsche das Böse offenbar nicht identifizieren.
Die Nationen, die aus dem aufgemischten Ostblock hervorgegangen sind, erfreuen sich dagegen in Bonn heftigster nachbarschaftlicher Sympathie. Anders als ihre kommunistischen Vorgänger, die in ihrem bornierten Dogmatismus ausgerechnet gegen die deutsche Einmischung in ihre Staatsangelegenheiten etwas hatten, bitten die heutigen Regierungen inständig um Einflußnahme. Seit der Reform ihres Ladens stellen sie fest, daß ihre Länder und Völker einfach nicht ins Geschäft kommen – und daß Deutschland genau die richtige Adresse ist, bei der sie sich Hilfe verschaffen können. Und umgekehrt hat die BRD umgehend die Rolle des Betreuers ganzer Staatswesen übernommen. Ganz ohne den Makel, andere Nationen unter ihre Fuchtel bringen zu wollen, fällen in Bonn, in deutschen Konzernen und Banken deutsche Minister und Kapitalisten Entscheidungen darüber, was aus den östlichen Nationalökonomien wird.
Diese Bedienung des Antrags, imperialistisch behandelt zu werden, führt zu einem Typus außenpolitischer Beziehungen, an denen nichts so normal ist, wie es die deutschen Sprachregelungen hinstellen. Die in den politischen Kommentaren, welche von „Versöhnung“ und den „Schwierigkeiten der jungen Demokratien“ faseln; und die im „Handelsblatt“ und im Wirtschaftsteil, welche eingefädelte Geschäfte und riskante Kredite auflisten und beziffern.
– Die Anträge, die aus dem Osten kommen, zielen darauf ab, Kapital an Land zu ziehen, damit in den ehemaligen Ostblockstaaten Geld verdient wird und ein Wachstum zustandekommt, an dem sich die reformierten und – an kapitalistischen Kriterien gemessen – bankrotten Staaten sanieren.
Die Maßstäbe, die um Kredit und Investitionen angegangene Banker und Geschäftsleute an ihren Einstieg anlegen, harmonieren mit solchen Bedürfnissen in den seltensten Fällen; sie wollen verdienen und stellen lauter Bedingungen, die als „Sicherheiten“ des Geschäfts für die mit ihrem Einstieg beglückten Souveräne Kosten bereiten, statt der Staatskasse etwas abzuwerfen.
Und insgesamt führt die Prospektierung der Kauf- und Anlagegelegenheiten des „Marktes“ mit seinen verwegenen Eigentumsbeständen, der Qualität des nationalen Geldes zu einer wuchtigen Enttäuschung. Die Vorstellung einer bereitwillig zugelassenen „Erschließung“ blamiert sich gründlich. Und die wenigen gefeierten Projekte, die gleich mit lauter Sonderbegünstigungen der Einsteiger beginnen, sind wegen der ziemlich einseitigen Erträge überhaupt nicht der Anfang eines nationalen Aufschwungs im Osten. Vielmehr das Festnageln der Staaten auf eine kontinuierliche Abhängigkeit von westlichem Geld.
– Das nehmen die deutschen Politiker einerseits zum Anlaß, vom Scheitern der Kapitalisierung des Ostens Kenntnis zu nehmen. Von „Schwierigkeiten bei der Einführung der Marktwirtschaft“ ist genug die Rede, auch vom „Wegbrechen des Ostmarkts“, den man ideell schon beschlagnahmt hatte und gewissermaßen in Fortsetzung des alten „Osthandels“ als Erweiterung der westlichen Geldquelle „Markt“ verbuchte. Andererseits gewahrt man in der Notlage der neuen Nationen eine Chance zu Erpressungen aller Art. Ob Walesa in Bonn oder Möllemann in den GUS-Staaten aufkreuzt – stets läuft irgendetwas. Aber eben nicht die große Aufrüstung örtlichen Reichtums, sondern eine Auslese von Projekten, in denen die Verteilung der Erträge merkwürdig einseitig ausfällt und oft der betreute Staat ein Stück des Reichtums und der Arbeit verpfändet, über die er gebietet.
– Die andere Chance wird von den Politikern wahrgenommen. Sie nehmen die Schwäche des passiven Imperialismus, der da bittstellend an Deutschland herantritt, dazu her, Tagesordnungspunkte für die „guten Beziehungen“ zu eröffnen, die wahrlich niemand mit „Hilfe“ verwechseln kann. Deutsche Minderheiten stehen hoch im Kurs, Vorschriften im Umgang mit Waffen und AKWs werden erteilt, aber auch in so freundlich aussehenden Angelegenheiten wie Hungerhilfe – wo gleich die Verteilung deutsch organisiert wird – rührt das gute Deutschland ganz unbefangen Dinge an, die an der Souveränität der neuen Partner kratzen.
So kommen zu alten, genuin deutschen „Rechten“ einige neue hinzu. Und in manchen der mit solcher Partnerschaft beglückten Nationen beginnt man zu merken, daß sich auch die Gewinner eines bloß „kalten“ Krieges den Verlierern gegenüber wie Sieger aufführen.
Die BRD als Nachbar II: Europäischer Internationalismus
Manche Leute halten sicher „Europa“ immer noch für ein Projekt, das wegen leidvoller Erfahrungen mit der Feindschaft um der Völkerfreundschaft willen angezettelt wurde. Dazu wäre aber ein gemeinsamer Markt nicht nötig gewesen. Ein schlichter Gewaltverzicht (auch Staaten verzichten nur auf Sachen, die sie sich leisten können, die ihnen zu- und zu Gebote stehen) hätte genügt. Aber der war ja nie im Programm.
Das Wirtschaftsbündnis, das noch in diesem Jahrhundert in die „politische Einheit“ münden soll, also einen Staat zum Ziel hat, hat schon eher etwas mit Markt zu tun. Und zwar in der Bedeutung, die die Staaten, die sich zu diesem Bündnis entschlossen haben, Märkten so beimessen. Wo ge- und verkauft, also viel Geld verdient wird, haben auf Marktwirtschaft festgelegte Staaten die Quellen ihres Reichtums, das Geld und Menschenmaterial ihrer Macht.
Der gemeinsame Markt ist eben deswegen ins Leben gerufen worden: Die Staaten, die ihn veranstalten und ihn seit 40 Jahren etappenweise ausbauen, wollten die Quellen ihrer Macht erweitern, ihre Potenzen zusammenlegen, weil sie ihnen als getrennte zu bescheiden vorkamen. Ihr Beschluß zum schrittweisen Verzicht auf Konkurrenz untereinander, zur Freigabe der „eigenen“ Gebiete und Völker für das kapitalistische Geschäft ohne die Beschränkungen, die nationale, auf staatliche Nutznießung berechnete Eingriffe und Vorbehalte diesem Geschäft bereiten; der Beschluß, nicht nur wie üblich andere Staaten als kostspieliges und dem Handel und Wachstum abträgliches Handelshemmnis zu behandeln, sondern auch sich selbst: Diese dem gewöhnlichen Nationalismus in Wirtschaftsdingen zuwiderlaufende Entscheidung ist das Werk von Nationalisten, die sich bei Besichtigung ihrer Ressourcen zu gering vorkamen. Als Realisten der Macht hielten sie nach dem Zweiten Weltkrieg den anderen gewöhnlichen Weg von Nationen, die mehr wollen, für nicht gangbar. Die Welt war aufgeteilt, die ökonomischen und kriegerischen Machtmittel ziemlich auf ihre Kosten sortiert, Korrekturen auf Kosten eines kleinen Nachbarn waren weder nützlich noch ratsam, größere unmöglich. Schließlich gab es Supermächte, deren eine mit ihrer Marktwirtschaft als übermächtiger Konkurrent aus dem Waffengang hervorgegangen war; die andere ging zwar leicht als Feind zu definieren, war aber ohne den Zuspruch und Schutz der einen nicht herauszufordern.
Der mißlichen Lage haben die Nationalisten Europas berechnend entsprochen. Und genauso berechnend ihren Weg zu einer Korrektur dieser Lage organisiert. Ihre nationalen Gewaltmittel und deren Einsatz haben sie weitgehend an der Austragung des Ost-West-Gegensatzes ausgerichtet. Der Kriegsverlierer Deutschland ist nur mit dem Willen zum Beitrag an der Nato-Mission, dadurch aber schon, wieder in den Besitz einer Streitmacht gekommen. Ihre ökonomische Macht haben sie der Konkurrenz gewidmet, deren Maßstäbe der Kriegsgewinn(l)er USA setzte. Also zum Zwecke der Emanzipation aus der selbstverschuldeten Zweitrangigkeit zusammengelegt.
Deutschland, als Frontstaat von den USA protegiert, vorneweg. Der Wille zur Exportnation, der 1952 in den Bilanzen schon die ersten Früchte zeitigte, bewährte sich als ein Programm, das in „Europa“ das passende Instrument erhielt. Das Rezept gilt heute noch zu Unrecht als geniale Lehre aus der Geschichte und als Gegenteil von Nationalismus dazu. Seine Durchführung bestand in der Herrichtung deutschen Geldes und deutscher Arbeit zur weltmarkttauglichen Ressource, welche die inter-nationalen Ansprüche Deutschlands auch noch moralisch ins Recht setzte gegen die nationalen Berechnungen der anderen Teilnehmer an der Veranstaltung Europa. Deren Vorbehalte wurden in jeder Phase des Projekts ausgeräumt, nicht durch gute Argumente, sondern durch die ökonomischen Mittel, welche die deutsche Nation angehäuft hatte. Die waren unter den Bedingungen des Weltfriedens, eben des Ost-West-Gegensatzes so wirksam wie sonst nur Drohungen anderen Kalibers.
Das Ergebnis ist jedem Zeitungsleser bekannt. Deutschland hat sich vom Kriegsverlierer zum „ökonomischen Riesen“ emanzipiert, auch auf Kosten der europäischen Partner. Denen präsentiert es nun seinen Willen, Europa fertigzustellen. Dem Beschluß, aus Europa einen Standort für Kapital jeder Art zu machen, ist schon stattgegeben. Der Binnenmarkt beendet alle im Gemeinsamen Markt noch üblichen Praktiken der Nationen, Geschäfte mit Ware, Geld und Kapital gemäß nationalen Interessen an der Grenze zu fördern oder zu beschränken. Der Beschluß, aus der einen Geldquelle namens „Europäischer Markt“ das Mittel einer politischen Macht zu machen, steht an. Deutschland ist der heftigste Befürworter dieses Supra-Nationalismus und macht überhaupt kein Hehl daraus, daß es um die Gründung einer Weltmacht Europa geht.
Unter Berufung auf die Abhängigkeiten, die mit 35 Jahren Gemeinsamer Markt gestiftet worden sind, „überzeugen“ deutsche Politiker ihre europäischen Kollegen nach Kräften davon, daß sich ihr Nationalismus in Wirtschaftsdingen nicht mehr lohnt. Unter Berufung auf die Weltlage, die mit der Erledigung der Sowjetunion eigentlich auch die Zurückhaltung gegenüber den USA überflüssig macht, verweisen deutsche Politiker ihre europäischen Partner auf die wunderbare Gelegenheit, sich auch zur Ordnungsmacht zusammenzuschließen. Am Golfkrieg, wo zwar die europäischen Nationen alle auf ihre Weise, aber subaltern mitwirken durften, fällt deutschen Internationalisten dasselbe auf wie am Fall Jugoslawien. Ein „Europa, das mit einer Stimme spricht“, wäre das Ende aller Not – der Not, die Nationen so geläufig ist, bei denen Wille und Fähigkeit ein bißchen auseinanderfallen.
Die deutsche Politik betreibt die Etablierung einer europäischen Weltmacht mit einem Realismus, der die nationalen Interessen der Partner immerzu in Rechnung stellt. Und nach Mitteln und Wegen sucht, ihnen die Relativierung dieser Interessen geboten erscheinen zu lassen. In den ziemlich deutsch entworfenen Bedingungen, die Nationen für den Beitritt zur Währungsunion erfüllen müssen, kommt das Angebot zur Teilhabe an einer schlagkräftigen Euro-Währung – und das ist für Nationen interessant – als Forderung auf den Tisch, die nationale Freiheit zur Schöpfung und Handhabung von Kredit einzuschränken. Den Nationen, bei denen absehbar ist, daß eine solche Einschränkung keine Willensfrage ist, weil sie sowieso nicht geht, wird mitgeteilt, daß sie künftig ihre Bilanzen und Haushalte zwar in Abhängigkeit vom soliden Euro-Geld zu regeln haben, aber es nicht als ihr Instrument zur Verfügung haben.
Daß die politische Einheit nicht nur der Beaufsichtigung des ihr unterstellten Europa, sondern vor allem dem Einfluß auf den Rest der Welt zugute kommt, ist anläßlich von Jugoslawien ausführlich zur Sprache gekommen. Die deutschen Scharfmacher Europas bekennen sich schon jetzt dazu, daß die Übernahme von „mehr Verantwortung“ so etwas wie eine Neuaufteilung der Verantwortung ist. „Im Rahmen des Bündnisses“ soll ja ausdrücklich „statt Amerika“ und im Ernstfall auch anders als Amerika und gegen Amerika heißen. Deutsche Politik will die Bundeswehr deutschen Interessen gemäß machen, aus- und umbauen. Aber auch europäische Perspektiven sind anvisiert, und daß beides – so wie die Dinge jetzt liegen – nur zu haben ist, wenn wir innerhalb der Nato und der KSZE unsere Kompetenzen aushandeln, befreit das deutsche Streben von jedem Verdacht.
Die BRD als Nachbar III: Einmischung in die Umwelt
Der Nutzen der Entwicklungshilfe, die Deutschland einige Jahrzehnte lang geleistet hat, mag für Idealisten der Veranstaltung fragwürdig sein. Die Nation verbucht ihn zweifach. Einerseits hat die Kreditierung kapitalschwacher, also mittelloser Staaten den Transfer ansehnlicher Reichtümer in Gang gebracht und auf absehbare Zeit gesichert. Andererseits ist die Einsicht gereift, daß dafür weitere Hilfe, Belastungen des deutschen Staatshaushalts mit Kosten ohne Nutzen, überflüssig ist.
Wenn die Entwicklungsländer keine mehr sind – die Versuche, ihnen eine Entwicklung zu gönnen, haben sie ja kaum überlebt –, ist die Neubestimmung ihres Status vonnöten. Denn daraus, was sie eigentlich für uns, also an sich sind, ergibt sich, was mit ihnen anzustellen ist, was wir von ihnen verlangen können, wie unsere Fürsorge auszusehen hat. Bedeutungslos sind sie auf keinen Fall geworden. Ihre Funktion ist sogar gestiegen: Was bei uns in erschreckender Weise, durch industriellen und konsumbesessenen Leichtsinn, ramponiert worden ist, die Umwelt, können sie retten. Einerseits durch Müllimporte, weil sie Platz haben, andererseits durch die Unterlassung der Sünden, die ihnen sowieso nichts nützen und uns bloß das Umweltproblem eingebracht haben. In diesem Sinne sind sie verantwortlich für die Umwelt der ganzen Welt und haben mit ihrem restlichen Regenwald Anspruch auf kontrollierte Rettung ihrer Natur.
Weil die Umwelt an den Grenzen nicht haltmacht, kümmern sich konkurrierende Nationen zielstrebig um die Umwelt hinter den Grenzen. Einmal zur nationalen Einsicht gelangt, daß der rücksichtslose Umgang mit der Natur diese als Geschäfts- und Lebensgrundlage in Frage stellt, haben fortschrittliche Staaten – Deutschland! – Konsequenzen gezogen. Gewisse Beschränkungen des Geschäfts, auch staatliche Kosten müssen in Kauf genommen werden, weil andernfalls der Schaden noch teurer käme und alle Grenzwerte überschreiten würde. Konsequent ist es dann allerdings auch, wenn die umweltbewußten Nationen ihre Konkurrenten darauf festlegen, dieselben Kosten zu tragen und dieselben Umweltauflagen zu machen. Damit nicht aus unser aller Umwelt ein Standortnachteil wird.
Deutsche Politik kümmert sich also nicht nur um die Verschrottung von Ostblockwaffen, um die Inflation in England und Spanien, sondern auch um die Abgasnorm von Autos und Chemiefabriken weltweit. Sie zerrt, mit der weltweiten ökologischen Moral im Rücken, an den Nerven ihrer Partner und Konkurrenten, damit am Zuckerhut eine Umweltkonferenz stattfindet, auf der imperialistische Streitigkeiten im Namen des Klimas auszutragen gehen.
„Die gewachsene deutsche Verantwortung“
ist einerseits eine schöne Redensart. Andererseits – und so will sie auch immer verstanden sein – bezeichnet sie kein Ideal, sondern eine Realität. Erstens die Errungenschaften deutscher Politik und Ökonomie: Die BRD ist als „Exportnation“, auch von Waffen, maßgeblich daran beteiligt, was auswärtige Nationen unternehmen. Was die leisten müssen, um auf dem Weltmarkt zu bestehen, was sie sich listen können und wie sie mit ihrem Volk umgehen, entscheidet sich in der ganzen Welt daran, wie sie den Maßstäben gerecht werden, die Deutschland setzt. Die Interessen Deutschlands, von dessen Geld und Fürsprache nicht nur das Staatsprogramm von Ländern minderen Kalibers abhängt, sondern auch manche Bilanz bei den imperialistischen Konkurrenten, sind ein fester Bestandteil der politischen Kalkulation, die in den Hauptstädten der Welt ablaufen. Sie sind als gar nicht nebensächliches Maß der Handlungsfreiheit anderer Souveräne wirksam.
Zweitens bezeichnet der Spruch die Zuständigkeit, die Deutschland aus seinen Errungenschaften ableitet. Diese Nation besteht darauf, ihre Errungenschaften in das gesicherte Recht umzumünzen. Einfluß zu nehmen und den Kurs von Partnern und Konkurrenten zu bestimmen. Das ist kein konservatives Programm, sondern – wie die rege diplomatische Tätigkeit Genschers an allen Fronten sinnfällig zeigt – eine Kette von Einmischungsakten, die die Welt verändern. Eine Nation, die die Auflösung anderer Staaten betreut und sich bei den Neugründungen wie selbstverständlich als Berater, Partner und Schutzmacht betätigt, erhält nicht den status quo.
Drittens betrifft das schöne Wort von der „gewachsenen Verantwortung“ den Bedarf, der an der eigenen Ausstattung angemeldet wird. Die Emanzipation der Bundeswehr von einer Bündnisarmee zu einem Instrument der deutschen und europäischen Interessen, die überall auf der Welt zu Hause sind, ist im Gange.
Der Rücktritt Genschers
Daß der Mann abgetreten ist, weil er als guter Demokrat etwas von der Vergabe von Ämtern „auf Zeit“ hat läuten hören, glaubt er selber nicht. Desgleichen ist zweifelhaft, daß er sich „um Halle kümmert“. Diese offenkundigen Lügen, die eben das Gegenteil einer schlichten privaten Entscheidung – wg. Gesundheit und so – ausdrücken, ohne daß sie ernstgenommen werden wollen, haben zur Frage geführt: „Wird deutsche Außenpolitik jetzt schwieriger?“ Der gute Mann ist also in den Verdacht geraten, sich vor einer „unbequemen“, aber fälligen Phase deutscher Außenpolitik drücken zu wollen: Um „sein Bild“ in der Geschichte zu retten, um als Persönlichkeit nur mit den Erfolgen Deutschlands, nicht aber mit den Rückschlägen, die er voraussieht, in Verbindung gebracht zu werden – deswegen soll er sich zurückgezogen haben. Was ihm die Pfleger des Personenkults dann auch gönnen, obwohl sie schon vorsorglich sein „Geschick“ vermissen. Denn irgendwie glauben auch sie, daß es nun aus ist mit dem „Genscherismus“. Die Auskunft darüber, was da nun aus ist, scheint dann aber wieder weniger wichtig zu sein als ein breitangelegtes Huldigungstheater. An dem, was da so alles an „Leistungen“ der Außenpolitik Genschers bilanziert wird, übersehen die deutschen Nationalisten zielstrebig, daß es die Erfolge Deutschlands sind, welche gewisse Drangsale unvermeidlich machen.
Der „Genscherismus“ war nie mit der deutschen Außenpolitik zu verwechseln. Er war eine Ideologie über die deutsche Außenpolitik. Ein Geschmacksurteil von Nationalisten – auch auswärtigen –, die sich für die Stärken und Schwächen, für die Fortschritte und Schranken Deutschlands parteilich engagierten.
Positiv gemeint und als Kompliment an die Figur aus der Guillaume-Generation verabreicht, hat diese Kennzeichnung den Außenminister dafür gelobt, daß er erfolgreich war. Daß er deutsche Interessen durchsetzte und dabei ausschließlich die Mittel zum Einsatz brachte, über die Deutschland jeweils verfügte. Also keine Waffen-SS, keine Green Berets und keine Atombomben. Dieser Vergleich verharmlost stets die deutschen Mittel und Interessen, kümmert sich nicht darum, auf wessen Kosten da Friedenspolitik gemacht wurde, und vergißt schon gleich, wie sich das für politischen Sachverstand so gehört, die Opfer.
Negativ gemeint und als Kritik an der „Tour“ des gewieften Diplomaten vorgebracht, hat diese Kennzeichnung das Leiden an den Schranken deutscher Außenpolitik ausgedrückt. Und in so traurigen Witzen wie dem von der „Scheckbuchpolitik“ wurde genau die Methode eingeklagt, die anderen als „Machtpolitik“ übel genommen wurde. Besagter Vergleich ging also schon immer anders herum auch zu entscheiden; dann war er identisch mit der unverblümten Forderung nach deutscher Macht, der Auftrag zur Mittelbeschaffung in Sachen Gewalt.
Dieser Forderung kommt Deutschland seit geraumer Zeit, also auch schon unter Genscher, gründlich nach. Die Projekte der BRD – zur Erinnerung: eine Großmacht Europa auf Kosten der USA und von Japan ist vorgesehen, Veränderungen der Landkarte müssen gesichert oder verhindert werden, die Quellen deutschen Reichtums liegen überall, was nach Eingreiftruppen schreit… – bringen die Ideologie des „Genscherismus“ ganz sicher zum Verschwinden. Deutsche Außenpolitik begibt sich zur Sicherung der deutschen Sache, die unter Genscher so gewachsen ist, an allen Fronten ausdrücklich auf Kollisions- und Konfrontationskurs. So daß der schöne Schein – der nie gestimmt hat –, deutsche Außenpolitik sei so etwas wie eine raffinierte Muldenschleicherei, für die man einem Charakter vom Schlage Genschers dankbar sein muß, ausgedient hat.
Rückwirkungen auf die Heimat: Die Tarifrunde
Die Eigentümlichkeit der Tarifauseinandersetzungen, Marke öffentlicher Dienst, haben nicht die Gewerkschaften zu verantworten. Die Arbeiterorganisationen haben sich nämlich überhaupt nicht verändert, sie wollten die fällige Lohnfestsetzung im üblichen Stil über die Bühne bringen: Das Recht auf Kompensation eingebüßter Kaufkraft anmelden, die ganz normale Armut Lohnabhängiger drastisch der Nation zur Kenntnis bringen, Kampf androhen und abblasen, den Kompromiß vorrechnen und beschönigen.
Das hat ihnen der Arbeitgeber Staat nicht erlaubt. Unter Berufung auf seine angespannte Kassenlage, wegen der er sich an den Lohneinkommen in einem Maße bedient, daß selbst die Schönfärber in den Medien einen flotten Prozeß der Verarmung eingestehen, ist er grundsätzlich geworden. „Dies ist nicht die Zeit für Umverteilungskämpfe“ – mit dieser Losung war der Gewerkschaft der Kampf angesagt und der Lohn in Deutschland amtlich zum Mittel der Nation erklärt. Damit war die während des Streiks immer wieder aufgeworfene Frage, ob die Staatskasse denn wirklich nicht ein paar Prozente für die Bediensteten herausrücken kann, ad acta gelegt. Die Führung der Nation hat nämlich nicht ihr Geld nachgezählt und befunden, es sei zu wenig da. Die Probleme, die sie mit dem Geld hat, sind anderer Natur. Die BRD hat ihre Kassen kräftig aufgestockt, Kredite jeder Menge genommen und aufgelegt, um die Urbarmachung der DDR und all die vielen anderen internationalistischen Projekte zu finanzieren. Das bringt sie in Sorge um die Solidität ihres Geldes, um die Stabilität der DM, die – Genscher hin, Scheckbuch her – immer noch die Waffe der Nation in Europa und anderswo darstellt.
Außer der Notwendigkeit, kräftige Beträge aus den Einkommen der Bürger zu verstaatlichen, ist der Regierung zu Bewußtsein gekommen, daß es mit dieser Umverteilung von Kaufkraft auf die DM nicht getan ist. Eingedenk dessen, daß eine Exportnation in den Wachstumsraten des heimischen Geschäfts immer noch die erste Quelle ihrer ökonomischen Macht besitzt, stand eine sachgerechte Behandlung dieser Quelle an. Der Beschluß lautete: Deutsche Lohnarbeiter haben mit einem niedrigeren Lohnniveau als bisher für den Erfolg der Nation geradezustehen. Damit auf jeden Fall in der Heimat des geeinten Deutschland keine Behinderung der Politik eintritt, die mit ihrer weltweiten Verantwortung beim widerspenstigen Ausland auf genügend absehbare Schranken trifft, die es zu überwinden gilt.