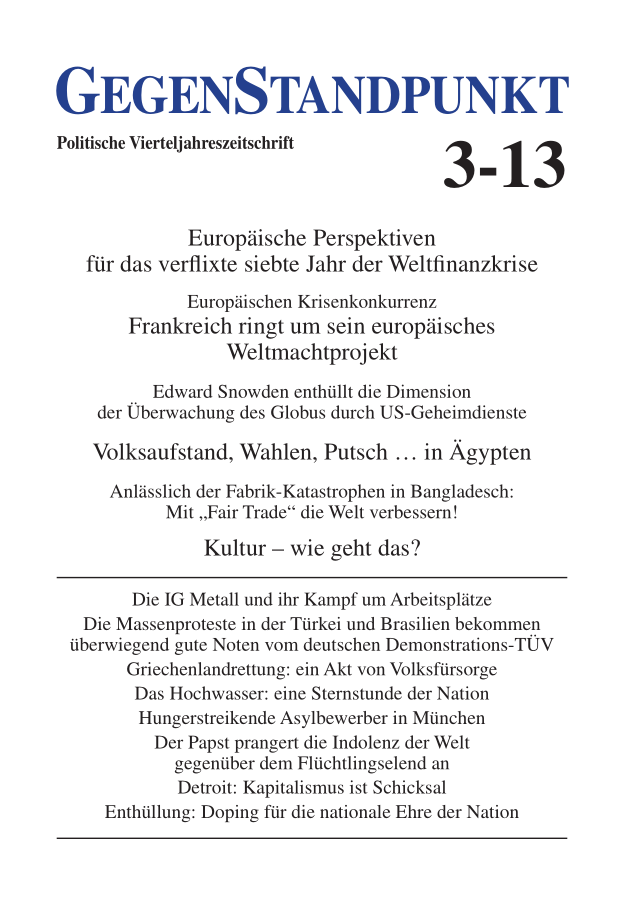Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Detroit ist pleite, die deutsche Presse informiert:
Kapitalismus ist ein Schicksal, dem man sich geschickt zu fügen hat
Am 19. Juli meldet die Stadt Detroit offiziell Konkurs an und beantragt Gläubigerschutz. „Der größte Konkurs in der Geschichte der USA“ lässt Journalisten auch hierzulande aufhorchen: In jeder Zeitung wird der tiefe Fall der „früheren Autometropole“ geschildert, die in früheren Tagen „Amerikas glänzende Zukunft“ verkörperte – „Heimat des Ford T, des Motown-Sounds und der Waffenfabriken, die den Sieg der Alliierten über Hitler möglich machten.“
Um eine Erklärung dafür, wie es zu der katastrophalen Lage kommen konnte, ist die SZ nicht verlegen. Detroit ist nur die „jüngste und größte“ einer ganzen Reihe von „Trümmerstädten“, die der Wegzug derselben kapitalistischen Industrien hinterlassen hat, die aus ihnen einst „blühende Industriemetropole“ gemacht haben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Detroit ist pleite, die deutsche Presse informiert:
Kapitalismus ist ein Schicksal, dem man sich geschickt zu fügen hat
Am 19. Juli meldet die Stadt Detroit offiziell Konkurs an und beantragt Gläubigerschutz. Der größte Konkurs in der Geschichte der USA
lässt Journalisten auch hierzulande aufhorchen: In jeder Zeitung wird der tiefe Fall der früheren Autometropole
geschildert, die in früheren Tagen Amerikas glänzende Zukunft
verkörperte – Heimat des Ford T, des Motown-Sounds und der Waffenfabriken, die den Sieg der Alliierten über Hitler möglich machten.
An drastischen Zahlen und eindrucksvollen Bildern wird nicht gespart:
„Wer Detroit besucht, muss nur ein paar Blocks aus dem Stadtzentrum hinausfahren“, um beinahe post-apokalyptische Zustände zu besichtigen: „verfallene Villen mit zugenagelten Fenstern, Ruinen und weites Brachland – dort, wo die Stadtverwaltung leer stehende Häuser abreißen ließ, damit sie nicht zu Drogenhöhlen wurden… Hunderte, Tausende solche Straßengevierte gibt es um Detroits Innenstadt herum. Hier und dort leben noch ein paar Menschen, hier und dort stehen einzelne Häuser, manche verkohlt, andere ohne Dach, doch Straße für Straße fällt die einstmals ‚schönste Stadt Amerikas‘ an die Natur zurück.“ (SZ, 20./21.7.13) „‚Bombed out‘ nennen die Amerikaner so einen Zustand: ausgebombt...“ (SZ, 22.7.)
Um eine Erklärung dafür, wie es zu einer so katastrophalen Lage kommen konnte, ist die SZ nicht verlegen. Detroit ist nur die jüngste und größte
einer ganzen Reihe von Trümmerstädten
, die der Wegzug derselben kapitalistischen Industrien hinterlassen hat, die aus ihnen einst blühende Industriemetropole
gemacht haben:
„Ihren Aufstieg hat die Stadt im Mittleren Westen dem Auto zu verdanken – und fatalerweise auch den Ruin... Es bedurfte keines Vulkanausbruchs wie in Pompeji. Das Auf und Ab der Ökonomie hatte in Detroit fatalere Effekte als jedes Erdbeben.“ (SZ, 20./21.7.)
Wenn die SZ in dem Auto
und dem Auf und Ab der Ökonomie
die Ursachen für den Aufstieg und Niedergang von Motor City
verortet, so sind das keineswegs bloß dichterische Kürzel für Automobil-Unternehmen und die Wirkungen, die von ihren Gewinnrechnungen ausgehen. Durch solche Metaphern werden diese Rechnungen vielmehr auf die thematische Ebene gehoben, auf der diese Journalisten den Konkurs Detroits überhaupt ansiedeln möchten. Dass diese Unternehmen mit ihren Einstellungen, Rationalisierungen und Standortverlagerungen offenbar über Wohl und Wehe ganzer Gesellschaften bestimmen; und dass die einschlägigen Konsequenzen dem Wirken von Naturgewalten in nichts nachstehen – das ist für die SZ ein Anlass, diese Gewinnrechnungen selbst wie Naturgewalten zu behandeln. Den Autoren dieser Berichte geht es nicht um die Abhängigkeit dieser und anderer Städte von den Standortentscheidungen des herummarodierenden Kapitals, sondern um das Schicksal Detroits
– und auch das ist keine bloße literarische Figur: Die Abhängigkeit vom Schalten und Walten großer Kapitale ist der SZ so selbstverständlich, dass sie zwar einer Erwähnung, aber keines Aufhebens wert ist. Sie richtet ihren Blick vielmehr ganz auf die Effekte
, die dadurch entfaltet werden. Von ihnen sind diese Journalisten im Falle von Detroit mit seiner beispiellosen Fallhöhe sehr beeindruckt, und so wird – mit viel Liebe zum kuriosen Detail – die kapitalistische Karriere der einstigen Autostadt zu einer Tragödie in zwei Akten aufbereitet, die mit genüsslichem Erschauern goutiert werden kann:
Dass Massen von eigentumslosen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben
einst in diese blühende Industriemonopole
gekommen sind, also dort, wo das Kapital Menschenmaterial brauchte, das sich für seine Akkumulation nützlich macht; dass darüber Detroit groß und seine Stadtkasse voll geworden ist; dass ein gewisser Komfort selbst
für die herausgesprungen ist, die am Fließband die Blechkisten zusammenschrauben durften und im Normalfall eher weniger gemütlich leben – einen ganzen Artikel lang soll man sich das alles wie eine glückliche Fügung vorstellen, die Detroit und seine Insassen dem Auto
zu verdanken haben:
„Man lebte gut damals selbst als Fließbandarbeiter. Nicht in tristen Mietskasernen wie in Berlin, New York oder Chicago, sondern in Einfamilienhäuschen im Grünen.“ (SZ, 20./21.7.)
Doch wie das mit Tragödien so ist, kommt nach der Klimax der Niedergang: Das Auto, das den Höhenflug der Stadt möglich gemacht hatte, wurde ihr auch zum Verhängnis.
Auch hier geht es der SZ nicht um die Kalkulationen des Auto-Kapitals; das würde den Blick für die tieferen Gründe des Niedergangs nur verstellen:
„In vielen Berichten wird der Niedergang Detroits immer wieder mit dem Niedergang der amerikanischen Autoindustrie nach dem Auftreten der japanischen Konkurrenz in den Achtziger Jahren in Verbindung gebracht. Doch reichen die Wurzeln von Detroits Abstieg weit tiefer. Das Auto brachte Wohlstand und Mobilität, die weiße Mittelschicht verließ Detroit und erfüllte sich den Traum vom Eigenheim in den Vorstädten, die Autokonzerne folgten ihren Arbeitnehmern und ließen neue Autos außerhalb Detroits bauen.“ (SZ 20./21.7.)
Auch hier gilt: Wenn man die eigentlichen Ursachen des Verfalls erfassen will, ist eine gewisse Vorstellungskraft verlangt. Man soll mal die Sache ungefähr so wie Goethes Zauberlehrling nehmen: Hinter dem bloß oberflächlichen Wirken der konkurrierenden Autofirmen waltet wieder das Auto
. Mit dessen massenhafter Produktion wurden nämlich Zentrifugalkräfte
freigesetzt, die sich nicht kontrollieren ließen
und Arbeiter wie Kapitalisten aus der Stadt herauskatapultiert haben. Wenn man so den Blick fürs Wesentliche freigemacht hat, braucht man zwischen den Standortentscheidungen kapitalistischer Firmen und denen ihrer Beschäftigten gar nicht zu unterscheiden; mit dem Auto
hat das ja irgendwie alles zu tun. Daher ist es egal, ob Arbeiter mit ihrem bescheidenen Wohlstand lieber ein Haus im Grünen haben oder Kapitalisten in anderen Landesteilen günstigere Bedingungen für ihre Profitmacherei entdecken – geht es um das Schicksal einer Stadt, stehen beide Phänomene für das Gleiche: Das Auto hat es gegeben, das Auto hat es genommen.
Nicht, dass man dagegen nichts hätte tun können. Schicksalsschläge sind eine Sache – wie man damit umgeht, eine ganz andere. Ist man einmal bei der Frage gelandet, dann ist Schluss mit dem Gelaber über Geistersubjekte wie das Auto
und das Auf und Ab der Ökonomie
. Dann ist auf einmal nämlich klar: Man hat es dabei mit knallhart kalkulierenden Kapitalisten zu tun, die sämtliche Städte und Regionen daraufhin überprüfen, wie die Bedingungen für ihr Geschäft beschaffen sind. Und in der Frage muss man den Stadtvätern Detroits einige Versäumnisse nachsagen. Denn wenn man schon auf Gedeih und Verderb vom Gelingen des privaten Geschäfts abhängig ist, hätte man dafür sorgen müssen, dass außer den Autoproduzenten noch andere Kapitalisten in Detroit reich werden können. Das haben andere schließlich auch geschafft:
„Es gibt auch weniger traurige Stadtschicksale... Aufstieg ganzer Regionen im Süden ... Amerikas Boomstädte sind nicht besonders heimelig... Aber es gibt sie und Tausende Menschen ziehen jedes Jahr hin.“ (SZ, 22.7.)
Diese Städte sind zwar nicht wohnlich für ihre Bewohner – aber darauf kommt es nicht an. Darin, worauf es ankommt, sind sie vorbildlich: Sie haben dem Kapital gute Bedingungen geboten und das Kapital hat sie nicht ausgeschlagen. Bloß dafür, dass Leute dort leben, ist eine Stadt sowieso nicht da; und bloß dafür, ihre Einwohner mit elementaren Lebensbedingungen zu versorgen, darf man Steuergelder doch nicht verpulvern:
„Erst in den vergangenen Jahren begann man, sich mit dem Unausweichlichen auseinanderzusetzen: Dem Schrumpfen der Stadt. Wie lange, so fragte man sich, will man es sich noch leisten, die wenigen Einsiedler, die dort noch ausharren, mit Wasser und Strom zu versorgen, ihre Kinder von Schulbussen abholen zu lassen und gelegentlich die Polizei vorbeizuschicken? (SZ, 20./21.7)
Damit ist die zentrale Sünde berührt, die sich die Stadtväter Detroits haben zuschulden kommen lassen. Sie haben den falschen Leuten viel zu lang Geld in den Arsch geschoben:
„Das Erbe der guten Taten … Bankrott mit städtischen Schulden von 18 Milliarden Dollar. Darunter sind Verpflichtungen gegenüber den Pensionsfonds der Stadtangestellten von 3,5 Milliarden Dollar und gegenüber der Krankenversicherung der Rentner von 6,4 Milliarden Dollar. ‚Wir können das nicht bezahlen‘, sagte Verwalter Orr. ‚Jeder wusste das seit 20 Jahren, aber niemand wollte das Problem anpacken.‘“ (SZ, 23.7)
Mag sein, dass die ehemaligen Stadtbediensteten bis zur Rente fleißig für die Stadt gearbeitet haben. Mag sein, dass ihre Altersbezüge im amerikanischen Durchschnitt liegen, also keineswegs hoch sind, wie die SZ einräumt. Doch rückblickend weiß man: Pensionen sind kein Teil des vereinbarten Lebenslohns für geleistete Arbeit, sondern eine unverdiente Wohltat, die die Stadtverwaltung sich leichtsinnigerweise in guten Tagen hat abhandeln lassen. Die 18 Milliarden, die die SZ selber den 50 Milliarden gegenüberstellt, die die amerikanische Bundesregierung für die GM-Sanierung übrig hatte, beweisen, dass es keine Alternative dazu gibt, am Lebensunterhalt der alten Leute Abstriche zu machen. Es führt einfach kein Weg daran vorbei, die Stadt von diesen Schulden so weit wie möglich zu entlasten, wenn sie wieder auf die Beine kommen will.
Und genau dafür ist der Konkurs eine Chance, bietet er nach amerikanischem Recht doch die Möglichkeit, solche eingegangenen Verpflichtungen zu revidieren – jedenfalls im Prinzip:
„Der Konkursantrag bedeutet für die Stadt nun nicht etwa das Ende, sondern den Neubeginn, wenn sie die Kraft dazu hat. Wie bei einem normalen Firmenkonkurs ist es das Ziel, in einem geordneten Verfahren die Schulden der Stadt so weit zu reduzieren, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehen kann... Experten stellen die Öffentlichkeit jedoch auf einen jahrelangen Streit vor den Gerichten ein.“ (SZ, 20./21.7.)
Wenn das aber klappt, dann könnte Detroit zu einem richtigen Vorbild werden:
„Wenn am Ende bei den Pensionsfonds eingespart würde, dann wäre das ein Präzedenzfall, der den Bankrott für viele Städte attraktiv mache.“ (SZ, 19.7)
Aber es bleibt ein heftiges Bedenken – nämlich die Schulden, die man bei einer anderen Sorte Gläubiger hat:
„Wird das Tabu jetzt gebrochen und ein Teil der Anleiheschulden gestrichen, fürchten Bürgermeister überall, dass ihre Zinskosten drastisch steigen. Das würde die Krise der öffentlichen Finanzen in Amerika noch weiter verschärfen.“ (SZ, 20./21.7.)
Die Schulden, die Detroit bei dieser Spezies hat, verursachen der Stadt zwar auch immense Kosten für Tilgung und Zins, aber die kann man unmöglich streichen. Diese Sorte Gläubiger muss auf jeden Fall gut behandelt werden, denn nur wenn die gut verdienen, geben sie einer Stadt wie Detroit Kredit. Wenn man Kapital anziehen will, muss man eben alles dafür tun, dass es auch verlässlich verdient.
Ob das Kapital solche Angebote wirklich annimmt, ist natürlich eine andere Frage. Inzwischen weiß man ja: Wenn die SZ auf die Gewinnrechnungen des Finanz- und sonstigen Kapitals zu sprechen kommt, dann gibt es für sie nur Naturgewalten am Horizont:
„Vielleicht ist es ja einfach so, dass die Prärie Detroit einfach wieder schlucken wird, weil es für die Stadt keinen Existenzgrund mehr gibt.“ (SZ, 20./21.7.)