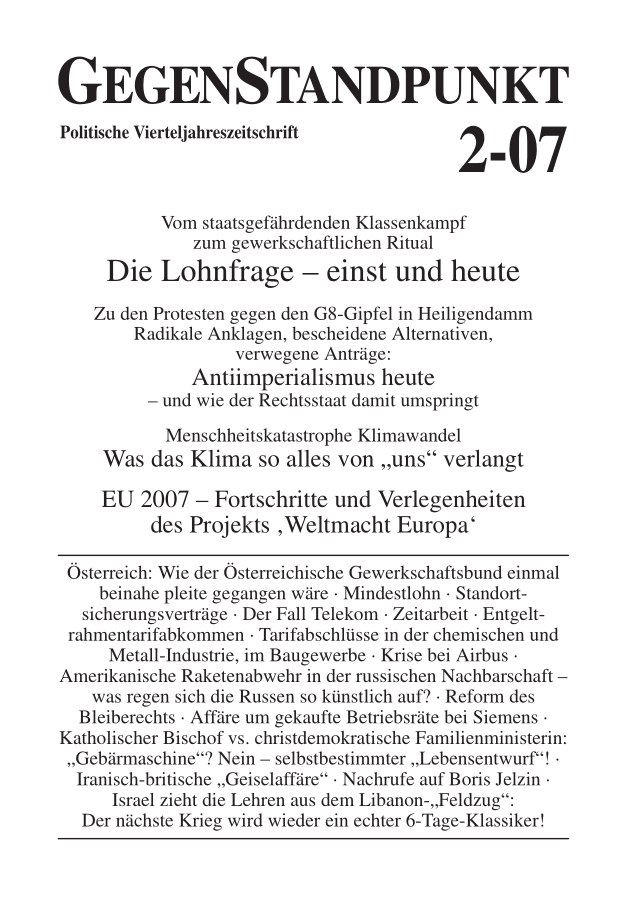Österreich
Wie der Österreichische Gewerkschaftsbund einmal beinahe pleite gegangen wäre
Ein US-Investmenthaus namens Refco hatte bankrott gemacht – und die im Besitz der Gewerkschaft befindliche Bank für Arbeit und Wirtschaft, kurz: Bawag, war in größerem Umfang an selbigem beteiligt gewesen. Doch damit nicht genug. Im Zuge der einsetzenden Nachforschungen – die Bawag hatte jetzt Refco-Gläubiger, die sich an ihr als (Teil-)Eigentümerin und Kreditgeberin von Refco schadlos halten wollten, und infolgedessen US-Behörden am Hals – kam weiter zum Vorschein, dass die Bank einige Jahre zuvor bei Spekulationen, die sie über den Sohn ihres vormaligen Vorstandschefs hatte abwickeln lassen, ungefähr 1,5 Milliarden Euro in den Sand gesetzt hatte. Um der zu jener Zeit drohenden Pleite ihrer Bank zu begegnen, hatten der Gewerkschafts-Boss Verzetnitsch und sein Finanzchef – durchaus sachgerecht unter größtmöglicher Geheimhaltung – das restliche Gewerkschaftsvermögen, bestehend aus diversen Firmen bzw. Beteiligungen und einigen Immobilien, als Sicherheit verpfändet. Damals war die Sache gut gegangen, die Bawag hatte die anderthalb Milliarden mittlerweile verdaut, mittels Gewinnen (natürlich teilweise aus ganz ähnlichen Geschäften) und hilfreichen Bilanztechniken wieder hereingeholt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Österreich
Wie der Österreichische
Gewerkschaftsbund einmal beinahe pleite gegangen
wäre
(Ia) Über Jahrzehnte hinweg war der ÖGB eine besonders erfolgreiche Gewerkschaft. Noch vor Kriegsende 1945 gegründet und mit US-Unterstützung und -Mitteln aufgezogen, durfte er sich von Beginn an um den „Wiederaufbau Österreichs“ verdient machen.[1] Die sozialpartnerschaftliche Organisation der für Kapital und Nation ertragreichen Benutzung der arbeitenden Bevölkerung – ein in Westeuropa in jener Zeit weit herum geschätztes Verfahren – sah in ihrer Ex-Ostmärkischen Variante etliches an Posten und Einfluss vor. Die in nationale Regie übernommene Grundstoffindustrie wurde in Form des Verstaatlichtenministeriums der Gewerkschaft überantwortet und hieß entsprechend über viele Jahre im Volksmund nach dem zuständigen ÖGB- und Regierungsfunktionär „Waldbrunner-Reich“; in allerlei staatlichen Kommissionen – „von Abfallwirtschaft bis Zivildienst“, wie ÖGBler stolz zu verkünden wussten – saßen Arbeitervertreter gemeinsam mit ihren Gegenübern von der Unternehmerschaft und erstellten gemeinschaftlich in Gutachten und Gesetzesvorlagen Handreichungen für die Interessen der Republik; und 15 Jahre lang, gewissermaßen als krönender Abschluss der Anerkennung seiner staatspolitisch tragenden Rolle, durfte der Präsident des ÖGB zugleich dem österreichischen Parlament in derselben Funktion vorsitzen.
Mit dem ab 1986 von der SPÖ/ÖVP-Regierung verfolgten – und vom ÖGB vorbehaltlos mitgetragenen – Programm eines EWR-/EU-Beitritts und der darin mitbeschlossenen Öffnung des Landes für internationales Kapital reduzierte sich auch Stück um Stück die Bedeutung der Gewerkschaft,[2] und die Sozialpartnerschaft geriet zusehends in den Verruf einer überlebten und unnötigen „Nebenregierung“. Dennoch: Auf das Amt des Sozialministers hatte der ÖGB noch bis ins Jahr 2 000 und dem Beginn der Schüssel/Haider-Regierung unumstritten Anspruch. Und der Mann an der Spitze, Fritz Verzetnitsch, war Mitglied des Nationalrats, des Parteipräsidiums der SPÖ und – Erfolg verpflichtet – zehn Jahre Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes.
(Ib) Für die von und in der Gewerkschaft Organisierten stellten sich diese Erfolge ihrer Vertretung ein wenig anders dar. Bis zur Eroberung des ehemaligen Ostblocks durch westliches – vermehrt auch, wie regelmäßig begeistert verlautbart wird, österreichisches – Kapital galt Österreich als Niedriglohnland. Daran hat sich zwar nichts geändert – offiziellen Berechnungen zufolge lagen die Reallöhne des Jahres 2006 auf dem Niveau von 1993. Gar nicht weit entfernt ist die Arbeitskraft nur eben noch billiger zu haben – was wiederum für den österreichischen Arbeitsmarkt sowie den politischen und kulturellen Überbau nicht ohne Folgen bleibt. Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen wachsen, ganz wie es im Lehrbuch steht, jahrein jahraus. (Stolz verkündete unlängst die scheidende Frauenministerin, dass bereits 64,7 % aller erwerbsfähigen Frauen sich regelmäßig der Realisation dieser ihrer Fähigkeit widmen – Tendenz weiter steigend.) Auch die öffentlich nachgezählte „Armutsgefährdung“ nimmt beständig zu: Über 13 % der österreichischen Bevölkerung gelten als bedürftig – und mit geheucheltem Erstaunen wird registriert, dass dies bei einer wachsenden Anzahl „trotz“ Berufstätigkeit der Fall ist.[3] Die Verstaatlichte Industrie ist längst weitgehend privatisiert, die Arbeitsmannschaft auf die Hälfte bis ein Drittel runterrationalisiert – was dem Land auf Jahre hinaus ein öffentliches Beschwerdewesen über die hohe Anzahl von Frührentnern eingetragen hat, die sich mit ihren Niedrig- und Mindestpensionen angeblich ein fideles Leben „auf unsere Kosten“ machen. Und damit „österreichische Arbeitsplätze weiter sicher bleiben“, lässt sich der ÖGB auch derzeit in Sachen gewinnabhängiger Lohn und Ausdehnung der Normalarbeitszeit wieder allerlei zu Gunsten „unserer Wettbewerbsfähigkeit“ einleuchten.[4]
Dennoch: Die große Masse der österreichischen Arbeiterschaft hielt und hält ihrer Gewerkschaft die Treue. Die staatlich ins Recht gesetzte Organisation der Lohnabhängigkeit verhalf dem ÖGB stets zu hervorragenden Mitgliederzahlen: Noch immer entrichten über 40 % der unselbstständig Beschäftigten freiwillig ihren festgesetzten Monatsbeitrag an die Gewerkschaftskasse. Zusätzlich zu dem Lohnteil, den per Gesetz die Zwangskörperschaft Arbeiterkammer einbehält.
(II) Mit einem Schlag, vor etwas über einem Jahr, schien es vorbei mit der schönen Zeit, der ÖGB geriet in seine bisher schwerste Krise. Überall wurden Nachrufe auf ihn publiziert. Eine Austrittswelle setzte ein, der langjährige Präsident wurde davon gejagt und befindet sich seither mit seinem eigenen Verein vor Gericht. Was war passiert? Eine Lohnrunde noch niedriger abgeschlossen als sonst? Eine Entlassungswelle nicht verhindert? Der Wirtschaftskammer die Freundschaft aufgekündigt? Nichts dergleichen.
Ein US-Investmenthaus namens Refco hatte bankrott gemacht [5] – und es stellte sich nach und nach heraus, dass die im Besitz der Gewerkschaft befindliche Bank für Arbeit und Wirtschaft, kurz: Bawag, in größerem Umfang (über allerlei im steuerschonenden Ausland domizilierte Stiftungen) an selbigem beteiligt gewesen war. Doch damit nicht genug. Im Zuge der einsetzenden Nachforschungen – die Bawag hatte jetzt Refco-Gläubiger, die sich an ihr als (Teil-)Eigentümerin und Kreditgeberin von Refco schadlos halten wollten, und infolgedessen US-Behörden am Hals – kam weiter zum Vorschein, dass die Bank einige Jahre zuvor bei Spekulationen, die sie über den Sohn ihres vormaligen Vorstandschefs hatte abwickeln lassen,[6] ungefähr 1,5 Milliarden Euro in den Sand gesetzt hatte. Um der zu jener Zeit drohenden Pleite ihrer Bank zu begegnen, hatten der Gewerkschafts-Verzetnitsch und sein Finanzchef – durchaus sachgerecht unter größtmöglicher Geheimhaltung – das restliche Gewerkschaftsvermögen, bestehend aus diversen Firmen bzw. Beteiligungen und einigen Immobilien, als Sicherheit verpfändet. Damals war die Sache gut gegangen, die Bawag hatte die anderthalb Milliarden mittlerweile verdaut, mittels Gewinnen (natürlich teilweise aus ganz ähnlichen Geschäften) und hilfreichen Bilanztechniken wieder hereingeholt.
Jetzt aber war der Skandal da. Laut übereinstimmender
Meinung der gesamten in- und ausländischen Öffentlichkeit
der größte Wirtschaftsskandal der 2. Republik
.
Nicht nur wurde die bei jedem misslungenen Geschäft
bedeutenderen Ausmaßes übliche Lüge ausgebreitet, dass
hier dem Land, dem Steuerzahler, dem Share-, Stake- oder
sonstigen Holder, kurzum uns allen, aus Gier, Unfähigkeit
und anderen Charakterschwächen mit vollkommen
marktwidrigem Verhalten gänzlich unnötigerweise ein
Schaden beschert worden sei. Zu dieser regelmäßig, eben
bei den notwendig stets wiederkehrenden Anlässen,
gepflegten Propaganda vom Anrecht auf Erfolg in
der Konkurrenz gesellte sich die in- und extensiv
betriebene Hetze, dass die ganzen Malversationen ihren
Grund darin hätten, dass es sich bei der Bank um eine
Gewerkschaftsbank handele. Weitgehend ungerührt
von den Tatsachen, dass a) zur selben Zeit ein Kärntner
Kreditinstitut gerade einen, relativ zur Größe der Bank,
viel umfänglicheren Schaden hingelegt hatte und b) die
Bawag Jahrzehnte lang durchaus normal erfolgreich ihr
Ausleih- und Spekulationsgeschäft betrieben und es damit
immerhin zum viertgrößten Finanzinstitut zwischen Bregenz
und Graz gebracht hatte, wusste landauf landab jede
meinungsbildende Instanz zu vermelden, dass eine Bank in
der Hand von Gewerkschaftern sich nun mal nicht gehöre.
Der aufgrund der Forderungen der geschädigten Refco-Gläubiger drohende Zusammenbruch der Bawag [7] ebenso wie die nun aufgeflogenen, verpfuschten „Karibik“-Deals der vergangenen Jahre wären nach allseitiger Auffassung zu vermeiden gewesen, hätten nicht „überforderte Gewerkschaftsbonzen“ sich angemaßt, ein derart grundlegendes und höchste Seriosität verlangendes Unternehmen wie eine Bank zu führen. Völlig „gewissenlos“ hätten diese Emporkömmlinge aus der Arbeiterschaft dem Finanzplatz Österreich Schaden zugefügt und – der Gipfel der Ruchlosigkeit – die Streikgelder der armen, rechtschaffenen Gewerkschaftsmitglieder verzockt.
Die ganze Republik war plötzlich voll von bekennenden
Freunden der werktätigen Bevölkerung, in deren Namen die
Gewerkschaft als leibhaftiger Verstoß gegen die
Sachwalterschaft gerechter proletarischer Interessen
gegeißelt wurde. Notorische Anhänger der Idee und
Durchführung von Kampfmaßnahmen zur Verbesserung von
Arbeitsbedingungen, wie etwa das österreichische
Zentralorgan „Die Presse“, die sich nur wenige Tage
später an selber Stelle darüber ausließ, dass der
Kündigungsschutz der „Arbeitsplatzkiller“ und insofern
Ruin Europas sei, sahen sich etwa genötigt, sich mit
folgender „Frage“ zu Gehör zu bringen: So wird sich
vor allem ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch die Frage
gefallen lassen müssen, ob er noch ganz bei Trost gewesen
ist, die Streikfähigkeit der österreichischen
Arbeiterschaft im Alleingang für die Rettung der Bawag
aufs Spiel zu setzen.
(Presse-Leitartikel 25.3.06.)
Und noch eine „Frage“ mussten sich Verzetnitsch und einige andere aus ÖGB und Bawag von der sich aufs immer Neue aufputschenden Öffentlichkeit gefallen lassen – und zwar dauerhaft und anhaltend: Wie sie dazu kämen, und zu welchem Preis bitteschön, in Dachterrassen-Wohnungen in einer der besseren Lagen Wiens zu logieren. „Penthouse-Sozialismus“ wurde zu einem der beliebtesten Wörter im österreichischen Sprachraum – als Kennzeichnung der notwendigen menschlich allzu menschlichen Korruptheit von Arbeitervertretern einerseits und als offenherzige Auskunft darüber andererseits, welche Art von Behausungen Proleten und deswegen auch ihren Vertretern eben nicht zusteht.
(III) Der ÖGB tat, wie ihm geheißen: Er schämte sich. Tatkräftig angeleitet von der Regierung ließ er sich einleuchten, dass seine Finanzkrise zugleich eine moralische sei, dass ihm also zurecht von allen Seiten das Vertrauen aufgekündigt werde. Die Schüssel-Regierung wiederum trug nach Kräften dazu bei, den Schaden für die Gewerkschaft möglichst groß ausfallen zu lassen. Eine solche Gelegenheit, öffentlich vorzuführen, dass die gewerkschaftlichen „Betonköpfe“ und „Bremser“ dem reformfreudigen Kapitalstandort in der Mitte Europas nicht im Weg stehen dürfen (wie etwa drei Jahre zuvor, wo der ÖGB erstmals in seiner Geschichte für einen ganzen Tag zum „Generalstreik“ aufgerufen hatte für den – vergeblichen – Versuch, von der Regierung zu Konsultationen über die nationale Rentenreform eingeladen zu werden), lässt man sich schließlich nicht entgehen – noch dazu dann, wenn demnächst Wahlen vor der Tür stehen, sich damit also gleichzeitig die sozialdemokratische Konkurrenz desavouieren lässt.
Die Parole Rote können nicht wirtschaften
wurde
also flächendeckend ausgegeben – und fast hätte der
Kanzler den Bogen überspannt, als er öffentlich darüber
räsonierte, dass der Gewerkschaftsbank „das Wasser sehr,
sehr hoch“ stehe. Tatsächlich begannen daraufhin
Kundengelder in größerem Umfang von der Bawag abgezogen
zu werden, und da von allen Seiten Einigkeit darüber
bestand, dass „das Ansehen des Bankenplatzes Österreich“
vor allem anderen Vorrang haben müsse, kamen Gewerkschaft
und Regierung überein, einen „gemeinsamen Rettungspakt“
zu schließen.
Dieser fiel, wenig überraschend, ziemlich einseitig aus, es ging ja um das Interesse der Nation. Die Republik Österreich erklärte, für die (zu dem Zeitpunkt noch nicht in voller Höhe feststehenden) Verbindlichkeiten der Bawag geradezustehen, sofern die Gewerkschaft als Eigentümerin sich hierzu nicht in der Lage befände. Im Gegenzug zu dieser Haftungserklärung, die – erwartungsgemäß – sofort den Run auf die Bawag-Konten zum Stillstand brachte, verpflichtete sich der ÖGB a) die Anteile der Bawag an der Nationalbank, die sie aus den Gründungszeiten der Republik als Ausweis ihrer staatstragenden Rolle noch immer bei sich führte, für einen Pappenstiel an die Nationalbank zurückzuverkaufen; b) die Bawag selbst binnen anderthalb Jahren zu veräußern;[8] und c) seine Bücher offen zu legen, damit endlich für jedermann ersichtlich werde, wie es um die gewerkschaftlichen Vermögensverhältnisse bestellt ist.
Das in der österreichischen Öffentlichkeit mit ein wenig Erstaunen und sehr viel Häme registrierte Ergebnis von c) lautete: Schlecht. Der wesentliche Vermögensposten des ÖGB war in der Tat seine Bank. Und mit der unabweisbaren Verpflichtung – es mussten schließlich nicht nur die Regierungsforderung, sondern auch der Refco-Vergleich (plus, wie sich herausstellte, noch einige Alt-Schulden) bedient werden –, diese zu verkaufen, war klar, dass für den ÖGB in finanzieller Hinsicht die besten Zeiten vorbei sein würden. Immerhin 25 % des ÖGB-Budgets kamen in den letzten Jahren per Dividende von der Bawag rein. Damit war es nun aus, Sparen war angesagt.
Und nicht nur das. Der „größten Glaubwürdigkeitskrise in unserer Geschichte“ (Verzetnitsch-Nachfolger Hundstorfer) mussten dringend Vertrauen stiftende Maßnahmen entgegengesetzt werden. Als erste entließ der Nachfolger den Vorgänger fristlos und erklärte dessen Pensionsansprüche für ungültig.[9] Eine komplette vereinsmäßige „Neu-Gründung“ des ÖGB wurde in Angriff genommen – dann aber wieder abgeblasen, als klar wurde, dass man in dem Fall sämtliche Mitglieder neu würde werben müssen. Das erschien allen zu teuer und zu riskant. Stattdessen wurde als Nächstes eine Mitgliederbefragung angesetzt und in einer wochenlangen Kampagne beworben. Sie ergab, dass die große Mehrheit der 5 % der Gewerkschaftsmitglieder, die die Fragebögen ausfüllten, die Vorschläge ihrer Führung befürwortete: mehr Transparenz, mehr Mitsprache, mehr Frauen in den transparenteren und mitbesprochenen Führungsfunktionen und Gehaltsobergrenzen für Funktionäre. Generell wurde angenommen, dass die anderen 95 % es genau so sahen.
Mit den Gehaltsobergrenzen war zugleich auch dem ersten Bedürfnis Rechnung getragen, dem Sparen. Das Sparpotenzial war aber natürlich noch größer. Die alte Führung – schon wieder! – habe versäumt und aufgeschoben, was nun, leider, unvermeidlich sei: Rationalisierungen durch „Zusammenlegung von Aufgabenbereichen“, Personalreduktion durch „Ausnützung der natürlichen Fluktuation“ und – ganz ohne Gerichtstermine, weil eine freiwillige betriebliche Leistung, die laut Gesetz bei „Gefährdung des Unternehmens“ von diesem rückgängig gemacht werden darf – eine vollständige Streichung der Betriebspensionen für 1200 ÖGB-Angestellte zugunsten einer „überschaubaren Einmalzahlung“.
(IV) Einen schweren Schlag musste der
ÖGB auch von der SPÖ einstecken. Angesichts einer
drohenden Niederlage bei den bevorstehenden Wahlen
einerseits und des schon länger existierenden
Bedürfnisses, auch in der österreichischen
Sozialdemokratie eine klare Trennung zwischen Politik und
proletarischer Standesvertretung zu vollziehen,
andererseits, gab die Parteiführung bekannt, keine
hochrangigen Gewerkschaftsfunktionäre in ihr
Parlamentsteam aufnehmen zu wollen. Diese hätten, so
SP-Chef Gusenbauer, genug damit zu tun, ihren
Gewerkschaftsladen zu sanieren; seine Empfehlung laute,
das Vertrauen der Österreicher und Österreicherinnen
durch gute Arbeit für Österreich zurück zu
gewinnen
.[10]
Daran arbeitet der ÖGB vor wie nach. Die Lohnabschlüsse wurden und werden mit dem bewährten „Augenmaß“ getroffen. Die jüngst von ihm abgesegnete gesetzliche Ausdehnung der täglichen Normalarbeitszeit auf 10 Stunden sowie die fast schrankenlose Freigabe von 12-Stunden-Schichten trügen den veränderten Bedingungen in der globalisierten Arbeitswelt Rechnung, seien aber keineswegs als vollständige Abschaffung des 8-Stunden-Tages zu verstehen – schließlich sei es ja physisch gar nicht möglich, dauerhaft 10 und mehr Stunden zu arbeiten, so die Kommentare der ÖGB-Führung, die zugleich stolz darauf verweist, mit den neuen Definitionen der maximalen Arbeitszeit bei Teilzeitarbeit „endlich“ die Basis für mögliche Überstundenzuschläge geschaffen zu haben.
Seine Bank hat der ÖGB mittlerweile verkauft. Bestbieter war ein „Konsortium“, an dem ein früherer SPÖ-Finanzminister beteiligt ist, das im Wesentlichen aber aus dem von einem ehemaligen US-Finanzminister geführten Hedgefonds Cerberus besteht.[11] Auch hier war natürlich für Häme gesorgt: Dass die Gewerkschaft sich von einer Heuschrecke aus ihrem Finanzsumpf ziehen lassen müsse, sage doch wohl endgültig alles! Noch einmal solle sie herumkritteln an Globalisierung, liberalen Finanzmärkten ...
Die 3,2 Mrd. Euro, die Cerberus & Co. an den ÖGB überweisen, gehen allen Verlautbarungen zufolge komplett für die Tilgung von dessen Schulden drauf. „Sollte am Ende des Tages ein Euro übrig bleiben, dann sind wir glücklich“, ließ sich ÖGB-Chef Hundstorfer zitieren. Die ÖGB-Mitglieder werden da sicher mitfühlen, denen geht es öfter so.
[1] Der
Gewerkschaftsbund ist in der Verfolgung seines Zwecks
zu einem kraftvollen Mitwirken am Aufbau Österreichs,
zur Wahrung der Unabhängigkeit und Neutralität unseres
Landes, zur Bekämpfung des Faschismus, jeder Reaktion
und aller totalitären Bestrebungen, zur Mitarbeit an
der Sicherheit des Weltfriedens sowie zum unentwegten
Kampf zur Hebung des Lebensstandards der Arbeitnehmer
Österreichs berufen.
– So hat es sich der ÖGB in
seine Statuten hineingeschrieben. Und angesichts der
fast vollständigen Aufzählung aller staatspolitisch
bedeutsamen Titel, zu denen sich die österreichische
Nation zwischen Staatsvertrag und EU-Beitritt bekannt
hat, sowie der gebührenden Stelle und
Perspektive, die seine Mitglieder hier zugeordnet
bekommen, hat man ihm von kompetenter Seite stets gerne
seine Selbstüberschätzung ein wenig nachgesehen.
[2] 1992 wurde der
Preisunterausschuss durch einen Unterausschuss für
Fragen des Wettbewerbs ersetzt. Die durch die
europäische Integration und andere Faktoren verstärkte
internationale Wirtschaftsverflechtung hatte eine auf
Österreich bezogene freiwillige Preiskontrolle sinnlos
gemacht.
(A. Pelinka / S.
Rosenberger: Österreichische Politik. Grundlagen,
Strukturen, Trends, Wien 2002, S. 195.) Die
„freiwillige Preiskontrolle“ der Sozialpartner hatte
immerhin über 40 Jahre lang den Rahmen für sämtliche
für die Nation als wesentlich erachteten Preise, i.e.
Konkurrenzbedingungen, bis zu demjenigen der täglichen
Semmel aus der Backstube vorgegeben. Die Redeweise von
einem „Ersatz“ durch einen „Ausschuss für Fragen des
Wettbewerbs“ ist folglich mehr als schönfärberisch.
[3] In gebildeten Kreisen hat sich hierfür, allerorten, idiotischerweise der Ausdruck „working poor“ durchgesetzt – so als sei nicht Armut notwendigerweise bleibende Voraussetzung und Resultat von ‚work‘ fürs Kapital.
[4] Erstmals flexible
Löhne laut Kollektivvertrag – Die Metaller einigen sich
auf 2,6 % mehr Lohn und eine gewinnabhängige
Einmalzahlung.
(Presse,
4.11.06)
Die Kollektivvertragsverhandler können künftig eine
höhere Maximalarbeitszeit von bis zu zwölf Stunden
täglich und 60 Stunden in der Woche vereinbaren.
Allerdings muss es nach acht Wochen Ausnützung der
Höchstarbeitszeit eine Pause von zwei Wochen geben, in
denen die Normalarbeitszeit nicht überschritten werden
darf. Die Kollektivvertragspartner werden auch
ermächtigt, die Normalarbeitszeit auf bis zu zehn
Stunden täglich anzuheben.
(Berichtet der Kurier vom 3.5.2007 – und
vermeldet „Breites Lob für Sozialpartner“.)
[5] Über Tempo und Willkürlichkeit dessen, wie sich kapitalistischer Reichtum in Luft auflösen kann, gibt ein Artikel aus jener Zeit beredt Auskunft:
„Noch vor einer Woche war Refco einer der größten Futures- und Commodities-Broker der Welt mit 2.400 Mitarbeitern, über 200 000 Kundenkonten in 14 Ländern und einem Marktwert von 3,6 Mrd. $ – nach einem höchst erfolgreichen Börsengang im August dieses Jahres. Jetzt, eine Woche später, ist von Refco nicht mehr viel übrig ...
Zwei Dinge sind an dem Vorgang besonders auffällig: Erstens die Geschwindigkeit, mit der sich der Zusammenbruch vollzog; zweitens die beunruhigende Wahrheit, dass, zumindest nach bisherigem Erkenntnisstand, absolut nichts bei Refco fundamental im Argen lag. Refcos operatives Geschäft und seine Finanzen waren zu Anfang dieser Woche noch genau so gesund wie zum Zeitpunkt des Börsengangs im vergangenen Sommer. Das Einzige, was sich im Laufe der Woche geändert hat, ist die Tatsache, dass sich herausgestellt hat, dass eine 430 Mio.-$-Forderung Refcos nicht, wie bislang angenommen, von einem Hedge-Fonds Refco geschuldet wurde, sondern von Refcos Chief Executive Phillip Bennett. Am Montag hat Bennett diese Schuld beglichen – inkl. Zinsen. Die finanzielle Situation Refcos war also am Montag besser, als sie am Freitag zuvor gewesen war. Das Problem war, dass die Erklärung, die Refco am Montag abgab, viele Fragen offen ließ. Und in Ermangelung der Antworten befürchtete die Außenwelt das Schlimmste. ... ‚Es war wie ein echter, alter Run auf eine Bank‘, sagte ein Beobachter. ...“ (Financial Times 15.10.05 – Eigene Übersetzung)
[6] Auch der Banker-Spross, via Elite-Uni Harvard in den USA zu Ansehen und Vermögen gekommen und in die Eisenhower-Familie eingeheiratet, hatte seine Fonds bevorzugt in „Offshore-Steuerparadiesen“ angesiedelt. Daher dann die in der Öffentlichkeit populär gewordene Bezeichnung „Karibik-Geschäfte“ für die recht gängigen, halt dummerweise – auf seiner Seite – schief gegangenen Währungsswaps und anderen Termingeschäfte.
[7] Der Vorwurf lautete auf Beihilfe zum Bilanzbetrug und belief sich letztlich auf eine – per Vergleich erzielte – Summe von 530 Millionen Euro. – Dass diese 530 Mio. weniger als 3 % der bei der Bawag veranlagten Kundengelder (im Bankerdeutsch „Primärmittelaufkommen“) in Höhe von 18 Milliarden Euro ausmachten, mit denen die Bank täglich ihre Geschäfte vollzog, und zugleich ihre Eigenkapitalausstattung, also ihre Fähigkeit, derartige Forderungen zu erfüllen, deutlich überstiegen, wollte übrigens niemandem als bemerkenswerter Hinweis auf die Solidität des Bankwesens im Allgemeinen auffallen.
[8] Eine Maßnahme, über die die Bawag-Führung selbst nicht unglücklich war, da sie schon länger die Auffassung vertrat, dass die Bank zwecks Ausweitung des Geschäfts, insbesondere, wie ja bereits die anderen österreichischen Großbanken erfolgreich vorexerziert hatten, in Richtung Osten, zumindest qua Beteiligung, eines „strategischen Investors“ bedürfe.
[9] Beim Mitglieder-Service freilich lässt sich der ÖGB nicht lumpen: Die Anwaltskosten des ÖGB-Mitglieds Verzetnitsch vor dem Arbeitsgericht trägt der ÖGB.
[10] Als die Wahlniederlage dann ausblieb, war die Freude auf beiden Seiten groß. Einige führende Gewerkschaftsfunktionäre wurden kurzzeitig sogar doch wieder als „ministrabel“ gehandelt, gingen aber im Resultat alle leer aus.
[11] Dessen erste öffentlichkeitswirksame Maßnahme war die Verfügung der Schließung der Bawag-Konten der in Österreich lebenden kubanischen Staatsbürger. Diese Maßnahme wurde allerdings eine Woche später wieder rückgängig gemacht. Die EU-Kommission hatte klargestellt, dass das zur Anwendung gekommene Helms-Burton-Gesetz in Europa keine Geltung habe.