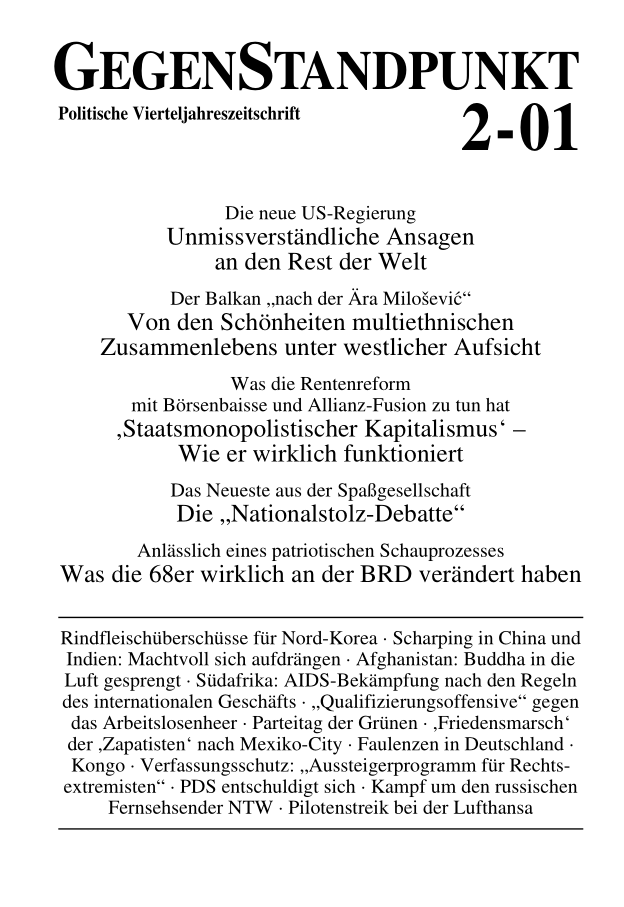Der Balkan „nach der Ära Milosevic“
Von den Schönheiten des multiethnischen Zusammenlebens unter endlich unbehelligter westlicher Aufsicht
Slobodan Milosevic, nach westlicher Lesart der Schuldige an dem 10-jährigen Balkan-Bürgerkrieg, ist nicht mehr an der Macht. Dem Frieden auf dem Balkan ist das mitnichten förderlich: Die vom Westen erzwungenen „multiethnischen Zivilgesellschaften“ (Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro) werden von den Beteiligten abgelehnt. Die Verhaftung des ehemaligen demokratisch gewählten Staatsoberhaupts in Serbien ist eine Bringschuld der neuen, hinsichtlich ihrer Funktionalität bewerteten Regierung; eine Auslieferung an das Haager Kriegsverbrechertribunal wird vom Westen erwartet.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Bosnien-Herzegowina: Klein-Kroatien zieht aus
- Kosovo: Für albanische Kosovaren entschieden zu klein
- Mazedonien: „Stabilisierung“ einer Bürgerkriegslage durch „Anbindung an Europa“
- Montenegro: Keine Einsicht in die Grenzen der eigenen Eigenstaatlichkeit
- Und noch ein letztes Mal: Das Stabilitätshindernis Milošević wird beseitigt
Der Balkan „nach der Ära
Milošević“
Von den Schönheiten des
multiethnischen Zusammenlebens unter endlich
unbehelligter westlicher Aufsicht
Seit mehr als einem halben Jahr ist der personifizierte Unruheherd Slobodan Milošević aus dem politischen Verkehr gezogen. Nach der hierzulande einhellig gültigen Auffassung war der Mann für alles Ungeheuerliche verantwortlich, das sich in den letzten zehn Jahren auf dem Boden seines geerbten Vielvölkerstaats abgespielt hat: Seine großserbischen Herrschaftsgelüste waren es, die auf dem Balkan die Völker so gründlich entzweiten, dass sie gegeneinander Krieg führten; seine ethnischen Säuberungskriege waren es, die Jugoslawien zerlegten. Die verlor er zwar, einen nach dem anderen. Seine Niederlagen vermochten ihn aber nur immer zur nächsten seiner verbrecherischen Taten zu bewegen. Völkermord, Massaker und KZ: Das waren und blieben die untrüglichen Merkmale seiner Regentschaft auch dann noch, als sich – dank des ersten tatkräftigen Engagements der westlichen Hüter des Menschenrechts – seine Diktatur nur noch auf ein kleines serbisches Restjugoslawien erstreckte. Doch da unterdrückte er die letzte Ethnie, die er noch unterdrücken konnte, nur umso mehr. Erst als ihm der westliche Werteverein auch im Kosovo in den Arm fiel und den letzten Rest einer serbischen Macht zerschlug, gab er nach, blieb aber freilich auch nach seinem letzten verlorenen Krieg in seinem Amt kleben. So waren die Albaner im Kosovo nur einstweilen vor ihm in Sicherheit. Denn solange dieser Gewaltherrscher, Kommunist und verbohrter Nationalist, sich in Belgrad verschanzt hielt, drohte die Region nach wie vor Opfer der stabilitätszersetzenden Machenschaften zu werden, die von diesem Mann einfach nicht wegzudenken sind und unter denen die Völker in Jugoslawien so furchtbar zu leiden hatten…
Nun also ist er abgeräumt, mit ihm auch das letzte große
Hindernis für Frieden und Stabilität in den ehemaligen
südslawischen Gebieten – und es stellt sich heraus, dass
trotz der ruhmreich vollbrachten jugoslawischen Wende
zur Demokratie
von beiden dieser hohen politischen
Güter weniger denn je in Sicht ist. Auch dort, wo die
Region schon seit geraumer Zeit westlicher Aufsicht und
Kontrolle untersteht, regt sich derselbe völkische
Aufruhr, dessen Befriedung nur immer dieser Milošević im
Wege gestanden haben soll. Der westlichen Moritat vom
großserbischen Verbrecher, der praktisch im Alleingang
den ganzen Balkan erst ethnisch aufgewühlt und dann
zersägt hat, tut das allerdings keinen Abbruch –
der hat, so will es die Legende, schließlich
dieses Gift des Nationalismus
überhaupt erst
gesät, das nach Auffassung des deutschen Außenministers
leider immer noch das friedliche Zusammenleben der
Völker verhindert
. Es ist nur so, dass auch dieses
Bedauern zur demokratischen Legendenbildung gehört, mit
der die Nachwehen einer zwar perfekt wahrgenommenen,
dennoch einfach nicht gelingen wollenden politischen
Ordnungsaufsicht über den Balkan schöngefärbt werden.
Völker bloß mit Gewalt
zum Zusammenleben
zwingen
: Genau das, was der Westen Titos
Vielvölkergefängnis übelgenommen und tätig mit zerstört
hat, das will er in zerstückelten Formen unter seiner
Ägide restaurieren. Dieselben völkischen
Selbstbestimmungsrechte, zu deren Anwalt er sich gemacht
hat, will er mit seinem Kommando zusammenschweißen – und
diesen Widerruf ihrer Rechte lassen sich die Völker nicht
unbedingt als die Emanzipation einleuchten, die ihnen
vorschwebt.
Bosnien-Herzegowina: Klein-Kroatien zieht aus
Seitdem die NATO aus Bosnien ein eigenständiges
politisches Gebilde verfertigt und es einem Hohen
Repräsentanten der Staatengemeinschaft, dem feschen Herrn
Petritsch, zur Aufsicht überstellt hat, gibt es auf dem
Balkan ein Staatswesen der ganz besonderen Art. Auf
seinem Boden leben drei Volksgruppen neben- und
gegeneinander, die von ihren staatsgründungsgeilen
politischen Häuptlingen bis neulich noch in Bürgerkriege
um möglichst viel ethnisch gesäubertes
Gelände
gehetzt worden sind und weiterhin dazu ermuntert werden,
sich so großräumig wie machbar und dabei strikt nach
Volkstum gegeneinander abzugrenzen – und die zugleich von
den westlichen Aufsichtsmächten mit aller Gewalt daran
gehindert werden, sich so voneinander zu scheiden, wie es
für das alte Jugoslawien als ganzes allgemein für
vernünftig und gerecht befunden und als zukunftsweisende
Lösung für alle bis dahin bloß unterdrückten
Volkstumskonflikte durchgesetzt worden ist. Die
politischen Führer vor Ort werden unerbittlich mit dem
großherzigen Angebot konfrontiert, ihre selbstdefinierten
Staatsgründungsambitionen zu vergessen und sich statt
dessen lieber für die Gründung und Konsolidierung eines
anderen Staatswesens zu engagieren, das die serbische und
die kroatische Seite überhaupt nicht und die
bosnisch-muslimische zumindest so nicht haben
will – so als dürfte es ausgerechnet bei der Ausgründung
ethnisch definierter Kleinstaaten aus der Leiche des
alten Tito-Staats heraus ausgerechnet für die
Volkshelden, die diese Projekte betreiben, im Fall
Bosnien-Herzegowina auf den völkischen und räumlichen
Zuschnitt ihres kämpferisch angestrebten
Herrschaftsgebiets nicht ankommen, und als bräuchte es
das in dem Fall auch gar nicht. Und die Völker werden von
ihren freiheitlich-demokratischen Oberaufsehern ebenso
strikt dazu angehalten, ihren Untertanen-Standpunkt auf
gar keinen Fall aufzugeben, die Bereitschaft zur
Selbstaufgabe für ein neues Vaterland, die sie in den
abgelaufenen Kriegen hinlänglich unter Beweis gestellt
haben, durchaus und unbedingt beizubehalten; „nur“ auf
ein anderes Vaterland als das dasjenige, für das
sie sich geopfert haben und dem ihre patriotische
Anhänglichkeit gilt, nämlich auf das vom Westen
installierte Bosnien-Herzegowina soll ihre
volkstümlich-unterwürfige Parteilichkeit sich bornieren –
so als wäre es ausgerechnet bei den Hinterbliebenen eines
Bürgerkriegs schon ganz egal, welchem Staat
deren Loyalität gilt; als bräuchte deren Vaterlandsliebe
und Volkstumsstolz nur ein bisschen Mäßigung, um das
Hassobjekt von gestern als neue Heimat ins Herz zu
schließen; als könnte man dem balkanischen Menschenschlag
ganz gut zumuten, Politikern zu gehorchen, die gestern
noch die Vertreibung, ersatzweise die Ausrottung der
eigenen „Ethnie“ betrieben haben oder zumindest ein
Volkstum repräsentieren, das sich dafür hergegeben hat.
Dabei leistet sich die den Atlantik überspannende
Aufsichtsmacht sogar noch einen feinen Scherz: Der
Unversöhnlichkeit der drei Staatswillen, die nach ihrem
Dekret in einem einzigen gesamtbosnischen aufgehen
sollen, dies aber nicht wollen, trägt sie Rechnung, indem
sie ihr ein Stück weit nachgibt – allerdings nur
bedingt und nur halb: Damit die
politische Einheit, die er will, überhaupt ins
Dasein tritt, spaltet der Westen sie in zwei
Unter-Entitäten
auf, setzt in Gestalt einer
serbischen Republik Bosnien
und einer
muslimisch-kroatischen Föderation
die von ihm
gewaltsam sistierten völkischen Staatgründungswillen
bedingt ins Recht, um sie ausgerechnet so zu
befrieden – ein zynisches Entgegenkommen, das er
mit der Konstruktion einer „Föderation“ zwischen Bosniern
und Kroaten diesen beiden Völkerschaften und
deren Häuptlingen – oder jedenfalls der auf
Anschluss ans größere Haupt-Vaterland erpichten
kroatischen Seite – verweigert, als wäre
da das Zugeständnis einer halben Autonomie
wieder der erste Schritt zur Abspaltung, die man nicht
will, und doch kein Kitt fürs Zusammenbleiben! Es ist
schon bemerkenswert, wie generös und unbefangen da
regierende Nationalisten von außen mit dem Recht der
stärkeren Gewalt daherkommen und den
Staatsgründungswillen, den sie bei den
Ex-Bürgerkriegsparteien antreffen, nicht einmal bloß
stoppen, sondern gegen dessen eigene
Stoßrichtung für ihr Projekt in Anspruch nehmen,
ihn für sich zu funktionalisieren und zwangsweise quasi
umzuprogrammieren versuchen: Gemäß den Bedingungen, unter
die der Westen sie stellt, sollen die
unversöhnlichen Nationalismen ihr Anliegen
abschließend befriedigt sehen und sich zu konstruktivem
Engagement für das gesamtbosnische Staatsprojekt bereit
finden, das er ihnen überstülpt!
Bis dieses famose Projekt praktisch wahr wird, muss
dessen Vorsteher freilich schon ziemlich diktatorisch
seines Amtes walten. Vornehmlich besteht seine Tätigkeit
darin, in dem vom Krieg verwüsteten Land auf möglichst
schnörkellosem Verordnungsweg die nötigen Ukasse zu
erlassen, damit auch gegen die Obstruktion der drei
Volksgruppen so etwas wie der Schein eines
gesamtbosnischen Staatslebens entsteht. Daneben bemüht
der Regent Bosniens sich natürlich auch darum, für die
demokratisch-zivilen politischen Verkehrsformen zu
sorgen, die seine Diktatur überflüssig machen sollen, und
das läuft zielstrebig darauf hinaus, den Widerspruch
seines Staatsgebildes durch ein paar weitere zu
moderieren. So ist die Leitung des Protektorats darauf
verfallen, die verfeindeten Volksgruppen in einen
gesamtbosnisch-demokratischen Willensbildungsprozess –
mit Wahlen, einem Parlament und auch einer Regierung –
einzubinden, um ihrem Oktroi auf diesem Wege den Zuspruch
widerspenstiger Nationalisten zu verschaffen – als müsste
denen das wunderbare Recht auf demokratische
Selbstbestimmung allemal wichtiger sein als das
Selbst
selber, zu dem sie sich „bestimmen“ wollen.
Und siehe da: Das Angebot, auf absolut legalem Wege – und
mit dem Segen der internationalen Aufseher in Bosnien
dazu – sich die Macht im Staat und darüber über
die anderen zu erobern, haben die politischen Führer der
Volksmannschaften glatt angenommen. Gerne sogar, denn
jeder von ihnen begreift die Chance, sich einwandfrei
wählen zu lassen, als ein Stück offizieller Zulassung der
nationalen Sache, um die es ihm und seinem
Haufen geht. Entsprechend haben sie ihre Mannschaften
mobilisiert: für sich, gegen die jeweils anderen. Das war
natürlich genau nicht im Sinne des Erfinders. Der
Staatengemeinschaft und ihrem Hohen Vertreter schwebt
schon ein ethnisch fein austariertes Zusammenwirken
moderater Kräfte
an der Regierungsspitze des
bosnischen Staates vor – mit der weitergehenden
Berechnung, dass sich darüber dann so allmählich auch die
aufgeregten Völkerschaften insgesamt zu einer ähnlich
moderaten Handhabung ihrer unbefriedigten Heimatliebe
„zivilisieren“ lassen. In diesem Sinne haben die
westlichen Aufseher bereits im Vorfeld der letzten
Wahlveranstaltung im vergangenen November alles Nötige
unternommen, damit das demokratische Procedere nicht
nationalistisch miss-, sondern nur für den Zweck
gebraucht würde, den sie dafür vorgesehen haben:
Kriminalisierung des einen Wahlvereins, Absetzung des
Häuptlings eines anderen, die Favorisierung der einen
Partei und zweckmäßige Manipulationen am Wahlrecht zur
Diskriminierung einer anderen… Sogar zu regelrechten
Bestechungsversuchen haben die Freunde echt
demokratischer Selbstbestimmung und geschworenen Feinde
der politischen Korruption gegriffen, Geld zwar nicht
verschenkt, für den Fall eines korrekten Wahlergebnisses,
also praktisch bewiesener Mäßigung
aber immerhin
mit einer gewissen pekuniären Perspektive versehene
Hilfsleistungen
versprochen – ein interessantes
Experiment: Zehn Jahre nach dem Untergang des realen
Sozialismus kommt der ‚Hebel der materiellen
Interessiertheit‘ erneut zum Einsatz, nur diesmal vom
Westen aus und zur ‚Stimulierung‘ eines Interesses an der
Erfüllung seines politischen Plans, Anführer wie
Gefolgsleute eines verkehrten Nationalismus mit
‚materiellen Anreizen‘ zum Mitmachen bei einem
Projekt zu bewegen, das sich gegen ihren
politischen Willen richtet.
Die Versuchsanordnung hat das gewünschte Ergebnis dann
doch nicht hergegeben. Und in Anbetracht des ziemlich
ernüchternden Resultates bei der Ermittlung des
bosnischen Volkswillens – es gibt ihn einfach nicht, denn
alle Völkerschaften sehen ihre Sache mit überwältigender
Mehrheit von denen am besten vertreten und repräsentiert,
die von der Staatengemeinschaft zuvor als
Nationalisten
geächtet wurden – dauert es weitere
drei Monate, bis dem Protektor die Inthronisierung einer
dem Westen wenigstens halbwegs genehmen offiziellen
Regierung in Bosnien gelingt. Die regiert nun, aber was
heißt das schon für die ‚Entitäten‘, aus denen Bosnien
besteht. Für die Föderation von Kroaten und Muslimen
braucht es einen eigenen Kraftakt, bis sich auch für sie
ein gemäßigter
Präsident findet – letztlich
verfängt die angedrohte Aufkündigung ohnehin zwar nur
versprochener und keineswegs spruchreifer, immerhin aber
vage in Aussicht gestellter Hilfsleistungen
und
Investitionen
doch irgendwie. Dumm dabei nur, dass
es die Föderation selbst inzwischen nicht mehr so recht
gibt, weil die Kroaten sich selbst zu einer
schöpferischen Anwendung des westlichen Prinzips ‚Einheit
Bosniens durch Spaltung in Entitäten‘ entschließen:
Jelavic, Mitglied der dreiköpfigen bosnischen
Präsidentschaft und Anführer der kroatischen
Nationalisten in Bosnien-Herzegowina, hat den Austritt
der Kroaten aus der Bosnjakisch-Kroatischen Föderation
bekanntgegeben (…): ‚Ab heute ist die Föderation eine
bosnjakische nationale Entität, aber ohne Kroaten‘.
(NZZ, 2.3.) Natürlich verfügt
der internationale Bosnienbeauftragten unverzüglich die
Absetzung dieses einen Repräsentanten aus dem ethnischen
Tripel der bosnischen Präsidentschaft, nur dürfte dies
den Führer der Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft
nicht besonders schmerzen. Er nämlich – und
offensichtlich nicht wenige seiner Gefolgsleute mit ihm
zusammen – hat sich dazu entschlossen, dem Versuch der
bosnischen Zentralverwaltung, seine Machtbasis
zu schwächen, dadurch wirksam entgegenzuwirken,
dass er selbige gegen das offizielle Bosnien
stärkt. Die Herauslösung der kroatischen
Lokalbehörden aus der offiziellen Administration, die
Ausgliederung einer kroatischen Armee aus dem Militär der
Föderation und der weitere Ausbau paralleler
Strukturen
einer genuin kroatischen Machtausübung:
Das sind die anvisierten Schritte, mit denen die
kroatische Selbstregierung vorerst das Korsett der
muslimisch-kroatischen Föderation sprengen und darüber zu
einer dritten Entität
im Staat Bosnien
heranwachsen will. Die Zurückhaltung, mit der die im
Mutterland aller Kroaten Regierenden diesen Auszug eines
versprengten eigenen Volksteils aus der bosnischen
Unter-‚Entität‘ aufnehmen, beeindruckt die kroatischen
Nationalisten in Bosnien dabei nicht besonders. Der
internationalen Aufsichtsgemeinde unterbreiten sie ihre
Aufkündigung des Dayton-Konstrukts jedenfalls ziemlich
unmissverständlich als Aufforderung, sich für die eine
oder die andere Variante kroatischer Emanzipation,
entweder in oder von Bosnien, zu
entscheiden: Der Sprecher der nationalistischen
Kroaten sagte, die Kroaten würden bei Bosnien bleiben,
wenn das Land in drei Bundesländer – für jede Volksgruppe
eines – oder Kantone aufgeteilt würde.
(SZ, 5.3.)
Doch auch die dezidierte Weigerung der bosnischen
Kroaten, sich die eigene nationale Sache noch länger
durch die Mitwirkung in einem multiethnischen
Staatsformalismus abkaufen zu lassen, kann dem
kunstvollen Gebilde des bosnischen Gesamtstaats, das der
Westen unterhält, nichts anhaben. Solange es von den
Signatarmächten des Dayton-Vertrags nicht offiziell
gekündigt wird, kann der Protektor sein Gebilde ungerührt
weiter so regieren wie bisher. Die Meuterei in
Bosnien
(NZZ, 31.3./1.4),
die die kroatischen Soldaten mit ihrem Auszug aus den
Kasernen der bosnisch-föderierten Armee anzetteln,
ignoriert er einfach; zur Schließung einer Bank, über die
das Geld eines kroatischen Parallelstaates
fließen
soll, schickt er seine Truppen vorbei. Die werden bei
gegebenem Anlass dann auch an anderen Stellen dafür
sorgen, dass die Kroaten mit ihrer ‚Entität‘ die Fiktion
von Staat nicht auffliegen lassen, die sie als ihre
Heimat nun einmal zu akzeptieren haben. Entlassen aus ihr
sind sie nämlich auch nach ihrem Auszug nicht.
Kosovo: Für albanische Kosovaren entschieden zu klein
Auch die Eskalation der Lage im Kosovo hat die dort
ansässige albanische Volksmannschaft ganz prima allein
und ohne ihren vormaligen serbischen Unterdrücker
hingekriegt, und wie die Kroaten in Bosnien, so hat auch
sie sich nur einmal mehr die Widersprüche zunutze
gemacht, die die westliche Aufsicht in diesem Protektorat
eingerichtet hat und am Leben erhält. Denn ohne dies
selbst so je gewollt zu haben, ist der westlichen
Kriegsallianz mit ihrer erfolgreichen Besetzung des
Kosovo die Aufgabe zugefallen, ersatzweise für die von
dort verjagte jugoslawische Herrschaft die politische
Kontrolle über das Gebiet wahrzunehmen. Ein auch nur
halbwegs funktionierendes Wirtschafts- und sonstiges
Leben in einer vom Krieg zerstörten Gegend aufzuziehen
und in Gang halten, hatten und haben die NATO-Mächte
allerdings auch in diesem von Serbien befreiten Winkel
nicht vor. Dies umgekehrt den Jugoslawen oder den
Albanern selbst zu überlassen, verbietet sich jedoch erst
recht: Letzteres würde dem Projekt „Großalbanien“
zuarbeiten, das man nicht will; die Rückerstattung der
Provinz an Belgrad wäre – entgegen der offiziellen
Befreiungslegende: auch ohne Milošević – gleichbedeutend
mit der Wiederherstellung des Kriegszustandes und ist
einstweilen noch nicht einmal als Belohnung für die
größte anzunehmende Unterwürfigkeit der serbischen Seite
denkbar. So wissen die Besatzer mit der Gegend, in der
sie hocken, einfach nichts konstruktiv anzufangen. Sie
haben aber auch mit deren bloßer Kontrolle – die sie,
ihrer humanitären Mission
gemäß, Befriedung
nennen – schon mehr als genug zu tun: Sie halten die
separierten feindlichen Volksgruppen auseinander, indem
sie sich zwischen sie stellen, und bemühen sich
ansonsten, für ein multiethnisches Zusammenleben
zu sorgen, indem sie im Feindesland versprengte Einwohner
beispielsweise im Panzerwagen sicher zur Schule oder zum
Sonntagsgebet geleiten. Die materielle Grundlage dieses
„Zusammenlebens“ besteht im Übrigen in den nicht eben
reichlichen Geschenken, die im Rahmen des EU-Projekts
Hilfe zur Selbsthilfe
nach bosnischem Muster
spendiert werden: ein Fensterrahmen hier, ein Stück
Flurbereinigung dort, und ganz viel anberaumte Treffen,
auf denen die Ethnien über die Fortschritte ihrer
gemeinsamen Zukunft reden können.
Die betreffenden Volksgruppen haben für diese ihre Zukunft, vor allem friedlich und einvernehmlich, im übrigen aber von nichts, nebeneinander vor sich hin zu leben, nun allerdings überhaupt nichts übrig. Die Serben nicht, und vor allem steht die von der NATO befreite albanische Bevölkerungsmehrheit – nach wie vor und jetzt, nachdem sich ihre Militanz für sie ausgezahlt hat, natürlich erst recht – auf dem Standpunkt, von der Allianz zur Verwirklichung ihrer Vorstellung von einem autonomen Kosovo befreit worden zu sein. Für den praktischen Beweis, dass eine richtige albanische Unabhängigkeit so lange eine „offene Frage“ ist, wie noch nicht alle Albaner auch wirklich in einem Staat versammelt sind, sind deren Aktivisten dann gleich an zwei Fronten unterwegs: gegen die verhassten Serben, die noch immer auf dem prospektierten albanischen Staatsgebiet hausen – und damit zugleich immer auch ein bisschen gegen die KFOR-Truppen der westlichen Aufsichtsmacht, die diese vor ihren Widersachern schützen sollen.
Als vorläufig letzte Eskalation des albanischen
Kleinkriegs gegen Serben und deren Beschützer macht sich
nun aus dem Kosovo eine albanische Befreiungsarmee von
Presevo, Medvedja und Bujanovac (UÇPMB)
auf, aus
Südserbien albanisch besiedelte Landstriche
herauszubrechen und an den Kosovo anzugliedern. Mit ihrem
Einfall in die so genannte entmilitarisierte
Pufferzone
zwischen Kosovo und Serbien – sie gilt
inoffiziell schon seit längerem als albanisches
Aufmarschgebiet – eskalieren die tapferen Unruhestifter
nicht nur ihre Militanz gegen den serbischen
Bevölkerungsteil. Sie stellen auch die berechnende
Zurückhaltung auf eine harte Probe, die die westlichen
Aufsichtsmächte im Bemühen, den albanischen Nationalismus
für ihr multiethnisches Ordnungskonzept im Kosovo zu
funktionalisieren, den Umtrieben der Aktivisten einer
albanischen Unabhängigkeit gegenüber bislang praktisch an
den Tag legen. Der Übergang dazu, ihr multiethnisches
Toleranzedikt auch mit Gewalt gegen die
aufsässigen Albaner durchzusetzen, käme nämlich endgültig
dem Eingeständnis gleich, dass ein befriedetes Kosovo
ohne ein komplettes militärisches Besatzungsregime, das
sich die gesamte Bevölkerung unterwirft, nicht zu haben
ist. Nicht, dass die NATO-Mächte dazu nicht imstande
wären. Aber der erforderliche Aufwand macht für sie
einfach keinen imperialistischen Sinn, und sie wollen
sich auch jetzt, wo die albanischen Freischärler mit
ihren Einfällen in Jugoslawien die Kriegsgefahr auf
dem Balkan erhöhen
(HB,
9./10.3.), nicht zu ihm entschließen. Statt dessen
setzt die NATO auf eine schöpferische Fortentwicklung
ihres Aufsichtsprinzips – und spannt diesmal in
grenzüberschreitendem Zynismus den demokratisierten
jugoslawischen Nationalismus als Instrument zur
Realisierung ihrer Balkanordnung
ein.
Weil das Sicherheitsproblem
, das die albanischen
Krieger für den rest-jugoslawischen Staat aufwerfen, auch
die Stabilität
tangiert, die sie in der Region
implantieren wollen, schließen sich die Westmächte
derselben Lagedefinition an, die sie dem
Staatsterroristen Milošević
nicht einmal zwei
Jahre zuvor mit ihrem Krieg bestritten haben: Sie
anerkennen den serbischen Standpunkt, der in den
Angriffen der Albaner nicht hinnehmbare terroristische
Aktionen
(Staatspräsident
Koštunica) sieht. Sie stellen sich – im Prinzip
zumindest – also auch ein Stück weit hinter das Recht auf
Verteidigung einer rest-jugoslawischen Souveränität, das
die Führung in Belgrad schon seit längerem reklamiert,
wenn sie fordert, selbst für den Schutz der
eigenen Grenzen zu sorgen. Allerdings auch nur im
Prinzip. Denn die Erlaubnis, die der serbischen Seite
nach reichlichem Abwägen dann doch großzügigerweise
gewährt worden ist: mit eigenen Streitkräften die eigene
Staatsgrenze verteidigen zu dürfen, geht mit Bedingungen
einher, die mit einer vorbehaltlosen Anerkennung eigener
jugoslawischer Sicherheitsinteressen nicht zu verwechseln
sind. Der ehemalige Kriegsgegner darf sich zwar
eigenständig um seine Sicherheit kümmern, die ihm vom
Boden des NATO-Protektorats aus zum Problem gemacht wird,
aber beileibe nicht so, wie er dies für geboten
hält: Für diesen Dienst will die Nato leicht
bewaffnete Grenzschutzverbände und Polizisten zulassen.
Der Einsatz von schwerem Kriegsgerät und von gepanzerten
Fahrzeugen bleibt den Serben weiterhin verboten. Diese
serbischen Patrouillen sollen in den ihnen zugewiesenen
Abschnitten verdächtige Bewegungen kontrollieren und das
Eindringen bewaffneter Freischärler verhindern.
(NZZ, 9.3.) Dieselben
Militärs, die ihre Soldaten im Kosovo auch noch in den
Puff mit Panzerwagen vorfahren lassen, gestatten es den
Serben doch glatt, im albanisch kontrollierten
Niemandsland mit leichtem Gerät
die
Bewegungen
einer schwer bewaffneten Guerilla zu
kontrollieren
: Was für ein vielversprechender
Auftakt in Sachen Zusammenarbeit mit dem ehemaligen
Gegner
!
Aber es ist immerhin ein Auftakt, so dass Djindjic, unser
neuer Freund in Belgrad, zwar vernehmlich, aber nur kurz
und folgenlos über die subalternen Hilfsdienste für
die NATO
mault, mit denen Rest-Jugoslawien seinen
ersten, dem Westen wieder willkommenen
Souveränitätsbeweis abliefert. Schließlich gewähren die
NATO-Mächte Rest-Jugoslawien die Erlaubnis, sich selbst
um das Sicherheitsproblem
zu kümmern, das sie mit
ihrem Regime im Kosovo erzeugen. Das ist schon ein großes
Entgegenkommen; da muss es genügen, dass der Staat sich
gegen albanische Feindseligkeiten kontrollierend
zur Wehr setzt; seinerseits die UÇPMB-Kämpfer als Feinde
zu bekämpfen, bleibt untersagt. So kommt es, dass sich
als minderbemittelte Hilfstruppe und mit dem
Polizeiaufgabengesetz im Tornister seit neuestem auch das
jugoslawische Militär um die Sorte Stabilität
verdient machen darf, die dem Westen für die Region
vorschwebt. Für die politische Führung fällt auch eine
schöne Aufgabe ab: Sie bekommt das Recht, mit dem
UÇK-Ableger und der internationalen Gemeinschaft ein
Waffenstillstandsabkommen auszuhandeln und sich demnächst
im albanisch besiedelten Südzipfel Serbiens selbst mit um
die Gestaltung der politischen Formen zu kümmern, in
denen dort die Völker zusammenleben sollen. Denn die
Albaner fordern eigene gesetzgeberische Körperschaften,
dazu eine autonome Lokalregierung, Polizei und
Rechtsprechung
– und wer wollte ihnen das verwehren!
Die Verhandlungen mit Belgrad sollten zudem an einem
neutralen Ort außerhalb Jugoslawiens und unter
Beteiligung internationaler Vermittler stattfinden.
(FAZ, 7.3.) Noch ein kleines
Dayton oder Rambouillet ist da also im Angebot, noch eine
kleine Enklave eines international vermittelten
multiethnischen Zusammenlebens
auf dem Boden
Ex-Jugoslawiens. Da kann der Westen sich demnächst
entscheiden, ob er die Stabilisierung der Region
nach dem in Bosnien und im Kosovo bewährten Muster auch
noch in Rest-Jugoslawien für opportun hält, noch ein
Stückchen aus dem Land herausbricht und dem serbischen
Staatswillen – statt dass er weiterhin dem „Fetisch
Souveränität“ nachjagt – das Ziel setzt, unter
internationaler Aufsicht für die Einführung einer
Zivilgesellschaft
in Südslawien zu sorgen.
Mazedonien: „Stabilisierung“ einer Bürgerkriegslage durch „Anbindung an Europa“
Dass der Wille zum eigenen albanischen Staat auch vor der Grenze zu Mazedonien nicht Halt macht, ist logisch: Auch dort leben Albaner unter der falschen Herrschaft, auch dort sind sie von slawischer Dominanz zu befreien. Dass auch in Mazedonien der Kampf um Eigenstaatlichkeit über die Unterminierung der dortigen staatlichen Ordnung geführt wird, ist gleichfalls nur konsequent, und für eine UÇK schon gleich: Die kann diesbezüglich ja auf eine rundum positive Erfahrung zurückblicken – auch wenn der eigentliche Erfolg noch aussteht. So wird dank der vom Westen der Region oktroyierten „Stabilität“ endlich auch die einzige Nation in einen Staatsgründungskrieg involviert, die sich ohne Blutvergießen aus Titos Hinterlassenschaft ausgegliedert hat: UÇK-Aktivisten sickern im Land ein und zeigen der albanischstämmigen Minderheit mit Mörsern und Granaten, dass die Sache aller Skipetaren gut unterwegs ist.
Im Westen ist man bestürzt. Schon wieder droht ein
neuer Balkan-Krieg
, den man genau so wenig brauchen
kann wie den im südserbischen Presevo-Tal. Und, was auch
nicht schön ist: Auch da sind es die Schützlinge aus dem
eigenen NATO-Protektorat, die sich ziemlich unbeeindruckt
von den versammelten KFOR-Truppen geben und von denen bei
der ersten Kostprobe einer eigenen militärischen
Schlagkraft und Handlungsfreiheit auch gar nicht
behelligt werden. Das geht dann für die NATO und EU doch
ein wenig zu weit: Erstmals schließt man sich auch
hierzulande offiziell dem jugoslawischen Sprachgebrauch
zur Bezeichnung der UCK an, und der außen- und
sicherheitspolitische EU-Koordinator lässt die
mazedonische Regierung wissen, dass man in Europa nicht
nur das Mittel sehr gut kennt, mit dem solche Angriffe
auf die Integrität eines Staates abzuwehren sind, sondern
auch für dessen bedingungslosen Einsatz ist: Im
konkreten Fall wäre es ein Fehler, mit den Terroristen zu
verhandeln; sie müssen isoliert werden.
(Solana lt. SZ, 22.3.) Letzteres hat die
Regierung in Skopje um der Selbsterhaltung ihres Staates
willen auch vor, und es gelingt ihr mit ihren
bescheidenen militärischen Mitteln dann doch erstaunlich
rasch, weil es die Kämpfer der UÇK offensichtlich nicht
gleich auf eine entscheidende
Machtprobe mit dem mazedonischen Staat anlegen. Doch kaum
wird vermeldet, dass Mazedoniens Fahne wieder über der
Burg des albanisch besiedelten Tetovo weht, wird auch
dieser staatliche Behauptungswille an die Grenzen
erinnert, die man ihm in Brüssel zieht. Solana lässt
wissen, dass die EU selbstverständlich die territoriale
Integrität und Souveränität Mazedoniens unterstütze –
keinesfalls aber Gewalt, wo politische Mittel zum Ziel
führten.
(NZZ, 27.3.)
Zwar ist die in Fällen, in denen Macht und Geltung eines
staatlichen Gewaltmonopols gewaltsam bestritten werden,
das einzige zielführende Mittel der Politik.
Aber insofern man in Europa die Rolle in Anspruch nimmt,
als einzige maßgebliche Kontrollinstanz über den
Gewalthaushalt aller auf dem Balkan sich tummelnden
Staaten zu wachen, hat man sich auch bei Staaten, die
gerade um ihre Selbsterhaltung kämpfen, in dieser Rolle
in Erinnerung zu bringen. So bekommt auch der
mazedonische Nationalismus die nötigen Hinweise,
wie er sich bei seiner Selbstbehauptung als
funktionell für die Methode zu erweisen hat, mit
der Europa für Stabilität auf dem Balkan sorgen will.
Bekannt ist dabei den westlichen Krisenmanagern durchaus,
dass dieser Staat mit seiner albanischen Minderheit seit
seiner Gründung ein recht fragiles
Gebilde ist.
Sie haben auch mitbekommen, dass schon der Auftritt einer
Handvoll UÇK-Kämpfer in diesem Land ausreicht, um dort
die ethnischen Spannungen
zuzuspitzen: Die Albaner
reagieren mit Sympathiebekundungen, die mazedonischen
Slawen mit dem Wunsch, die Regierung möchte doch gleich
gescheit mit den albanischen Unruhestiftern aufräumen.
Und zwar mit allen. Aber die Mächte der NATO und Europas
lassen sich selbstverständlich auch durch die
Herausbildung von Bürgerkriegsfronten nicht von dem
Projekt abbringen, wie man der Region zu ihrer
Stabilisierung
verhilft: Multiethnische
Zivilgesellschaft
, das politische Ordnungsmodell
mithin, mit dessen gewaltsamer Durchsetzung sie in
Bosnien wie im Kosovo so glanzvolle Erfolge feiern, hat
nach ihrem Dafürhalten auch in Mazedonien das
Befriedungsrezept der Wahl zu sein, und die
entsprechenden Direktiven werden der Regierung in Skopje
dann mitgeteilt. Der deutsche Außenminister gibt bekannt,
dass die Staatengemeinschaft eine gewaltsame Änderung
der Grenzen nicht zulassen wird
, er im übrigen aber
zusammen mit den Albanern, die sie aufwerfen, auch der
Auffassung ist, dass die albanische Frage virulent und
offen
(FAZ, 22.3.) ist.
Auf diese Weise gibt er zu verstehen, dass diese heiße
Frage über die Standpunkte und Interessen der beiden
Parteien hinweg, die gerade im Begriff sind, sie
gegeneinander auszufechten, exklusiv europäischer
Regelungskompetenz unterliegt, wenn also überhaupt, dann
nicht von ihnen selbst, sondern allein im Rahmen einer
europäischen Perspektive
zu regeln ist. Diese
Perspektive nimmt dann in dem Antrag an die mazedonische
Regierung erste Gestalt an, den berechtigten
Beschwerden der Albaner
in Mazedonien und ihrer
legitimen Forderung nach einem Ende der
Diskriminierung
(ebd.)
Rechnung zu tragen, zusammen mit dem deutschen
Außenminister also die Rechtsposition im Prinzip
anzuerkennen, die der albanische Separatismus
für sich geltend macht. Freilich auch nur im Prinzip.
Denn dass der Wunsch der mazedonischen Albaner, im Wege
einer Verfassungsänderung offiziell den Status eines
eigenen staatenbildenden Völkchens im Staat Mazedonien –
mit Albanisch als eigener Staatssprache und einem eigenem
albanischen Fernsehsender – zuerkannt zu bekommen,
unmittelbar auf die Zweiteilung des Landes hinausläuft,
weiß der kluge Außenminister selbstverständlich auch.
Daher erhält die albanische Rechtsauffassung auch nicht
die Anerkennung, die sie will. Nach einhelligem
westlichen Willen soll der Staat Mazedonien darüber
beisammen bleiben, dass sich die beiden dort
unversöhnlich gegeneinander stehenden
Staats-Standpunkte weit genug auseinander
sortieren, um doch wieder miteinander
auszukommen – als bräuchten der Wille, das Land in seinem
Bestand zu erhalten, und das Bedürfnis, ihn zu zerlegen,
bloß ein wenig Distanz und Abkühlung, um von ihren
Gegensätzen und von ihrer Militanz gegeneinander
abzulassen und sich durch das, was die EU den beteiligten
Völkerschaften an politischer Ordnung ihres
Zusammenlebens vorschreibt, perfekt bedient zu finden.
Die Kämpfer aus dem Kosovo genau so wie die albanische
Minderheit im Land sollen Ruhe geben und sich mit einer
Autonomie
begnügen, die das Land wenigstens nicht
förmlich zerteilt – eine Belohnung für ihre
Militanz, die sie von weiterer Militanz abhalten
soll. Und die mazedonisch-slawische Staatsführung soll
ihren Albanern diesen Rechtsstatus einer nicht ganz
verselbständigten Selbständigkeit gewähren – also ihren
Separatisten halb Recht geben, um zur anderen
Hälfte rechtsförmlich weiter über sie herrschen
zu können.
So sichert Europa die Stabilität auf dem Balkan, indem es
in diesem Land einen Bürgerkrieg einfach für überflüssig
erklärt. Es sucht die zwei feindlichen Parteien auf eine
politische Lösung
zu verpflichten, die bei einem
Kompromiss angesiedelt ist, zu dem sie sich in etwa nach
einem Waffengang mit unentschiedenem Ausgang ohnehin
zusammenraufen müssten; das soll sie davon überzeugen,
dass sie sich ihre Machtprobe auch gleich schenken
können, was sie im übrigen auch schon allein deswegen tun
sollen, weil man es in Europa von ihnen so will – Ende
der Durchsage. Über die Tragfähigkeit und Haltbarkeit
dieser Befriedungsmethode von Bürgerkriegslagen, die man
nach Bosnien und dem Kosovo nun auch Mazedonien
oktroyiert, macht man sich in den Reihen der EU und der
NATO allerdings selbst nicht viel vor. Erstens hat man da
so seine leidigen Erfahrungen, und diese zweitens
insbesondere mit den Albanern. Lamers, außenpolitischer
Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag immerhin, mag
sich in Anbetracht der allseitigen Intransigenz der Idee
nicht mehr ganz verschließen, der Westen könnte
alternativ auch für so etwas wie einen kontrollierten
Zerfall
dieses Staates sorgen. Gewaltlose
Grenzänderungen mit Zustimmung der Beteiligten
(FAZ, 29.3.) – das wäre
beispielsweise so ein Königsweg zur Beilegung dieser
leidigen ethnischen Konflikte
. Der wäre auch
humanitär astrein, denn wenn Europa, diese Wiege des
Menschenrechts, Grenzpfähle verschiebt und die Völker in
neue Territorien umsortiert, so ist das
selbstverständlich keine ethnische Säuberung. Gewalt ist
da auch kein Thema, denn selbstverständlich findet es die
Zustimmung aller Mazedonier, wenn dasselbe Europa, das
ihnen ihren Staat geschenkt hat, den einfach mal um ein
Drittel verkleinert. Doch vorläufig ist man in Brüssel
noch bewährten Idealen treu und hält eine
multiethnische Ausgestaltung
Mazedoniens für
wünschenswert
(ebd.).
Da man dieses Land zwar schon länger als Aufmarschgebiet
benutzt, es in ihm aber schon noch so etwas gibt und
weiterhin geben soll wie eine souveräne Regierung – schon
damit man sich nicht schon wieder selber mit den
ortsansässigen Volksgruppen herumschlagen muss –, lässt
man diese wissen, dass sie keineswegs nur
Befehlsempfänger ist, sondern ein vollständig
gleichberechtigter Partner, für den sich ein Tanz nach
der Brüsseler Pfeife durchaus auszahlen könne und eine
friedliche Konfliktlösung lohne. Mehrfach wurde an die
für den 9. April geplante Unterzeichnung eines
Stabilisierungs- und Assoziationsabkommens zwischen der
EU und Mazedonien erinnert, und die EU-Kommission gab
einen Überblick über die für dieses Jahr geplante Hilfe,
die (…) ein Schwergewicht auf die Verbesserung der
interethnischen Beziehungen legt und beschleunigt
ausbezahlt werden soll.
(NZZ,
20.3.)
Assoziation als staatliches Lebensmittel also: Eines der
offiziell anerkannten Armenhäuser Europas
soll
seine politisch-ökonomische Grundlage und seine ganze
nationale Zukunft darin sehen, sich als irgendwie
geartetes Anhängsel der EU zurechnen zu können. Was die
Gestaltung der Zukunft Mazedoniens betrifft, so besteht
die vor allem darin, im Umgang mit den aufsässigen
Albanern den Respekt vor fremdvölkischen Minderheiten an
den Tag zu legen, den die Demokratien Europas in diesem
Land für unbedingt angebracht halten. Das sichert dem
Staat dann auch schon ein Stück weit sein ökonomisches
Überleben. Denn Gelder für konkrete Projekte
interethnischer Aufbauarbeit, zum Beispiel im
Bildungsbereich oder in der Infrastruktur
(Hombach,
EU-Balkan-Koordinator) werden ihm beileibe nicht
mehr nur versprochen: Sie werden auch ausbezahlt, und
zwar sogar beschleunigt! Wenn das keine Perspektive für
Mazedonien ist: Während schon die nächsten UÇK-Kämpfer
ins Land einfallen, die Regierung wieder ihr Militär
losschickt und sich im Volk eine anti-albanische
Pogromstimmung breit macht, will die EU mit dem
Versprechen wirklicher Geldzahlungen bei Slawen wie bei
Albanern mäßigend auf die radikalen Kräfte
in Volk
und politischer Führung einwirken. Und mit den Summen,
die womöglich wirklich irgendwann einmal von Brüssel nach
Mazedonien überwiesen werden, kann dann endlich der
Lehrbetrieb in einer südosteuropäischen Universität
mitten in der Albaner-Hochburg Tetovo
(NZZ, 20.3.) aufgenommen werden. Noch so
eine einfach umwerfende friedenssichernde Maßnahme:
Mitten im Frontgebiet eines heranziehenden Bürgerkriegs
bietet die EU den Völkern auch noch Proseminare am
Lehrstuhl für multiethnisches Zusammenleben an! Das wird
sie vielleicht verbinden!
Montenegro: Keine Einsicht in die Grenzen der eigenen Eigenstaatlichkeit
Nicht viel Freude hat der Westen auch mit einem anderen
seiner Geschöpfe auf dem Balkan. Freund Djukanovic, der
die rest-jugoslawische Provinz Montenegro regiert, ist
mittlerweile zu einem kleinen Problemfall geworden. Zwar
macht er nur dasselbe wie bisher und betreibt weiter
seine Sezession von der Belgrader
Zentralregierung
. Es ist auch so, dass er – dank
großzügig gewährter monetärer Hilfe und politischer
Unterstützung durch den Westen – mit der schon ziemlich
weit vorangekommen ist: Auch wenn sonst ökonomisch nicht
eben viel unterwegs ist, so zirkuliert in seinem Sprengel
immerhin die DM und nicht der Dinar als Währung; und wenn
auch sonst über nicht viel, so gebietet er doch über
eigene Truppen und ein eigenes Grenzregime. Aber er will
einfach nicht einsehen, dass es all diese untrüglichen
Indizien einer montenegrinischen Eigenstaatlichkeit
überhaupt nur wegen der Funktion gibt, die sie
für den Westen und dessen Kampf gegen das
Rest-Jugoslawien Milošević’ hatte. Als hilfreicher
Beitrag zur Schwächung der in Belgrad residierenden Macht
des Bösen war Djukanović der Gute mit seinen
staatsmännischen Ambitionen gefragt. Dazu sollte und
durfte er seine Provinz aus Jugoslawien ausgliedern und
auch mit allen förmlichen Attributen ausstatten, die zu
einem eigenständigen Staatswesen gehören – das aber dann
auch selbst auszurufen, wurde ihm nicht gestattet. Noch
ein Bürgerkrieg auf dem Balkan, nur damit ein von ihm
auserkorener nützlicher Idiot nicht nur pro forma
Staatsmann spielen, sondern wie ein echter einen
richtigen Staat regieren kann: Das war und ist dem Westen
einfach zu viel – was sich nicht gut mit dem Umstand
verträgt, dass Djukanović die Regentschaft über einen
bloßen Quasi-Staat einfach zu wenig ist. So hat der
Westen noch einen Nationalismus vor sich, dem er wegen
seiner erwünschten, weil Jugoslawien
destabilisierenden Funktion überhaupt erst eine
Perspektive gewiesen hat, den er jetzt aber, weil er
seine Balkan-Ordnung zu destabilisieren droht,
wieder in seine Schranken zu weisen hat.
Geld, das man zur Verwaltung dieser Entität
Montenegro bezahlt, ist naturgemäß das beste Mittel,
einen sich allzu selbständig machen wollenden Satrapen
zur Räson zu rufen. Also teilt man Djukanović mit, dass
er demnächst womöglich keines mehr bekommen wird, und der
lässt fürs erste von seinem Vorhaben ab, sich über ein
Referendum beim Volk das imperative Mandat zur
Staatsgründung zu bestellen und abzuholen. Weil aber die
Drohung, den Geldhahn zuzudrehen
(SZ, 24.4.), umgekehrt auch nur den
Willen verrät, bei erwiesenem Wohlverhalten weiter zu
zahlen, weiß Djukanović auch, wie er sein Weiterleben am
Tropf seiner westlichen Geldgeber mit dem Weiterbetreiben
des von denen nicht gewollten Unabhängigkeitsprojekts zu
verknüpfen hat: Er vertagt sein Referendum und verlegt
sich statt dessen auf das – in seiner allerhöchste
Legitimität verschaffenden Potenz wohl von niemandem im
Westen anzufechtende – demokratische Wahlverfahren als
Mittel, sein Volk für sich und darüber
für ein Ja zur Sezession von Rest-Jugoslawien zu
mobilisieren.
Demokratisch gut kalkuliert, kommt es dennoch anders, als
Djukanović es sich ausgerechnet hat: Seine 600000
Montenegriner liefern die in Form einer überzeugenden
Mehrheit für ihn verlangte demokratische Legitimation
seines Projekts nicht ab. Die gewisse Erleichterung, die
sich darüber im Westen ausbreitet, hält sich gleichwohl
in Grenzen. Erstens ist aufgeschoben eben nicht
aufgehoben, und zweitens hat man sich in Montenegro
ohnehin einen Zustand geschaffen, der weder so noch so
haltbar ist: Auch wenn das Wahlergebnis eine baldige
Abspaltung Montenegros unwahrscheinlich macht, ist die
Situation in Podgorica für den Westen nicht beruhigend.
Das Votum bestätigte die Gespaltenheit der Bevölkerung.
Und es dürfte eine unbefriedigende
serbisch-montenegrinische Verbindung verlängern, die bis
auf die Präsenz der jugoslawischen Armee schon aufgelöst
war. Das jugoslawische Parallelsystem mit einer
serbischen Teilstaats-Regierung und den praktisch
funktionslosen Bundesbehörden bleibt erhalten.
(SZ, 24.4.) Die Quadratur des
Zirkels – das wäre wohl eine den Westen
befriedigende
Lösung: Keine Abspaltung Montenegros
von Serbien, aber doch das Kappen aller
serbisch-montenegrinischen Verbindungen; kein eigener
Staat Montenegro, aber doch Schluss mit den Resten einer
jugoslawischen Bundesregierung im Land; und möglichst
keine gespaltene Bevölkerung, obwohl die doch gerade für
die Verhinderung der Abspaltung Montenegros gesorgt hat.
Einstweilen schickt der Westen Djukanović zu politischen
Verhandlungen nach Belgrad, und wie aus dem ersten
Geheimtreffen zu Montenegros Zukunft
(SZ, 28./29.4.) durchsickert, verstehen
sich die Protagonisten vor Ort tatsächlich darauf, die
Vertagung ihres Gegensatzes zum politischen
Gesprächs- und Verhandlungsstoff zu machen. Der serbische
Premier Djindjić empfiehlt seinem montenegrinischen
Kollegen, den zukünftigen Status seines Landes in einem
Dialog zwischen den Parteien
daheim zu ermitteln,
also gefälligst das Kräfteverhältnis zu respektieren, das
den Status Quo garantiert. Und Djukanović macht mit einer
Union
seine Aufwartung, die ein ‚unabhängiges
und international anerkanntes‘ Montenegro mit Serbien
eingehen könnte.
(ebd.)
Da wird also schon die Geburt der nächsten,
völkerrechtlich ziemlich eigentümlichen, der Region dafür
umso besser auf den Leib geschneiderten staatlichen
Entität angepeilt: Ein Staat, der unbedingt eigenständig
sein will, und sich zu diesem Zweck in einer Union mit
einem anderen gründet, weil der ihn gar nicht in seine
Eigenständigkeit entlassen will – das wird der wackeligen
politischen Stabilität auf dem Balkan ganz bestimmt gut
tun!
Und noch ein letztes Mal: Das Stabilitätshindernis Milošević wird beseitigt
An sich lässt die Lage im serbischen Rest-Jugoslawien
wenig westliche Wünsche offen, sie ist in jeder
erdenklichen Hinsicht stabil
: In Belgrad regiert
ein den Westmächten höriger, dem jugoslawischen Staat
präsidiert ein ihnen gegenüber zumindest aufgeschlossener
Demokrat, und, was genau so wichtig ist: Milošević
zusammen mit seiner alten Staatspartei ist und bleibt
erfolgreich marginalisiert. Doch offenbar reicht das
alles dem Westen nicht. So richtig fertig mit dem
Störfall Rest-Jugoslawien ist man hier erst dann, wenn
sich nach seiner militärischen Niederringung und nach
seiner erfolgreichen Wende zum Westen
dieser Staat
auch noch in sittlich-moralischer Hinsicht den
eigenen Rechtsmaßstäben unterwirft. Dem Verbrecher
Milošević
hat man das Handwerk gelegt, seine
Verbrechen
aber, mit denen man den Krieg gegen ihn
moralisch begründete, bleiben solange ungesühnt, wie man
ihn nicht auch noch persönlich für sie haftbar gemacht
hat. Und dafür, dass man dies endlich kann, haben seine
Nachfolger in Belgrad gefälligst zu sorgen: Sie
werden von der Schuld, mit und unter Milošević irgendwie
doch bei jeder seiner Schandtaten mitgemacht zu haben,
nur dann entlastet und vom Westen freigesprochen, wenn
sie sich zu ihr bekennen, tätige Reue zeigen und
Milošević dorthin überstellen, wo ihm nach allen Regeln
des Völker- und Menschenstrafrechts der Prozess gemacht
werden kann.
Das ist ziemlich dreist. Derselben Staatsregierung, die man für ihre Dienste an der Entmachtung von Milošević mit der Wiederaufnahme ins Lager der anerkannten und anerkennenswerten Souveräne belohnt hat, teil man mit, was ihre Souveränität zählt: Wenn überhaupt demnächst irgendetwas, dann nur, wenn sie sich selbst erst einmal zum Vollzugsorgan eines im Westen ausgestellten Strafbefehls degradiert. Das mutet einer Regierung, die sich immerhin mit dem Programm eines neuen Aufbruchs der jugoslawischen Nation ins Amt hat wählen lassen, nicht nur einiges an Selbstverleugnung zu. Auch das Volk, das die Geschicke der Nation mehrheitlich einem Koštunica oder Djincjić zur besseren Verantwortung übertragen hat, dürfte in seinem diesbezüglichen Vertrauen nicht gerade befördert werden, wenn deren erste Amtshandlungen darin bestehen, westlichen Weisungen nachzukommen. Zumal ja auch nicht irgendjemand verhaftet werden soll. Der Strafbefehl gilt immerhin einem Staatsmann, der bis vor kurzem noch nicht wenige seiner Landsleute hinter sich und seine Sache zu versammeln verstand, so dass der Westen mit seinem Ansinnen, die neuen Amtsinhaber in Belgrad möchten ihn doch bitte nach Den Haag überstellen, nicht nur eine leichte Entzweiung von Volk und Führung riskiert. Er droht auch diejenige im Volk selbst und im staatlichen Machtapparat wieder wachzurufen, die vor dem Machtwechsel für einen Bürgerkrieg hätte gut sein können.
Aber auch in diesem Fall setzt der Westen den Balkan, wie
er ihn haben will, über alles – und sich einmal mehr über
alle Gefährdungen hinweg, die er dadurch für sein hohes
Gut Stabilität
heraufbeschwört. Ein Nationalismus,
der es nicht zuallererst ihm recht macht, hat
dort einfach kein Lebensrecht; und dieser Grundsatz
verliert auch dort nichts von seiner ernstgemeinten
Grundsätzlichkeit, will vielmehr gerade dort als
kategorischer Imperativ bedingungslos anerkannt sein, wo
es um eine zwischenstaatliche Abrechnung im
strafrechtlichen Sinn geht und der Sieger auf sein Recht
pocht, den unterlegenen Kriegsgegner, und zwar keineswegs
bloß symbolisch und zum Zwecke moralischer Rechthaberei,
sondern ganz regelgerecht als Rechtsbrecher zu verfolgen.
Das haben die neuen Machthaber in Belgrad letztlich dann
auch so verstanden. Mit oder ohne Erpressung durch die
Handvoll Dollar an Hilfsleistungen
, die sie
andernfalls vermutlich nicht erhalten hätten, holen sie
Milošević fristgerecht aus seiner Villa heraus und werden
für ihren Mut zum Risiko gleich dreifach belohnt: Die
Staatsorgane legen sich nicht quer und bleiben ihren
neuen Dienstherren gegenüber auch bei der Verhaftung
ihres alten loyal; dem Volk ist es, von einigen
Unverbesserlichen
abgesehen, recht bis
gleichgültig, dass sein alter Herr nun einsitzt, und im
Westen ist man darüber sogar befriedigt
. Ein
erster Schritt in die richtige Richtung
, heißt es
aus der Zentrale für Weltgerechtigkeit in Washington, und
die europäische Filiale lässt sich mit der Großzügigkeit
vernehmen, dass man auf den zweiten und abschließenden
Schritt durchaus ein wenig zu warten bereit sei. Nicht
auch noch direkt ins Gesicht schlagen
(nett,
der NATO-Generalsekretär)
wolle man denen in Belgrad, sie nicht gleich beim ersten
Entgegenkommen vollständig zu bloßen Handlangern
degradieren, was umgekehrt freilich nicht heißt, dass sie
keine wären: An einer Auslieferung von Milošević führt
für sie selbstverständlich kein Weg vorbei.
Seitdem ist die Belgrader Staatsführung darum bemüht,
rechtliche Gesichtspunkte zu finden, unter denen
sie Milošević den Prozess machen kann:
Souverän möchte man schon gerne bleiben, wenn
man dem westlichen Rechtsanspruch Genüge tut. Insofern
der aber einfach nur dadurch zu erfüllen ist, dass sich
Jugoslawien mit seinem Recht dem höheren Recht des
Westens unterwirft, ist das Erscheinen von Milošević vor
dem Tribunal in Den Haag eine Frage der Zeit, die der
Westen Jugoslawien zur Wahrung des Gesichts
gewährt.