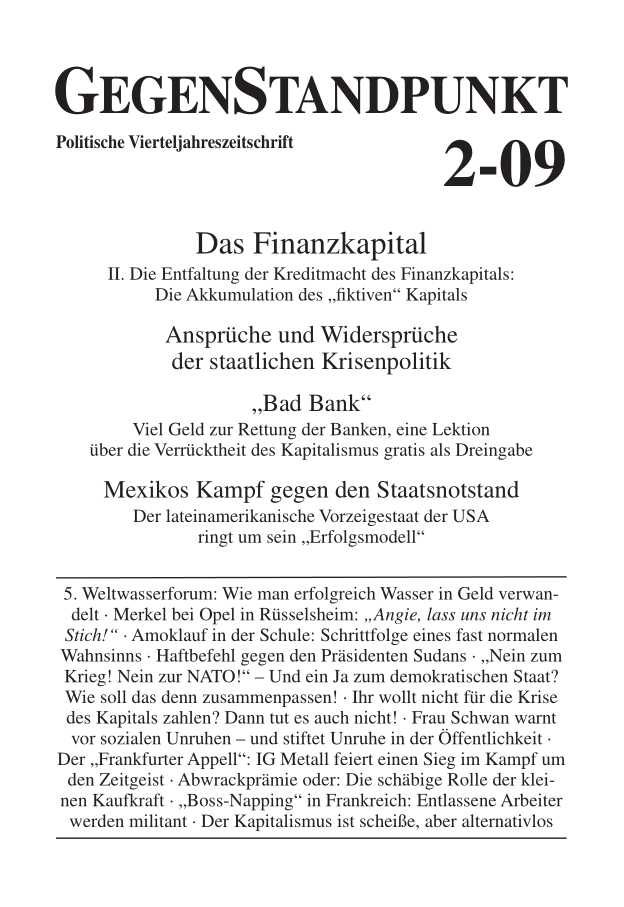Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Amoklauf in der Schule:
Schrittfolge eines fast normalen Wahnsinns – Hundert Faktoren und kein Grund
Ein Schüler kommt bewaffnet in die Schule, erschießt einigermaßen wahllos Mitschüler, Lehrer und am Ende sich selbst. Das passiert zwar nicht jede Woche, aber mittlerweile doch so oft, dass die Meldung eines solchen Amoklaufs nur noch mäßig überrascht. So geht die Polizei Jahr für Jahr Hunderten von „ernstzunehmenden“ Amok-Drohungen nach. Wenn dann allerdings einige wenige den Schritt zum tatsächlichen Gemetzel tun, steht die Öffentlichkeit immer wieder neu so „erschüttert“ wie „fassungslos“ vor der Tat.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Amoklauf in der Schule:
Schrittfolge
eines fast normalen Wahnsinns – Hundert Faktoren und
kein Grund
Ein Schüler kommt bewaffnet in die Schule, erschießt einigermaßen wahllos Mitschüler, Lehrer und am Ende sich selbst. Das passiert zwar nicht jede Woche, aber mittlerweile doch so oft, dass die Meldung eines solchen Amoklaufs nur noch mäßig überrascht. So geht die Polizei Jahr für Jahr Hunderten von „ernstzunehmenden“ Amok-Drohungen nach. Wenn dann allerdings einige wenige den Schritt zum tatsächlichen Gemetzel tun, steht die Öffentlichkeit immer wieder neu so „erschüttert“ wie „fassungslos“ vor der Tat.
Zwar melden sich sogleich „Experten“ zu Wort und machen sich – je nach Zuständigkeit und Fach – ein wenig wichtig mit einem so genannten „Faktor“, der bei der „Tragödie“ hineingespielt habe: die Waffen, an die man so verlockend leicht herankomme, die Videospiele, die einen brutalen Einfluss hätten, das Zuhause, wo kein rechtes Glück sei, die „gestörte Persönlichkeitsstruktur“ des Täters selbst, nicht zuletzt die Schule, die vom pädagogischen Klima her versagt habe.
Bloß: Mehr als einen „Faktor“ wollen alle die Experten zum „hochkomplexen“ Geflecht von „möglicherweise hundert oder mehr Einflussfaktoren“ gar nicht beigesteuert haben. So dass man in den Medien, wo die Volksmeinung betreut wird, mit dem Resümee abwinken darf, dass es sich bei solchen Versuchen, die Tat zu „verstehen“, um nicht mehr handle als um einen hilflosen „Reflex, das Unerklärliche erklären zu wollen“, und bereits Stunden nach dem Gemetzel lassen auch die Politiker wissen, dass die Untat „unfassbar“ und „in keiner Form erklärbar“ (A. Merkel / G. Oettinger) sei. Schon vor 7 Jahren verlangte der damalige Bundespräsident beim Amoklauf von Erfurt das Eingeständnis: „Wir verstehen diese Tat nicht“ und sein Nachfolger fordert nun anlässlich der Bluttat von Winnenden öffentliche „Ratlosigkeit“, was ihm das Lob einträgt, „eine der besten Reden seiner Amtszeit“ gehalten zu haben.
Diese Anleitungen sind nicht misszuverstehen als geistige Ohnmachtsbekundung oder Mahnung, sich erst wieder zu melden, wenn man in der so vielschichtigen Materie weitergeforscht und was herausgebracht hat. Das so ausgesprochene Erklärungsverbot ist vielmehr die ganze „Erklärung“, die insofern bereits fertig ist, als sie schlicht im Standpunkt besteht, dass der „Wahnsinn kranker Einzeltäter“ aus der Normalität auszugrenzen ist – welche soweit dann wieder in Ordnung wäre. Deshalb findet es der schwäbische Ministerpräsident vom Amokläufer in seinem Bundesland „besonders gemein, die Schule, einen Ort der Zukunft, der Bildung und der Erziehung“ zum Schauplatz gewählt zu haben.
Hat die Schule versagt? Von wegen versagt!
Allerdings sind es hier Schüler, die genau die Schule als Kulisse ihrer Racheakte wählen. So sehen sich kritische Stimmen aufgerufen, die unsere Schulkultur nicht erst jetzt mit ihrer Unzufriedenheit begleiten und die das „School Shooting“ als dramatische Bestätigung nehmen, die genau sie für die fälligen Talkshows empfiehlt. Dort fragen sie dann in die Runde, ob sich (unter anderem) nicht auch die Schule „ein Versagen“ eingestehen müsse und an den Bildungsstätten nicht einiges schief laufe.
Schief ist jedenfalls der Blickwinkel dieser Schulkritiker, die meinen, dass vieles, was ihnen missfällt, bis hin zum Mord-Spektakel, nicht sein müsste, wenn man die von ihnen schon seit Jahr und Tag angemahnten Korrekturen beherzigen würde. Mit einer Portion Verständnis für die durchgedrehten Schüler halten sie das Klima, das mit der schulischen Leistungsselektion einhergeht, für gefühlskalt bis unmenschlich. Die Lehrer würden nur Noten verteilen, aber die seelischen Härten, die damit verbunden sind, nicht abfedern, weil sie pädagogisch zu wenig geschult oder fortgebildet seien. Die Selektion selbst werde zu früh angesetzt – und sei nicht überhaupt das Ausbildungswesen zu „leistungszentriert“?
Dass die Selektion – früher oder später oder mit etwas weniger Leistungsdruck oder mit mehr Einfühlungsvermögen – vollzogen wird, stellen die Schulkritiker nicht in Frage. Womit auch ihr Vorwurf, alles drehe sich um Leistung, daneben ist. Denn es geht in der Schule genau nicht darum, dass alle die verlangte Lernleistung erbringen, sondern es werden Leistungsunterschiede in einem Vergleich festgestellt, der es vorsieht, dass es neben „leistungsstarken“ immer auch „leistungsschwache“ Schüler gibt. Es geht nicht darum, die Grundbestände gesellschaftlichen Wissens zum Allgemeingut zu machen, sondern darum, die Beschulten zu sortieren. Dabei bezieht sich die Selektion auf Unterschiede, die sie am Schülermaterial vorfindet: Unterschiede an Vorkenntnissen, an Aufmerksamkeit, wie gut einer überhaupt Deutsch kann; hat er Eltern, die ihm sachlich helfen, Nachhilfe zahlen können, oder solche, die nur mit moralischen Ermahnungen nerven? Die Schule macht da keinen Unterschied, die Frist zum Aneignen sowie fürs Ausspucken des Stoffes ist für alle gleich. Die erteilte Zwei oder Fünf sagt nichts über den Inhalt des Kenntnisstandes, sondern übersetzt diesen in eine Zahl, nur um ihn unterscheidbar zu machen von dem der Mitschüler. Über das Vorrücken im Stoff entscheiden die Noten nicht – da geht es nach jeder Prüfung ohnehin weiter, egal, wer nun wie viel weiß oder nicht weiß. Dieses Verfahren, systematisch Leistungsunterschiede hervorzubringen, ist alles andere als ein Versagen der Anstalt, sondern schlicht ihr Zweck. So nämlich produziert diese Konkurrenz Gewinner, Verlierer und ein Mittelfeld dazwischen, und es ist kein Geheimnis, wofür: Die Schule beliefert damit die getrennt von ihr feststehenden Positionen der Klassengesellschaft, wo es höhere mit besserem Einkommen und viele schlechtere mit viel Arbeit für wenig Lohn gibt – wenn überhaupt. Diese paar dürren Wahrheiten könnten Schulveränderer und sonstige berufsmäßige Kinderfreunde wohl auch wissen, aber so grob und schmucklos hinsagen wollen sie das nicht.
Vielmehr machen sich Idealisten der Erziehung ein Bild von der Schule, das die Sache mit der Selektion umdreht und in dem sich auch die Lehrer schon besser gefallen. Demzufolge stellen sie keine Unterschiede her, sondern sie ermitteln nur, was die Schülerperson unabhängig von der Schule an Potenzial so mitbringt und überhaupt drauf hat. Da mag sich der gestandene Lehrer einbilden, spätestens auf den zweiten Blick zu wissen, wen er da vor sich hat: „Zu mehr reicht es bei dem oder bei der nun mal nicht“. Diese wohl häufigste Diagnose in den Lehrerzimmern ist der tägliche Ableger der Ideologie, welche die bürgerliche Ausbildung generell über sich verbreitet. Dass sie nämlich nichts anderes macht als mit ihrem Test auf die Tauglichkeit in der schulischen Konkurrenz einem jeden den zu seinen „natürlichen“ Anlagen und Eignungen passenden Platz anzuweisen – für die Konkurrenz danach. Deshalb sind sich die praktizierenden Menschenkenner auf den Notenkonferenzen in der Regel sicher, dass man dem einen oder anderen nur zu seinem Besten die Weiterbildung erspart. Aber auch kritische Pädagogen, die die Sorge umtreibt, ob vorschnelle Bewertungen nicht so manche schlummernde gute Anlage ausbremsen oder verkennen, halten die Schule für eine Art Talentschuppen und wollen mit dem Ideal einer gerechten Sortierung richtig schön ernst machen.
Der Schüler und sein spezieller Wert
Die Objekte der Auslese machen da – praktisch und theoretisch – mit. Praktisch stellen sich die Schüler der Konkurrenz, der sie unterzogen werden, indem sie sich zum Mittel des Erfolgs in ihr herrichten. Den Ernst des Lebens kriegen sie da schnell mit, und kaum haben sie Buchstaben und Zahlen abgemalt, steht die erste grobe Weichenstellung ins Haus. Die Auslese für die höheren Schulen ist eine maßgebliche Vorentscheidung des Lebensweges, was heute bereits Acht- und Neunjährige auch daran merken, dass die Eltern sie zur Nachhilfe und zum Psychologen schicken. Was das Konkurrieren in der Schule angeht, haben sie bald kapiert, wie der Laden läuft: Die erste und bleibende Lektion ist, dass es beim Lernen von Wissen jeder Art immer um das Gleiche geht, nämlich um die Noten, die man dafür kriegt. Was Lehrer, ausgerechnet sie, immer wieder beklagen, dass nämlich den Schülern der Inhalt, anhand dessen sie die Sortierung vornehmen, ziemlich egal ist, ist genau die zwar absurde, aber sachgerechte Einstellung: Gelernt wird für den Schulerfolg – wofür sonst? Weil dieser relativ, also über den Vergleich zu den Mitschülern, ermittelt wird, heißt es, sich mit jedem Wissensbrocken hervorzutun, wenn nötig, bei dieser Selbstdarstellung auch mal Interesse am Inhalt zu heucheln, also so zu tun, als gehe es einem nicht bloß um die Note, weil das nämlich benotet werden könnte.
So zieht die Schule sich diese berechnende Konkurrenzfigur heran, eine Persönlichkeit, die den Beruf Schüler auch ihrerseits mit den passenden Interpretationen zu unterlegen weiß. Den Zwang zu dieser Konkurrenz legen sich ihre Aktivisten dabei gerne als Gelegenheit zurecht, Leistungswillen und -fähigkeit als persönliche Eigenschaften zu entfalten. Die verlangten Anpassungsleistungen erscheinen ihnen dann wie ein Angebot zur Verwirklichung ihres Selbst und zur Anerkennung des ihm zustehenden Erfolgs. Die Sichtweise, dass man nicht etwa lernt, weil man noch nichts weiß, sondern dass man da hingeht, um etwas aus sich zu machen, weil man ein Potenzial hat oder ist, dass es also in diesem Sinne voll auf einen selbst ankommt, diese Sichtweise dürfte dem Individuum auch von seiner Lebenswelt außerhalb der Schule nicht unbekannt sein. Wo jedenfalls die Schule vom Potenzial spricht, sagt der Schüler, das hat er. Wo die Schule auf die Unterscheidung aus ist, nehmen Schüler-Individuen das als Einladung, auf ihre Unterschiedlichkeit Wert zu legen und mit ihrer Besonderheit hausieren zu gehen. So lassen sich Noten als sehr persönliche Schwächen oder Stärken deuten, und es soll als Ausweis der Individualität gelten, Mathe einfach nicht zu können, was dann aber schon durch die Angeberei mit einer anderweitigen Begabung ergänzt sein will. Kaum hat einer einmal mit zählbarem Erfolg im Fach Deutsch herumschwadroniert, mag er sich für einen eher kreativen Typ halten und meint vielleicht, dass diese Spezies überhaupt mehr Anerkennung verdiene. Solche Übersetzungen der Resultate der Konkurrenz in persönliche Eigenheiten lassen sich bis zu der Einbildung verdünnen, dass man vom Typ her letztlich eben ein Winner oder ein Loser ist.
Die Zeugnisse nehmen Schüler also nicht nur als Bewertungen ihrer schulimmanenten Konkurrenztüchtigkeit, sondern darüber hinaus als Urteile über den Wert der eigenen Person und gleichen diese mit ihrem Selbstwertgefühl ab. Mit dem Übergang in diese Psychologie wird die Schule zum Ort persönlicher Triumphe oder aber Blamagen, und Durchfallen ist dann weniger der praktischen Folgen wegen schlimm, sondern womöglich demütigend. Wenn dann ausgerechnet die Schule selber ihre Wichtigkeit dementiert und den Aussortierten das Kompliment anträgt, dass sie als Menschen gleichwohl wertvoll sind, da Noten doch nicht alles über eine Person aussagen, so ist das einerseits die berechnende Beschwichtigung, die der Konkurrenz-Veranstaltung die unschönen Disharmonien nehmen soll. Zum anderen bestätigt die Relativierung haargenau das Prinzip, nach dem sich die Leute der Pflege ihres Selbstwertgefühls widmen.
Immerhin so viel Realismus steckt im albernen pädagogischen Trost: Wenngleich die Schüler eine beachtliche Zeit auf die Schule als ihren Lebensraum festgelegt sind, meinen sie tatsächlich nicht, dass die Schule das ganze Leben ist. Sie beschränken ihre Selbstwertpflege ja auch keineswegs auf die Paukanstalt. Da mag der Einserschüler sich ziemlich was auf sich einbilden, aber nur Streber will er nicht sein, zumal ihm als Spitzentyp doch allenthalben Anerkennung winken sollte. Das wiederum glauben aber auch viele „Schul-Versager“ von sich, vielleicht gerade sie. Auch bei ihnen ist zumindest das Lernziel Selbstbewusstsein angekommen, und die wenigsten legen sich die pflegeleichte Einstellung zu, zum Verlierer geboren zu sein. Wenn schon die Schule ihre Person bewertet, drehen sie den Spieß um und beurteilen die Schule, ob sie ihrer werten Person überhaupt gerecht wird. Zum Schulalltag gehört die Beschwerde, dass die schlechte Platzierung eigentlich gar nicht sein kann, dass man sie nicht verdient hat. Also lastet man sie dem Lehrer an, der das eigene Potenzial entweder schlecht motivieren kann und/oder ein Arschloch ist, das einen nicht leiden mag.
Nicht wenige versuchen die Maßstäbe der Schulkonkurrenz als solche zu ignorieren, indem sie sich nach anderen Schauplätzen umtun oder diese vorfinden, wo sie dann aber nicht von der Konkurrenz die Schnauze voll haben, sondern im Reich ihrer paar Freiheiten alternative Konkurrenzen aufmachen, in denen sie die Weltmeister sein wollen. Wenn sich dann mit Fäusten statt mit Goethe-Sprüchen Respekt verschafft wird und dafür Mitschüler im Pausenhof oder Opas in der U-Bahn herhalten müssen, ist das die rohe Variante, Belege der eigenen Überlegenheit abzuliefern, und der Applaus beschränkt sich auf das eigens dafür formierte Cliquenwesen. Über kompensatorische Anstrengungen dieser Art zerstört sich mancher den Rest an Chance in der Konkurrenz, die wirklich zählt.
Dabei hat die bürgerliche Welt für das Bedürfnis, alles Mögliche zum Material des Anerkennungswahns zu machen, auch ein buntes Angebot ziviler Kulissen parat. Da gibt es schon kaum eine Freizeitbetätigung, die nicht zur Bühne der Ego-Pflege wird, weshalb sie dann eher kein Vergnügen ist. Da werden Rekorde in coolem Outfit, Chatmarathons, plakativen Hautverletzungen oder Komasaufen gebrochen. Mancher Studienrat mag über seine Früchtchen den Kopf schütteln, aber von der Denkart der bürgerlichen Konkurrenzpsychologie her passt der Nachwuchs mit seinen Idiotien und Angebereien doch ganz gut in die Landschaft. Die (nicht nur in Amerika) anerkannte Psycho-Logik, dass ein Super-Selbstbewusstsein nicht erst der ideelle Ertrag des Konkurrenzerfolgs ist, sondern das beste Mittel, ihn einzufahren, hat schließlich gerade in den höheren Etagen der Arbeitswelt ihr Gewicht. Also ist es doch gerecht, dass der Kult der Selbstdarstellung auch in der Unterhaltungssphäre passende Stilblüten treibt und sich nachwachsende Größenwahnsinnige in die Fernsehstudios aufmachen, wenn Deutschland den Superstar sucht.
Verletzte Ehre will Rache
Klar, dass auch die privaten Konkurrenzen die Anerkennung
so wenig verbürgen wie die schulische Konkurrenz. Wenn
das Subjekt die Diskrepanz zwischen den eingesammelten
Bewertungen und dem Selbstwertgefühl registrieren muss,
kann es beschließen, umso mehr auf dem eigenen Wert zu
beharren und sich geradezu ein Recht auf dessen
Anerkennung einzubilden. Ist dieser Standpunkt
eingenommen, geht es nicht mehr um diese oder jene
Besonderheit, für die man den Beifall sucht. Sondern da
geht es insofern stets ans Eingemachte, als die
Betreffenden bei jeder Gelegenheit ohne speziellen Inhalt
oder Umstand sogleich bei der grundsätzlichen Frage der
Ehre landen und den abstrakten Respekt vor der eigenen
Person einfordern. Wer so tickt, deutet jede ausbleibende
oder auch nur subjektiv vermisste Anerkennung als
Verweigerung derselben und damit eben des Rechts
darauf, das einem zusteht. Ob etwa Lehrer oder
Mitschüler, die einen schwach anreden, was sicher
vorkommt, das tatsächlich als diese Erniedrigung meinen
oder nicht, ist für die eigenwillige Sicht der gekränkten
Ehre belanglos: Sie nimmt es so oder so als weiteren
Beleg unter vielen dafür, dass hinter all den
Demütigungen lauter Mitmenschen auszumachen sind, die
warum auch immer genau diesen bösen Willen haben. So ist
mit dem Grund zugleich die Adresse der Rache,
die Genugtuung verschaffen soll, gefunden: Die Rache
kehrt die Richtung der Ehrverletzung um, indem sie über
die Schuldigen das Urteil fällt, dass sie es sind, die
nichts wert sind. Wer auf Rache sinnt, will nicht nur die
Schmach nicht auf sich sitzen lassen, sondern ist
überzeugt, dass das erlittene Unrecht ihm das Recht gibt,
die Bösen dafür zu strafen: Seit meinem 6. Lebensjahr
wurde ich von euch allen verarscht! Nun müsst ihr dafür
bezahlen.
(Abschiedsbrief /
Emsdetten)
Und so beansprucht die Rache ihren Platz im Gedanken- und
Gefühlshaushalt der Subjekte, betätigt sich in der
Fantasie, wo bekanntlich so mancher Lehrer dran glauben
muss. Oder sie gibt den Stoff für diesbezügliche Sprüche
im Pausenhof, was Polizei- und andere Psychologen von
ihrem Fahndungs- oder Präventionsstandpunkt her als
Problem entdecken: Müsste man jede auf dem Schulhof oder
sonst wo (ab)gehörte Drohung als Ankündigung eines
Amoklaufs ernst nehmen, könnte man die „Orte der Zukunft“
dauerhaft evakuieren. Da passt es wohl besser ins Bild,
diese Drohungen als ganz inhaltslos herunterzuspielen und
einer natürlichen Lebensphase der Jugend zuzuschreiben:
In der Pubertät klopfen Jugendliche gern harte Sprüche
und sagen schon mal: ‚Ich bring die um!‘ Die Lehrerin
etwa, die schlechte Noten gegeben hat
(So eine Professorin für Kriminologie, SZ,
12.3.09). Als würden sich freundliche Ansagen
dieser Art auf Jugend und Schule beschränken.
Ob einer den Übergang von der Rachefantasie zum blutigen Ernst beschließt und den Schritt zu diesem Wahnsinn tut, hängt an der Radikalität, an der Ausschließlichkeit, mit der er seinen Lebenssinn ganz auf das Recht, Ehre zu verdienen, ausgerichtet hat, so sehr, dass er all die so empfundenen Verletzungen dieses Rechts nicht mehr aushalten will.
Die gewöhnlichen Berechnungen des
Konkurrenzsubjekts muss dieser Fundamentalist des
Ehrgefühls weit hinter sich gelassen haben, andererseits
bestätigt er auf seine Art noch in der Tat selbst die
Denkweise der Konkurrenz, aus der er sich endgültig
verabschiedet: Er zeigt es allen, dass er doch ein Sieger
ist, und das in einem viel grundlegenderen Sinn, als das
der lächerliche Wettlauf um Noten oder andere
Statussymbole ermittelt. Das Urteil seiner Wertlosigkeit,
das die Mitwelt vermeintlich über ihn gesprochen hat,
will er zurechtrücken und umkehren, indem er den
Beweis erbringt, dass er tatsächlich die Macht
hat, sich zu rächen, d. h. sich die Ehrverletzungen nicht
bieten zu lassen, sondern sie zu bestrafen und damit
seine Opfer ihrer Wertlosigkeit zu überführen. Dass die
Gewalt das unwiderlegbar praktische Argument des
Rechts ist, hat der junge Zeitgenosse offenbar
mitbekommen, und zwar nicht von den Computerspielen. Die
Höchststrafe der Hinrichtung scheint ihm offenbar die
angemessene Antwort auf die Schwere des Verbrechens zu
sein, sich an seiner Ehre vergangen zu haben. Kein
Bulle hat das Recht mir die Waffe wegzunehmen
(Abschiedsbrief /Emsdetten).
Diesen Wahn schließlich kann der Amokläufer sich nur
beweisen, indem er selbst sein Gemetzel nicht überlebt.
Der Nachruf: Ganz ohne Sinn darf das Grundlose nicht sein!
Der größte Teil der öffentlichen Besprechung hat sich für
amoklaufende Schüler auf das Merkmal unauffällig
verständigt: unauffällig als Schüler, als Sohn, als
Killerspieler und überhaupt. Das nehmen viele
Kommentatoren sogleich als für sich selbst sprechenden
Beleg dessen, was sie schon immer gesagt hätten: dass
sich jeder Versuch, den Grund für die Tat in der Schule
und Gesellschaft zu suchen, verbietet und blamieren muss,
wenn da doch gar keine Probleme aufgefallen sind. Was
wieder – siehe Anfang – für die Rätselhaftigkeit dieses
Wahnsinns spreche.
Sollte ein Amokläufer (wie der von Erfurt) als Schüler doch auffällig geworden sein, passt sein Fall aber auch in den Trichter der gleichen Logik: Viele fliegen doch von der Schule, ohne Amok zu laufen, so lautet dann der schlagende Beweis, dass das eine nicht der Grund für das andere sein kann. Dabei lassen diese „Gewalttheoretiker“ und andere „Experten“ als Erklärung nur die deterministische Vorstellung eines Mechanismus gelten, wo auf den Knopf mit der Aufschrift „Misserfolg“ gedrückt wird und fertig ist der Amokläufer. Dieser Kurzschluss von Ursache und Wirkung ohne Wille und Bewusstsein dazwischen, diese Zwangsläufigkeit wird insgeheim unterstellt, um dann die „Fehlanzeige“ zu vermelden. So kann auch diese Zurückweisung einer „Erklärung“ die Verrätselung bekräftigen und in den Befund von der Grundlosigkeit der Tat münden.
Vor einem eher praktischen Rätsel fahndungstechnischer
Art stehen die Polizei und ihre Profiler, wenn sie die
Unauffälligkeit der Täter als Schwierigkeit oder
Unmöglichkeit beklagen, Amokläufer frühzuerkennen. Die
Experten von der psychologischen Wissenschaft können da
zwar praktisch auch nicht weiterhelfen, aber kriegen es
hin, in eben der Unauffälligkeit das Gegenteil zu
entdecken, jedenfalls einen wichtigen Faktor, der selbst
maßgeblich zur Tat beiträgt. Es sei eben ganz fatal, wenn
das Subjekt seine Aggressionen in sich hineinfrisst und
„mit sich selbst ausmacht“: Aufgrund ihrer
Persönlichkeitsstruktur beginnen die Täter, sich immer
mehr zurückzuziehen und einzugrübeln; nach einer kurzen
Suchphase kommt es raptusartig zur Tat
(meint ein Psychiater, SZ, 18.4.07). So
trennt auch diese Sichtweise die Tat von jedem objektiven
Grund, indem sie die „Aggressionen“ als etwas Normales
unterstellt, um die so genannte Störung in das verkehrte
subjektive Handling dieser Gefühle zu verlegen, deren
gedanklicher Inhalt dieser Theorie egal ist .
Von diesem Standpunkt her kann man Computerspiele für verhängnisvolle Reizmittel aggressiver Dispositionen halten und zum Verbot mahnen oder aber als Medienpädagoge einen „Medienführerschein“ für die Jugend fordern, nebst Ego-Shooter-Fortbildungen für die Eltern, damit sie und ihr gewaltspielender Nachwuchs „auf Augenhöhe“ und kompetent über „Counterstrike“ diskutieren. (SZ, 2.4.09) Denn es können, wer hätte das gedacht, gerade aus Killerspielern statt Amokläufer prima Ärzte werden: „Eine Studie belegt, dass angehende Chirurgen durch Ballerspiele geschickter bei Operationen sind, denn die Spiele verbessern die Koordination von Augen und Händen.“ (So ein Medienpsychologe, FAZ , 19.4.). Überhaupt sei die den „Aggressionstrieb“ abführende Ventil-Wirkung dieser Spiele nicht zu verachten, Blutorgie virtuell quasi immer besser als real. Genau in dieser Denkart lässt sich auch über die Entwaffnung hochanständiger Privatschützen mit ihren sympathischen Vereinen diskutieren und nach Art des Abituraufsatzes am Waffenbesitz neben dem Wider auch manches Für finden, vielleicht die Abwrackprämie für Gewehre als Synthese.
Und sollte am Ende, recht besehen, sogar der Amoklauf selbst sein Gutes haben? „Die kollektive Trauer um öffentlich Gestorbene ist zum Zeichen der Zeit geworden (...) So gesehen ist die Gedenkstunde von Winnenden ein gutes Zeichen aus furchtbarem Anlass. Weil sie den halben Antworten nach dem Warum eines fünfzehnfachen Mordes das Antwortlose entgegensetzt und eine neue Frage stellt: Wozu geschah das Sinnlose? Was folgt, was entwickelt sich nach dem Schock? Die Frage nach dem Warum hadert, die nach dem Wozu führt ins Leben zurück.“ (M.Dobrinski, SZ 23.3.). So ist die falsche Frage (Warum?) mit der richtigen (Wozu?) beantwortet und es bekommt das Grundlose doch noch seinen Sinn, wenn die um die Amokopfer trauernde Gemeinde genau ihre Gemeinschaft zelebriert, bevor es zurück zu Sortierung und Konkurrenz geht.