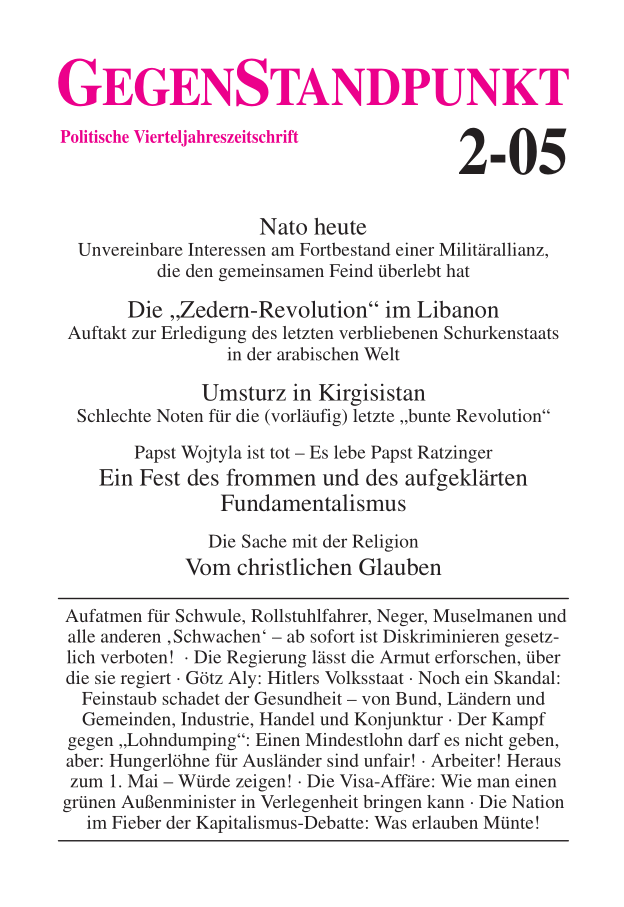Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Regierung lässt die Armut erforschen, über die sie regiert:
Wissenschaftler ringen um den „Armutsbegriff“
Das Forschungsergebnis – die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer – ist wirklich nichts Neues und wird auch von keiner Seite ernsthaft bestritten. Im Gegenteil: Löhne runter und Profite rauf ist das erklärte Kampfprogramm, mit dem die regierenden Sachverständigen für Wirtschaft den Standort an die Weltspitze führen wollen. Nach 4 Jahren Studium und 370 Seiten landen die regierungsunabhängigen Sachverständigen für Armut bei haargenau der gleichen Therapie. Fragt sich nur, wie?
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Regierung lässt die Armut
erforschen, über die sie regiert:
Wissenschaftler ringen um den
„Armutsbegriff“
Im März kommt der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung heraus, und die Öffentlichkeit
interessiert sich dafür genau eine Meldung lang. Das
reicht auch, denn das Forschungsergebnis – die Reichen
werden immer reicher, die Armen immer ärmer – ist
wirklich nichts Neues und wird auch von keiner Seite
ernsthaft bestritten. Im Gegenteil: Löhne runter und
Profite rauf ist das erklärte Kampfprogramm, mit dem die
regierenden Sachverständigen für Wirtschaft den Standort
an die Weltspitze führen wollen. Nach 4 Jahren Studium
und 370 Seiten landen die regierungsunabhängigen
Sachverständigen für Armut bei haargenau der gleichen
Therapie: Förderung von Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit … weitere Senkung der
Lohnnebenkosten … neue Formen der privaten Sicherung …
Anreize zur Aufnahme von Erwerbsarbeit im
Niedriglohnbereich
(S.196ff). Von wegen Arme bräuchten mehr
Geld! Auch Armutsforscher gelangen zu der äußerst
vernünftigen Einsicht, dass Armut nur durch mehr
Verarmung bekämpft werden kann.
Die Botschaft, mit der diese Wissenschaftler in den Grundkonsens der Schröder-Republik einstimmen, ist keinen zweiten Blick wert, eher schon die verschlungenen Pfade, auf denen sie sich zu ihrer recht konventionellen Botschaft hinarbeiten.
Armut vermessen statt Armut erklären
Armut ist nichts Schönes; Armut festzustellen, ist noch allemal eine Kritik an der Gesellschaft, in der sie mit wachsendem Reichtum immer nicht weniger werden will, eher umgekehrt, also offenbar systematisch dazugehört. Das ist auch den Damen und Herren Armutsforschern klar – und eben deswegen wollen sie offensichtlich diese Diagnose keinesfalls so stehen lassen. Heute ist man aber nicht mehr so naiv, die massenhafte Armut einfach zu leugnen – etwa durch das schöne Argument, dass es bis auf ein paar Ausnahmen allen doch bestens gehe, man arbeitet sich vielmehr zu einem ‚differenzierten Bild‘ der leidigen Sache hin, die sie in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und das geht so:
„Armut und Reichtum sind als gesellschaftliche Phänomene untrennbar mit Werturteilen verbunden. Hinter jeder Interpretation des Armuts- und auch des Reichtumsbegriffs und hinter jedem darauf beruhenden Messverfahren stehen Wertüberzeugungen. Deshalb ist die Aufgabe, Armut „messbar“ zu machen, im streng wissenschaftlichen Sinn nicht lösbar. Möglich ist aber, ein differenziertes Bild über die Gesellschaft und über soziale Ungleichheit zu zeichnen.“ (S.5)
Als erstes geben die Forscher, die im Regierungsauftrag den Stand der Armut im Land ermitteln sollen, erst einmal die Unmöglichkeit zu Protokoll, die ihnen gestellten Aufgabe befriedigend zu lösen. Streng wissenschaftlich und objektiv gesehen ist es unmöglich, etwas Haltbares zur Armut zu sagen. Damit ist vor jedem bestimmten Urteil die Selbstverständlichkeit getilgt, dass es die Sache gibt, von der jeder, der sie zu erforschen verspricht, ebenso selbstverständlich ausgeht wie die Ministerin, die einen Armutsreport in Auftrag gibt. Es ist ja nicht so, dass das ‚Phänomen‘ Armut unbekannt wäre; nicht einmal das ist irgendjemand ein Geheimnis, dass dieses ‚Phänomen‘ mit der Art und Weise zu tun hat, wie in dieser Gesellschaft der Reichtum produziert und verteilt wird, dass in einem System, wo Rentabilität und Kostenkalkulation das Produzieren bestimmt, der Lohn Kost ist, Arbeit also billig und ertragreich für ihre Anwender zu sein hat, sich der Reichtum regelmäßig auf der einen Seite vermehrt, auf der anderen aber eher nicht… Das einzig Interessante und Aufklärenswerte wäre also – ‚streng wissenschaftlich‘ gesehen – die Frage nach der Notwendigkeit des allen Bekannten, warum und wie mit dem Reichtum, der in dieser Gesellschaft produziert wird und regelmäßig nur gewisse Kreise bereichert, zugleich die Armut, der Ausschluss von diesem nicht gerade knapp bemessenen Reichtum, mitproduziert wird. Nicht so die Armutsforscher. Die Befassung mit der verbreiteten Armut, deren Erklärung unweigerlich in ein – nicht gerade positives – ‚Wert‘urteil über die Gesellschaft mündet, bezichtigen sie, selbst einer vorgängigen subjektiven Wertung zu entspringen: Damit wird die Armut, die zu dieser Gesellschaft systemnotwendig dazugehört wie das Amen in der Kirche, zu einem nur subjektiv gesehenen Faktum zurückgenommen, dessen Anerkennung von Wertung und Gesinnung abhängt.
Natürlich haben die Armutsforscher deshalb keineswegs vor, den unmöglichen Auftrag und die dazugehörigen Fonds zurückzugeben. Im Gegenteil: Der Unmöglichkeit eingedenk, lässt sich die restlichen 365 Seiten viel zur Armut sagen, „differenziertes“ sogar, so die Auskunft. Man erklärt das Faktum der Armut zum methodischen Problem seiner Erfassbarkeit – und befasst sich fortan mit diesem Problem. Man macht sie wissenschaftlich fragwürdig – und eröffnet sich unter der Beteuerung von Skrupeln und Vorbehalten die Freiheit, einen genehmen, den eigenen Überzeugungen entsprechenden „Armutsbegriff“ zu basteln, ihn zu interpretieren und zu operationalisieren, damit man mit seiner Hilfe die unübersichtliche Empirie sortieren und in ihr die Armut finden kann, die man finden wollte.
Zweitens definieren die Armutsaufklärer die Aufgabe einer wissenschaftlichen Befassung mit dem verbreiteten ökonomischen Mangel, unter dem massenhaft Leute in unserer Gesellschaft mit ihren Methoden der Reichtumsvermehrung leiden, in einer Weise, die erst recht die Sache verflüchtigt, deren Erklärung sie da ganz ‚exakt‘ anzugehen behaupten: Man muss sie ‚messbar‘ machen, sonst entbehrt sie der Objektivität. Man muss den Verfassern des Armutsberichts direkt recht geben: Wenn es die Aufgabe sein soll, Armut empirisch zu vermessen, dann braucht es dafür tatsächlich ein methodisches Vorurteil, das die Messlatte abgibt. Vermessen ist allerdings sehr verschieden vom Erklären des Massenphänomens Armut, das immerhin als so gewöhnliches und gewichtiges gesellschaftliches Problem anerkannt ist, dass seine Berücksichtigung mit dem Titel ‚sozial‘ den Staat, die Marktwirtschaft, sogar das Gewissen der Verantwortlichen… kennzeichnen soll. Jeder kennt im übrigen genügend Fälle des Tatbestands, dass massenhaft Mitglieder der Gesellschaft sich wegen Geldmangels von den durchaus massenhaft vorhandenen Mitteln des Bedarfs zu wenig leisten können und deshalb unentwegt mit Einteilungsproblemen befasst sind, während andere sich nur mit Problemen herumschlagen, die der Vermehrung ihres privaten Reichtums geschuldet sind. Für eine Ermittlung der Ursachen, warum es diese Gegensätze bei all dem ‚sozialen‘ Engagement der Verantwortlichen immer noch, immer wieder und immer mehr gibt, wäre allerdings eine Befassung fällig mit den organisierten Diensten der Geldvermehrung, die die lohnarbeitende Menschheit leisten und die ihren Lohn regelmäßig so beschränkt ausfällen lässt und für nicht wenige sogar diese Anwendung, also den Lohn selbst zu einer unsicheren Sache macht. Dazu ist die bemühte Auskunft über die Anzahl an Armen und den Grad ihrer Armut kein Beitrag. Für ein anderes ‚wissenschaftliches‘ Anliegen ist es dagegen durchaus passend und zielführend, Armut messen zu wollen und sich dann mit den Schwierigkeiten auseinander zu setzen, das passende Instrumentarium dafür zu finden – für die Frage nämlich, die die Armutsforscher sich zum Gegenstand ihres Forschens erkoren haben: Wie wenig Geld der Mensch haben muss, um überhaupt – sachverständig gesehen – als arm durchzugehen. Wer der skeptische Frage nachgeht, ob und in welchem Umfang ‚Armut‘ überhaupt nachweisbar ist, der will nichts begreifen, sondern fordert unter dem falschen Etikett „Begriff“ ein Kriterium, das ihm die Abgrenzung zwischen Armut und Nicht-Armut, und die Entscheidung über das Ausmaß existenter Armut erlaubt Wo fängt Armut an, wo hört sie auf? Ab welchem Grad von Mangel darf ich, muss ich das schlimme Wort sagen? Und – das die andere, nicht minder interessante Frage: Was fällt damit also alles nicht unter das, was mit Fug und Recht als ‚Armut‘ anzusehen, d.h. anzuerkennen ist?
„Ein bestes Messkonzept der Armut kann nicht festgestellt werden, weil den Maßstab dafür, bei welchem Einkommen, Lebensstandard oder Handlungsspielraum Ungleichheit nicht mehr hingenommen werden kann, gesellschaftliche Wertvorstellungen oder sozialpolitische Normen liefern.“ (S.8)
Ihnen geht es, sie sagen es gerade heraus, um die Scheidung zwischen tolerierbarer und nicht akzeptabler Armut.
Erst mal definieren! Welcher Armutsbegriff gefällt am besten?
Wenn man auch nicht hoffen darf, ein „bestes Messkonzept“ zu finden, lassen sich doch Notwendigkeit, Verantwortbarkeit und Nützlichkeit alternativer „Armutsbegriffe“ abwägen. Schwierig finden die Forscher da die Wahl eines vertretbaren Armutsbegriffs besonders heutzutage, wo es doch tatsächlich Arme gibt, die sich nicht gleich physisch verabschieden, sondern glatt dauerhaft in Armut leben:
„In Gesellschaften wie der unseren liegt das durchschnittliche Wohlstandsniveau wesentlich über dem physischen Existenzminimum. Hier ist ein relativer Armutsbegriff sinnvoll, um Problemlagen angemessen zu erkennen.“
Läge das durchschnittliche Wohlstandsniveau auf dem Existenzminimum, und alle, die das nicht erreichen, würden auf der Stelle verhungern, dann gäbe es keine Armen, aber von Armut könnte in objektiver Weise gesprochen werden; ein absoluter Armutsbegriff ohne anfechtbare Werturteile wäre möglich. Aber so leicht hat es die Wissenschaft in unseren bequemen Zeiten nicht mehr, in denen Armut allenfalls noch eine relative ist. Das ist gelungen: Kein Wort von der Relation, die Armut ist. Die Frage, wie Armut und Reichtum ursächlich miteinander zu tun haben, also die wirkliche kapitalistische ‚Relation‘ zwischen einer Produktion nach Rentabilitätsmaßstäben mit Lohnstückkosten und Gewinn und den Geldsorgen beschäftigter und unbeschäftigter Lohnarbeiter, ersetzen sie drittens durch eine geistige Bemühung anderer Art. Ihre Anstrengungen, dem gesellschaftlichen Phänomen auf den Grund zu gehen, bestehen in einem – wenn man einmal moralisch werden wollte – ziemlich zynischen und – wenn man es mehr wissenschaftlich nimmt – grundfalschen Vergleichswesen. Sie stellen Untersuchungen an, wie viel Geld die Menschen so im Vergleich zueinander haben, machen die begriffslose Unterscheidung in mehr oder weniger – und machen diese Unterscheidung dann auch noch nur zwischen denen, die in dieser Gesellschaft dasselbe ‚Schicksal‘ teilen, nicht die Organisatoren der Reichtumsvermehrung, sondern deren Objekt zu sein. Bei denen werfen sie die Frage auf, wann man zu deren Lebensbedingungen überhaupt Armut sagen darf, wenn doch die einen besser, die anderen schlechter gestellt sind, zu jedem potentiellen Armen sich also ein Ärmerer finden lässt, der ihn vergleichsweise reich aussehen lässt. Alles eine Frage des Anspruchsniveaus, nach dem wir die ohnehin nur relative Armut zu definieren belieben. Dabei schämen sich die Armutsforscher nicht, richtige Armut mit dem Hungern und Verhungern zu identifizieren, und alles, was nicht lebensbedrohlich ist, zur relativen, d.h. bloß halben Armut zu verniedlichen. Soviel steht also allemal fest: Echt arm kann nun sein, wer unter Brücken schläft, während andere eine Wohnung haben, wer mit richtigen Hungerleidern vergleichbar ist, während andere glatt satt werden…
So banal und undifferenziert drücken Armutsforscher das
natürlich nicht aus; sie suchen nur streng methodisch
unermüdlich nach dem Maßstab, wann etwas von diesen
gewöhnlichen Lebensumständen überhaupt zu recht ‚Armut‘
genannt werden darf, und arbeiten sich dabei zu den
feinen Differenzierungen zwischen Armut und den
gewöhnlichen proletarischen Lebensverhältnissen vor, die
man keinesfalls damit verwechseln darf. Denn so schwer
verantwortbar es auch sein mag, die subjektiv wertende
Festlegung auf einen „Armutsbegriff“ ist unverzichtbar;
es braucht schließlich eine Messlatte, mit der die
Forscher ins Datenmaterial ihren Strich ziehen, der arm
von nicht arm scheidet. Ein unlösbares Dilemma? Zum Glück
nein! Viertens nämlich kommen die Forscher zu dem
Ergebnis, dass es doch möglich ist, Armut einzugrenzen,
zu messen und einen gewissen Teil der nationalen
Mannschaft darunter zu subsumieren, bzw. einen viel
größeren aus diesem Zustand herauszudefinieren. ‚Armut‘
liegt dann ziemlich verlässlich, aber eben auch nur dann
vor, wenn Menschen unter eine Armutsdefinition fallen,
die, wenn auch nicht gerade wissenschaftlich, so doch
garantiert nicht bloß subjektiv ist: die von Staats
wegen erlassene Definition nämlich. Sie, die den
Staatsleuten sagen sollen, was Armut ist und wie es um
sie steht, bedienen sich oberschlau einer Grenzziehung,
die die Politik ganz ohne ihre Hilfe beschlossen hat, und
lassen sich von der nun ihren ‚Armutsbegriff‘ vorgeben:
Er heißt 60%. Es wird im Bericht die zwischen den
EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Definition verwendet.
Eine feine Auskunft darüber, was Gültigkeit in der
Wissenschaft heißt.
Von der Armut zum Armutsrisiko: Wer kein Geld hat, riskiert Armut!
Nach der Vorgabe der EU ziehen die Forscher dann fünftens ihre willkürliche Grenze ins Datenmaterial – das aber überaus exakt:
„Die Armutsrisikoquote ist definiert als Anteil der Personen in Haushalten, deren „bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen“ weniger als 60% des Mittelwerts (Median) aller Personen beträgt. Das Nettoäquivalenzeinkommen wird ermittelt als gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, in dem das Nettohaushaltseinkommen durch die Summe der Personengewichte – abgeleitet über die neue OECD-Skala – geteilt wird. In Deutschland beträgt die so errechnete Armutsrisikogrenze 938 Euro.“ (S.6)
Ist nun arm, wer weniger als 938 Euro zum Leben hat? Nein, so definitiv wollen die Armutsdefinierer selbst das nicht gelten lassen: Er läuft nur das Risiko, in Armut zu geraten! Die Forscher erinnern sich der Willkürlichkeit ihrer Grenzziehung und wollen über die chaotische Empirie, in der manches möglich ist, auf keinen Fall zu viel behaupten. Es könnte ja sein, dass ein an sich armer Künstler einen Mäzen hat, dessen Zuwendungen nicht im Nettoäquivalenzeinkommen erfasst werden, es könnte sein, dass einer wenig hat, aber auch wenig braucht … Zu mehr als, dass, wer kein Geld hat, in Gefahr ist, arm zu werden, lassen sie sich nicht hinreißen. Damit haben sie eine weitere Leistung ihrer Definitionskunst erbracht: Materieller Mangel, alles, was im wirklichen Leben Armut heißt, lässt diese Wissenschaft nur als Möglichkeit der Armut gelten. Armut selbst wird dadurch immer rätselhafter.
Freilich sind die Armutsforscher damit immer noch nicht
am Ende. Sie erweitern
sechstens den
„Armutsbegriff“ in Richtung auf einen höheren Sinn.
Armut ein Risiko, Reichtum eine Chance – auf Teilhabe und Selbstverwirklichung
„Einkommensarmut ist jedoch lediglich ein – wenngleich oft sehr wichtiges – Element für die Identifikation von Armut. Darüber hinaus haben auch nicht-materielle Ressourcen (wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit und soziale Kompetenzen) maßgeblichen Einfluss auf die individuellen Verwirklichungschancen.“ (S.11) „Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht begreift Armut und Reichtum als Pole einer Bandbreite von Teilhabe- und Verwirklichungschancen. Armut ist dann gleichbedeutend mit einem Mangel an Verwirklichungschancen, Reichtum mit einem sehr hohen Maß an Verwirklichungschancen.“ (S.9)
Damit kommt die Begriffsbildung an ihr antimaterialistisches Ziel. Es wird nur mehr im Modus der Möglichkeit argumentiert: Armut im landläufigen Sinn, ist eine Gefahr eigentlicher Armut, wirklicher Reichtum nichts als eine Möglichkeit wahren Reichtums – und der kommt offenbar vom Herzen! Geld macht nicht glücklich! Froh zu sein, bedarf es dagegen wenig, denn Raum ist in der kleinsten Hütte … Wer möchte schon mit einem kranken Millionär oder einem bindungsunfähigen Filmstar tauschen? Die hohe Wissenschaft verkündet die Weisheit der alten Mütterchen! Man „versteht“ Zugang zum wie Ausschluss vom materiellen Reichtum als einen Weg zum Pennälerideal des Glücks – und siehe da, beide sind bloße Möglichkeiten.
Als gleichwertige Formeln für das geglückte Leben bekommen wir Selbstverwirklichung und Teilhabe genannt: Wahrhaft und nicht nur möglicherweise arm ist demnach, wer vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen ist, keine Rolle mehr hat, durch deren Ausfüllen er sich verwirklichen könnte. Der höhere, humanistische Armutsbegriff zielt – jetzt doch wieder gut erkennbar – auf die Arbeitslosen; aber eben nicht unter dem Gesichtspunkt, dass denen das Geld zum Leben fehlt, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass sie von Arbeit und Teilhabe am Gemeinschaftswerk ausgeschlossen sind. Das ist der endgültige und letzte Ertrag der kategorialen Bastelanleitung: Wer für den Reichtum der Reichen, von dem er nichts hat, arbeiten darf, zählt nicht zu den Armen, fast schon gleichgültig, was er verdient. Nur wer keine Gelegenheit bekommt, im Dienst an Kapital und Staat zu zeigen, was für Potentiale in ihm stecken, dem wird wirklich verweigert, worauf er Anspruch hat:
„Schließlich entscheiden gesellschaftlich bedingte Chancen darüber, welche Konsequenzen sich aus den unterschiedlichen individuellen Potenzialen im Endeffekt tatsächlich ergeben.“
Dieses Unrecht trauen sich die wertfreien Wissenschaftler dann doch unverblümt anzuklagen. Kein Wunder: Abhilfe gegen den Ausschluss, Nachhilfe fürs „auf eigenen Beinen stehen“, Mobilisierung derjenigen, die das Selbstverwirklichen schon aufgegeben haben, – das alles fügt sich… Die Regierungsforscher tun ihrem Auftraggeber den Gefallen, Armut als genau das zu definieren, was der mit seiner „aktivierenden Sozialpolitik“ so überaus hart bekämpft. Damit ist der kategoriale Rahmen fertig, unter dem die weiteren 300 Seiten Zahlen und Statistiken einzuordnen und zu deuten sind. Was die Zahlen betrifft, wird nichts verschwiegen oder verharmlost über die kaputten Existenzen und zerstörten Leben, die zu unserer Gesellschaft dazugehören. Es kommt nur darauf an, sie richtig zu „verstehen“.
„Der Bericht verdeutlicht, dass das Armutsrisiko in erheblichem Umfang mit Arbeitslosigkeit korrespondiert. Wenn aber Arbeitslosigkeit die Hauptursache von Armut und sozialer Ausgrenzung ist, dann muss sich sozial gerechte Politik vorrangig an der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Integration Erwerbsloser in den Arbeitsmarkt orientieren. … Das weist auf die zentrale Bedeutung von Wirtschaftswachstum hin.“ Dazu müssen „die Lohnnebenkosten weiter sinken … usw.“ (S.194ff) – aber das hatten wir schon. Quod erat demonstrandum.
*
Der einzige Bereich übrigens, bei dem Mangel tatsächlich durch Geld behoben werden kann, ist die Armutsforschung selbst. Erstens hat sie mit der weiteren Klärung des schwer messbaren und werturteilsbehafteten Armutsbegriffs noch alle Hände voll zu tun. Und zweitens wartet längst eine noch ungelöstere Aufgabe: Wenn schon die Armut so ein ‚komplexer‘ Forschungsgegenstand ist, wie steht es dann erst mit dem Reichtum…
Die Diagnose: „Gegenwärtig kann eine vollständige Operationalisierung des sehr komplexen Ansatzes der Teilhabe- und Verwirklichungschancen noch nicht gelingen. Geeignete Messinstrumente müssen erst noch weiter entwickelt werden.“ Vor allem „bei der begrifflichen Fassung von Reichtum kann nicht in analoger Weise wie bei Armutsfragen an eine etablierte Forschungsrichtung, konzeptionelle Vorarbeiten und empirische Arbeiten angeknüpft werden.“
Die Therapie: „Die Bundesregierung hat angesichts der noch weitgehend diffusen begrifflichen Fassung von Reichtum die Forschungsaktivitäten im Rahmen der Armuts- und Reichtumsberichterstattung insbesondere zur obersten Spitze der Einkommens- und Vermögensverteilung intensiviert.“ (S.11)
Da sind noch viele Projekte und Doktorarbeiten fällig – zum Wohle der Armen!