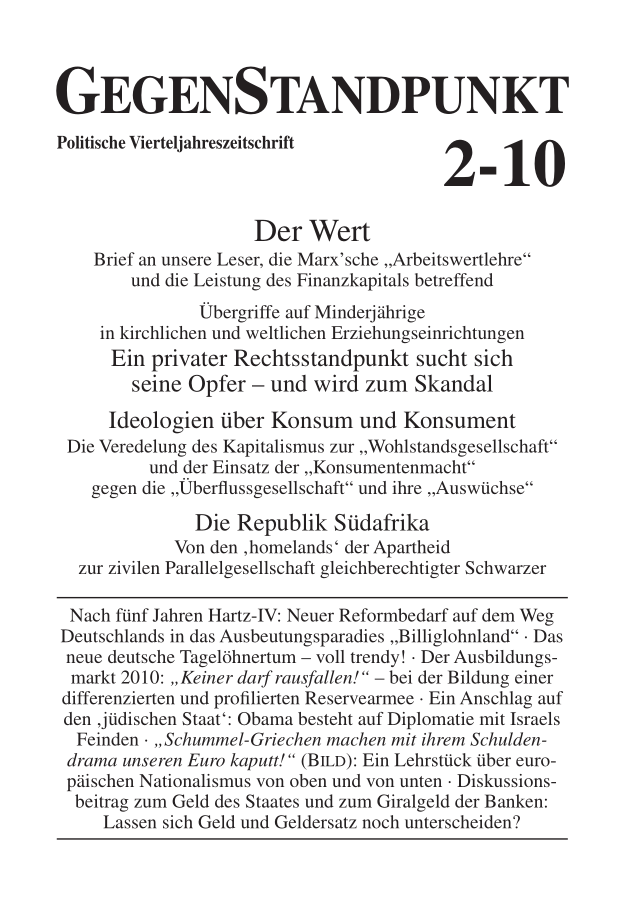Der Wert
Brief an unsere Leser, die Marx’sche „Arbeitswertlehre“ und die Leistung des Finanzkapitals betreffend
In unseren Artikeln zur Finanzkrise und zum Finanzkapital haben wir unseren Lesern Einsichten wie die zugemutet, dass die Bewirtschaftung von Wertpapieren ein Wachstum eigener Art hervorbringt, das sich den Titel „Blase“ nur dann einhandelt, wenn etwas schiefgeht. Tatsache ist ja, dass das Finanzkapital handelbare Rechtsansprüche auf Erträge akkumuliert, die mit der Produktion von Mehrwert nie und nimmer einzulösen wären. Tatsache ist auch, dass die massenhafte Entwertung solcher Anspruchstitel die gesamte Geldwirtschaft in Gefahr bringt, deswegen von den zuständigen Staatsgewalten mit einer gigantischen Wertgarantie abgewendet wird und dann sogar deren Garantiemacht in Frage stellt – ein deutlicher Beleg dafür, dass es sich bei diesen Wertobjekten nicht um eigentlich ungedeckte, „letztlich“ nichtige Ansprüche handelt, sondern um den „Kern“ des marktwirtschaftlichen Reichtums, der auf keinen Fall eine „Schmelze“ erfahren darf.
Einige kritische Leser werfen uns gleichwohl vor, dass das, was wir über den Wert finanzkapitalistischer Geldanlagen sagen, unverträglich sei mit dem, was sie bei Marx über „wertschaffende Arbeit“ gelernt haben. Weil wir in dessen Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals die theoretische Grundlage für unsere Kritik des Finanzkapitals gefunden haben, sind wir uns dagegen sicher, dass es an Unklarheiten beim Verständnis der Marx’schen Erklärung des „Werts“ liegt, wenn unsere Erläuterungen des Finanzkapitals als Widerspruch zu Marx verstanden werden. Deswegen ein grundsätzliches Angebot zur Klärung des „Werts“, also der widersprüchlichen Form des gesellschaftlichen Reichtums und der Arbeit im Kapitalismus, – für Marx-Leser und andere Interessierte.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Der Wert
Brief an unsere Leser, die Marx’sche „Arbeitswertlehre“ und die Leistung des Finanzkapitals betreffend
In unseren Artikeln zur Finanzkrise [1] und zum Begriff des Finanzkapitals [2] haben wir ein paar grundsätzliche Bestimmungen der umfangreichen Geschäfte aufgeschrieben, die das Finanzkapital jenseits der Versorgung von Landwirtschaft und Industrie mit Leihkapital betreibt. Uns selber haben wir u.a. klargemacht und unseren Lesern Einsichten wie die zugemutet, dass die Bewirtschaftung von Wertpapieren ein Wachstum eigener Art und Größe hervorbringt – das sich den Titel „Blase“ immer und nur dann verdient, wenn etwas schief geht –; dass das Finanzkapital dabei mannigfache Zuständigkeiten in der „Realwirtschaft“ gewinnt, seine Gewinne aber nicht mit Mehrwert bezahlt werden; dass darauf seine außergewöhnliche Macht beruht, mit seinen Erfolgen wie Misserfolgen über Wohl und Wehe aller geläufigen Leistungen und Interessen zu entscheiden, die den Charme der Marktwirtschaft ausmachen; etc. Tatsache ist ja, dass das Finanzgewerbe verbriefte, handelbare Rechtsansprüche auf Erträge akkumuliert, die mit der Produktion von Mehrwert nie und nimmer einzulösen wären – woraus folgt, dass es darum offenbar auch nicht geht. Tatsache ist auch, dass die massenhafte Entwertung solcher Anspruchstitel die gesamte Geldwirtschaft in Gefahr bringt, deswegen von den zuständigen Staatsgewalten auf eigene Rechnung mit einer gigantischen Wertgarantie abgewendet wird und dann sogar deren Garantiemacht in Frage stellt – ein überdeutlicher Beleg dafür, dass es sich bei diesen eigentümlichen Wertobjekten nicht um eigentlich ungedeckte, „letztlich“ nichtige bloße Ansprüche handelt, sondern um den „Kern“ des marktwirtschaftlichen Reichtums, der auf keinen Fall – wie Fachleute es in Anlehnung an den Super-GAU in der Atomindustrie gerne ausdrücken – eine „Schmelze“ erleiden darf.[3] Tatsache ist schließlich auch, dass der marktwirtschaftliche Sachverstand sein Publikum seit Beginn der Krise mit Informationen über die Konstruktionsweise und Einschätzungen von Sinn und Gefahren mehrfach verpackter Schuldpapiere zumüllt, die nichts erklären – woraus wir den Schluss gezogen haben, wir sollten eine Erklärung der politischen Ökonomie dieses Sektors der Marktwirtschaft dagegen setzen.
Dass unseren Lesern der Nachvollzug dieser Erklärung nicht leichter fällt als der Redaktion ihre Erarbeitung, ist eine Sache und jedenfalls kein Wunder. Eine andere Sache sind Reaktionen unserer Leserschaft, die auf ernste theoretische Schwierigkeiten schließen lassen, unsere Ableitung des Finanzkapitals und seiner Geschäfte aus den von Marx erklärten Prinzipien der politischen Ökonomie des Kapitals mit eben diesen Prinzipien in Einklang zu bringen. Einige Kritiker finden das, was wir über den Wert finanzkapitalistischer Geldanlagen sagen, überhaupt unverträglich mit dem, was sie bei Marx über „wertschaffende Arbeit“ gelernt haben, und bestreiten, dass Marx so revidiert werden darf. Das wäre uns zwar egal, wenn Marx Unrecht hätte. Weil wir aber ganz im Gegenteil in dessen Kritik des Kapitals die theoretische Grundlage für unsere Kritik des Finanzkapitals gefunden haben, sind wir uns sicher, dass unsere Kritiker mit ihrer Vorstellung vom Wert falsch liegen, und auch, dass es an Unklarheiten beim Verständnis der Marx’schen Wertlehre liegt, wenn es so arge Probleme mit der Vereinbarkeit unserer Erläuterungen des Finanzkapitals und jener „Lehre“ gibt. Deswegen hier ein Angebot zur Klärung.
I.
Vielleicht ist ja einfach nicht gut verstanden, was die Warenanalyse in Marx’ Kritik der politischen Ökonomie mit ihrem Schluss vom Tauschwert auf den Wert und die Arbeit als dessen Quelle und Maß wirklich sagt.
1.
Die Tatsache, dass der Reichtum an Gütern, von denen die Menschen heutzutage leben, arbeitsteilig produziert wird, dass also in jedem Produkt ein Stück der gesellschaftlich geleisteten Arbeit steckt, ist banal und nichts, was zu beweisen oder zu erklären wäre; auch Marx macht davon kein Aufhebens. Von Interesse ist die Frage, welchen Zwecken und Notwendigkeiten eine arbeitsteilige Produktion gehorcht, in der keine planende Instanz die Arbeit aufteilt, in der weder die inhaltliche Spezifikation noch der jeweilige Umfang der zu leistenden Arbeiten bedarfsgerecht festgelegt oder überhaupt ermittelt werden; in der vielmehr die Herstellung des Reichtums an Gütern auf Gelderwerb berechnet ist und seine Verteilung übers Geld stattfindet. Da ist als Erstes festzuhalten, dass vor dem zweckmäßigen Gebrauch von Produkten das Verfügungsrecht des Produzenten steht: der eigentumsrechtliche Ausschluss aller Interessenten, die das Produkt brauchen, von dessen Verwendung. Voraussetzung, Ausgangspunkt und bleibende Grundlage der herrschenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist – so absurd wie in der Marktwirtschaft selbstverständlich – der Gegensatz zwischen Herstellung und Bedürfnis, der mit dem Eigentumsrecht des Produzenten gesetzt ist; wobei man sich ruhig auch schon daran erinnern darf, dass in dieser Gesellschaft als Produzent gilt, wer das Eigentumsrecht am Produktionsprozess besitzt: Hersteller ist nicht der Mensch, der – bzw. insofern er – tatsächlich Hand anlegt, sondern die Rechtsperson, die Firma in der Regel, die das Produkt hat herstellen lassen und der es daher nach Recht und Gesetz gehört. Aufgelöst wird dieser fundamentale Antagonismus zwischen Herstellung und Benutzung im Kaufakt: durch das Geld, das dem Eigentümer seinen produktiven Aufwand, seine gesellschaftliche Teil-Arbeit, vergütet. Die marktwirtschaftliche Gewohnheit begnügt sich für das Einverständnis mit dieser Transaktion mit der Erinnerung daran – und mehr hat der systemeigene Sachverstand zur Erläuterung ihres guten Sinns auch nicht anzubieten –, dass der Geldempfänger sich für den Erlös seinerseits Bedarfsartikel kaufen kann. So löst sich die Sache ganz nach der Seite der konkreten Gebrauchsgüter hin auf, und das Geld kürzt sich als bloßer Vermittler einer gelungenen Arbeitsteilung heraus – obwohl doch zugleich jeder weiß, dass es in der Marktwirtschaft genau darauf ankommt: aufs Geld, die quantitativ bemessene Zugriffsmacht auf alle möglichen Güter. Das Gut, um das es bei der Produktion für den Verkauf wirklich geht und in dem die angestrebte Vergütung für die geleistete Arbeit tatsächlich besteht, ist das durchs Geld repräsentierte Quantum Eigentum woran auch immer, ein Stück ausschließender Verfügungsmacht getrennt von dem Produkt, mit dem es in die Welt gekommen ist. Diese real existierende Abstraktion: die Austauschbarkeit des Produkts, verwirklicht in einer Geldsumme, heißt – nicht nur bei Marx – Wert.
Man sieht daran: Es ist im Ansatz verkehrt, sich den Tauschwert der Waren, i.e. ihre ökonomische Bestimmung, im Verkauf einen Preis zu erzielen, mit der Selbstverständlichkeit erklären zu wollen, dass für ihre Herstellung ein bestimmtes Quantum Arbeit verausgabt worden ist, und nicht mit den gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen, unter denen allein Arbeit Tauschwert hervorbringt. Von sich aus erzeugt menschliche Arbeit irgendeinen konkreten Nutzeffekt. Wenn sie Tauschwert schafft, dann ist sie selber schon in jeder Hinsicht dadurch definiert, dass ihr Produkt zu Geld wird. Nämlich so:
– Sie zählt selber nur als Quelle von Eigentum, nicht an etwas, sondern von Eigentum schlechthin. Ihr erstes Attribut heißt deswegen privat und drückt aus, dass ihr Zweck nicht in dem gesellschaftlichen Bedürfnis liegt, das ihr Produkt als Teil gesellschaftlicher Produktion mit seinem Gebrauchswert befriedigt, sondern in der Macht des Produzenten, sein Produkt dem Bedürfnis danach vorzuenthalten – nicht um es doch selber zu benutzen, sondern um es gegen ein Stück allgemeiner Verfügungsmacht herauszugeben. Der Nutzen, den seine Arbeit schafft, besteht nicht in ihrem Nutzen für den Benutzer ihres Produkts, sondern in dem Quantum privater Zugriffsmacht, das durch das Produkt repräsentiert wird und im Verkauf in verallgemeinerter Form, vom Produkt getrennt, in Form von Geld, beim Verkäufer bleibt.
– Das zweite ökonomische Attribut der wertschaffenden Arbeit heißt folglich abstrakt und drückt aus, dass diese Arbeit als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, also ausgerechnet als besonderer Beitrag zu einem gesellschaftlichen Produktionsprozess, nur insofern zählt, als ihr Produkt sich als austauschbar erweist, anderen gleich gilt, soweit sie selber also dasselbe leistet wie alle anderen Teilarbeiten. Das Wertschaffende an ihr ist das, was sie mit jeder beliebigen produktiven Tätigkeit gemeinsam hat – und das ist das pur Negative: die Verausgabung von Lebenszeit und -kraft im Dienst am Eigentum.[4] Ihren ökonomischen Zweck erreicht die wertschaffende Arbeit nicht durch den konkreten Nutzeffekt, den sie stiftet – der wäre bei steigender Produktivkraft der Arbeit ja mit einem abnehmenden Aufwand an Zeit und Kraft zu haben –, sondern allein durch die Menge, also die Dauer des Einsatzes von Arbeitskraft überhaupt. In der Kombination mit dem ersten Merkmal ergibt sich damit bereits ein komplettes Paradox: Als private ist die Arbeit dadurch als nützlich bestimmt, dass ihr Nutzeffekt ganz beim Produzenten verbleibt; der Nutzeffekt, den sie als abstrakte Arbeit hervorbringt, liegt in dem schieren Verbrauch von Arbeitskraft. Schon damit steht fest: Wenn die ganze Ökonomie der marktwirtschaftlich geteilten Arbeit auf einem solch paradoxen Verhältnis beruht, dann nur, weil seine beiden Momente tatsächlich voneinander getrennt, als Interessengegensatz zwischen Privateigentümer als Nutznießer und Arbeitskraft als Verschleißteil des gesellschaftlichen Produktionsprozesses existieren. Hier ist aber zunächst nur das Moment an der wertschaffenden Arbeit festzuhalten, auf das das Attribut ‚abstrakt‘ verweist: die Absurdität, dass der Reichtum an Gütern, den diese schafft, ökonomisch allein danach zählt, in welchem Umfang für seine Herstellung Arbeitszeit verbraucht und Arbeitskraft verschlissen wird. In diesem rein negativen Sinn hat der Reichtum, auf den es in der Marktwirtschaft wirklich ankommt, das in Geld gemessene Eigentum, im Quantum Arbeit sein Maß.
– Wie viel derart abstrakten Reichtum die Arbeit tatsächlich zustande bringt, hängt freilich wiederum gar nicht von ihr ab – von ihrem konkreten Inhalt und der konkreten Mühsal sowieso nicht, aber auch nicht von ihrem wirklichen in Zeiteinheiten gemessenen Quantum. Die verbindliche und einzig gültige Art, den abstrakten Nutzen der Arbeit zu quantifizieren, das hergestellte Quantum Eigentum zu beziffern, ist der Verkaufsakt, in dem das Produkt seinen Gebrauchswert los und seine Wert-„Natur“ realisiert wird. Und da: im Preis, der für eine Ware zu erzielen ist, als Bestimmungsgrund für dessen Höhe, macht sich der konkrete arbeitsteilige Zusammenhang geltend, in dem die produzierten Güter zum Lebensprozess der Gesellschaft beitragen, nämlich das Bedürfnis nach der hergestellten Ware und der technische Stand ihrer Herstellung. Zur Geltung kommt dieser Zusammenhang, die Gebrauchswertseite der Arbeit, freilich nach den Gesetzen des Eigentums: als praktizierter Interessengegensatz zwischen den verschiedenen Warenanbietern sowie zwischen Produzenten und Konsumenten, nämlich in der Konkurrenz um den Preis. Hier muss die Arbeit beweisen, dass sie das Attribut gesellschaftlich notwendig verdient. Dieses Attribut drückt deswegen auch nicht die Selbstverständlichkeit aus, dass auch die marktwirtschaftlich produzierende Gesellschaft mit ihrem absurden und gemeinen Begriff von Reichtum letztlich vom materiellen Nutzen der auf den Markt geworfenen Güter lebt: Es steht für den Umstand, dass sich in der Marktwirtschaft alle konkreten gesellschaftlichen Bedürfnisse und alle technischen Qualitäten der Arbeit in Notwendigkeiten des Geldes verwandeln. Der gesellschaftliche Bedarf zählt nach dem Quantum geldförmiger Zugriffsmacht, das jedem einzelnen Bedürfnis zu Gebote steht; die Produktivkraft der Arbeit kommt zur Geltung als Mittel, in Konkurrenz gegen andere Hersteller die verschiedenen Bedürfnisse auszunutzen und die dafür verfügbare Zahlungsfähigkeit abzugreifen. So entscheiden die wirklich verausgabten Arbeitsstunden noch nicht einmal, was sie zum Eigentum des juristischen Privatproduzenten beitragen; es ist umgekehrt: Der in der Konkurrenz erzielte Gelderlös entscheidet darüber, wie viel gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit die individuell geleistete Arbeit repräsentiert, in welchem Umfang also das aufgewandte Quantum an Arbeitszeit als Wertquelle wirksam geworden ist – und ob überhaupt.
2.
Die Herstellung von Gütern in der Marktwirtschaft wird von dem Interesse an Geld bestimmt. Dieses Interesse ist als Bestimmungsgrund der gesellschaftlichen Arbeit so abstrakt wie sein Gegenstand: Es richtet sich auf das pure Quantum ökonomischer Verfügungsmacht. Es enthält keinen Gesichtspunkt, unter dem es abschließend erfüllt wäre. Sein Erfolgskriterium heißt: möglichst viel, also immer mehr vom Gleichen. Reichtum, der sein Maß im Geld hat, ist eben deswegen maßlos: Es ist seine ökonomische Natur, nie genug zu sein.
Dieser Reichtum richtet sich feindlich gegen die konkrete Arbeit, die den gesellschaftlichen Reichtum an nützlichen Gütern schafft, einschließlich der Subjekte, die sie leisten. Denn er definiert als die eigentliche ökonomische Leistung der produktiven Arbeit einen Erfolg, der allein darin besteht, dass er auf Kosten der produktiv Arbeitenden geht, und gar nicht in deren Hand liegt: „Produktiv“ im marktwirtschaftlichen Sinn ist Arbeit ja dadurch, dass die pure Verausgabung von Arbeitskraft und Lebenszeit in dem Maß Eigentum schafft, wie die Konkurrenz ums Geld der Kundschaft diesen Aufwand praktisch als notwendig bestätigt. Bequeme Versorgung und freie Zeit für die Arbeitenden schließt diese Form des Reichtums nicht ein, sondern aus; wertschaffende Arbeit bedeutet maximalen Verzehr von Arbeitskraft.
Die Verrichtung derartiger Arbeit als ökonomischer Normalfall beruht auf einer Notwendigkeit, die der Sorte Reichtum geschuldet ist, der diese Arbeit dient: Die gesellschaftliche Arbeitskraft wird für die Erzeugung von immer mehr Geld benutzt und verschlissen, weil sie gar keine Chance hat, sich der Macht des Eigentums selber zu bedienen; sie dient dem Eigentum, weil sie selber keines hat, vielmehr durch die Macht des Eigentums von allem Benötigten, von Subsistenz- und Produktionsmitteln getrennt ist. Arbeitskräfte, die mit ihrer Arbeit Wert schaffen, tun das deswegen, weil sie von sich aus nicht in der Lage sind, in gesellschaftlicher Arbeitsteilung für sich zu sorgen, sondern darauf angewiesen, durch und für die Macht des Eigentums in Dienst genommen zu werden.
Diese Indienstnahme geschieht ihrerseits nach den Regeln der Marktwirtschaft: „Das Geld“, konkret also: die geldbesitzende Elite, die im einschlägigen Jargon passenderweise „die Wirtschaft“ heißt, kauft den eigentumslosen Leuten Arbeitskraft und Lebenszeit ab. Es verwandelt auf die Art deren Arbeitsfähigkeit in seine eigene Potenz, durch die Verausgabung eines Quantums Arbeit Wert zu schaffen. Nur so, als Besitzstand der Käufer, als Teil der Macht des Eigentums, tut die gesellschaftliche Arbeitskraft überhaupt den Dienst, auf den es ökonomisch ankommt. Deswegen schafft diese Arbeit auch kein Eigentum für die wirklichen Subjekte, die sie leisten, sondern für die Rechtsperson, die deren Arbeitskraft durch Kauf unter ihr Kommando gebracht hat und darüber als ihr Eigentum verfügt: Wertschaffende Arbeit produziert die Macht, die sie in Dienst nimmt. Und – nochmals – umgekehrt: Diese abstrakte Produktivkraft entfaltet die Arbeit nur, weil die Privatmacht des Geldes sich ihrer bemächtigt hat – anders kommen eigentumslose Arbeitskräfte überhaupt nicht zu irgendeiner gesellschaftlich produktiven Tätigkeit, und anders kommt ihrer produktiven Tätigkeit überhaupt nicht die ökonomische Leistung zu, Eigentum zu vermehren. Denn dass am Produkt nur dessen Austauschbarkeit zählt, nur das Eigentum daran, also nur die im Eigentumsrecht begründete Verfügungsmacht, die im Geld zum ökonomischen Gegenstand wird: Das liegt nicht an der Arbeit, sondern daran, dass sie per Kauf der Macht des Eigentums inkorporiert ist und dem Rechtssubjekt, das über den Arbeitsprozess gebietet, als dessen Leistung zugerechnet wird. So wird mit der wertschaffenden Arbeit eingekaufter Dienstkräfte tatsächlich die Kommandogewalt des Geldes selber produktiv: Die produziert neues Eigentum.
Dabei ist mit der Masse der mobilisierten Arbeitsstunden und dem am Markt erstrittenen Gelderlös noch nicht entschieden, ob die Macht des angewandten Geldes dem eigenen Zweck, dem Interesse an Geldvermehrung, überhaupt gerecht wird und gegebenenfalls in welchem Maß. Verlangt ist nicht einfach viel, sondern die Vermehrung des geldförmigen Eigentums, jenes Wachstum also, von dem der marktwirtschaftliche Sachverstand gar nicht anzugeben braucht, was denn da immerzu wachsen soll, weil sich das systematisch von selbst versteht. Dieser Erfolg erfordert einen Überschuss der eingenommenen Geldsumme über den Betrag, den die Verfügung über das eingesetzte Quantum Arbeit sowie der Einsatz von Produktionsmitteln kosten. Das Geld muss sich als Quelle seiner eigenen Vermehrung betätigen; erst damit bewährt es sich als Kapital: als „Hauptsumme“ mit der Macht, Zuwachs zu generieren.
Die Rolle, die hierfür der Arbeit zukommt, kennzeichnet Marx mit einem klein geschriebenen „v“. Das Kürzel soll ausdrücken, dass die Leistung der Arbeit, Wert zu schaffen, in Wahrheit die Leistung des Preises ist, der für die Verfügung über Arbeitskraft zu entrichten ist: Die produktive Arbeit ist ein Teil des Kapitals, das sich da betätigt, und zwar derjenige, der sich mit dem Kommando über ein Stück gesellschaftlicher Arbeit als variabel, nämlich zur Selbstvergrößerung fähig erweist.[5] Diese Macht ist umso größer, je weniger die Arbeitskraft kostet und je mehr ihr Einsatz an Erlös einbringt. Für die Arbeitskräfte bleibt deswegen nur so viel Geld übrig, dass sie davon den Aufwand für ihr Eigentum, die vom Kapital benötigte Arbeitskraft eben, bestreiten können; so bleiben sie den Geldbesitzern als Verfügungsmasse erhalten. An ihnen bleibt außerdem die Mühsal hängen, in der der private Nutzen ihrer Arbeit für den Tauschwert der Produkte besteht. Die Ausbeute daraus, der geschaffene abstrakte Reichtum, gehört den Eigentümern, den rechtlichen Herren des Arbeitsprozesses, den Marx deswegen in aller wissenschaftlichen Sachlichkeit als Ausbeutung kritisiert.
Die Erzeugung von Wert findet also durch den Einsatz von Geld als Kapital und als dessen Leistung statt: als Verwertungsprozess. Den Erfolg messen die Eigentümer an dem Überschuss, den sie durch den Einsatz ihres Geldes erzielen, über das eingesetzte Geld, berechnet auf Lohnkosten und den rechnerischen Wertverlust der eingesetzten Produktionsmittel: als Profitrate. In dieser Rechenweise ist festgeschrieben, nicht nur, worauf es in der Marktwirtschaft ankommt, sondern auch, dass die Quelle des Wertzuwachses der Wert selber ist.
3.
Der Verwertungsprozess dient keinem außerhalb von ihm liegenden Zweck, sondern allein der Vergrößerung der in Geld realisierten Verfügungsmacht, mit der er unerbittlich stets von neuem anfängt: der Akkumulation von Kapital. Dieser unendliche Kreislauf vollzieht nicht die Vermehrung von nützlichen Gütern nach, bildet nicht wachsenden gegenständlichen Reichtum in abstrakten Ziffern ab. Es ist umgekehrt: Kapitalakkumulation ist der ganze ökonomische Inhalt der Marktwirtschaft; die Bedürfnisse des Kapitalwachstums, die sich für die Eigentümer und Sachwalter des Kapitals als Notwendigkeiten erfolgreichen Konkurrierens darstellen, definieren die materiellen Bedürfnisse der Gesellschaft und die Bedingungen, unter denen die sich durch die Herstellung von Gütern für den Verkauf ausnutzen lassen – in seinen berüchtigten Reproduktionsschemata erläutert Marx die Subsumtion der gesellschaftlichen Arbeitsteilung unter die Erfordernisse der Akkumulation.
Das wesentliche Mittel der Kapitalvermehrung, in der kapitalistischen Praxis: die entscheidende Waffe im Konkurrenzkampf der Kapitalisten, ist wiederum – wie könnte es bei diesem unendlichen Kreislauf der Verwertung anders sein – der Akkumulationserfolg: die Größe des eingesetzten Kapitals. In einer Welt, in der schlechterdings alles käuflich ist, bemisst sich an der Menge des verfügbaren Geldes die Fähigkeit eines jeden Unternehmens, in eigener Regie die Bedingungen für die Steigerung der Profitrate zu verbessern. Zum Einsatz kommen da alle erdenklichen Maßnahmen und Techniken zur Senkung des Preises für Arbeitskraft, also vor allem des Quantums an Arbeit, das zur Herstellung von Gütern für den Verkauf nötig ist. Das Kapital perfektioniert seine Produktionsmittel; die technische Produktivkraft der Arbeit selbst wird vom Kapital immer wieder „neu erfunden“ und den Arbeitskräften aufgenötigt; so macht sich praktisch geltend, dass die Potenz der Arbeit ins Eigentum ihrer Anwender übergegangen ist. Entsprechend konkret wirksam wird im Produktionsprozess der abstrakte Charakter der Arbeit, derer sich das Kapital zur Schaffung von Tauschwert bedient: Alle geistigen Potenzen der Arbeit – technisches Wissen, Planung der Arbeit... – existieren getrennt vom arbeitenden Personal, stehen den Arbeitskräften in Apparaten vergegenständlicht oder in Funktionären personifiziert als Potenzen des Kapitals gegenüber, fungieren als Produktivkräfte nach dessen Bedarf und Entscheidung; selbst ihre eigenen beruflichen Fertigkeiten wenden die bezahlten Arbeitskräfte, sogar die auf den höheren Stufen der betrieblichen Hierarchie, nicht wirklich nach ihrem Ermessen an, sondern nur so und nur so lange, wie das Unternehmen es für zweckmäßig erachtet. Die konkrete produktive Tätigkeit selber ist in einer fortgeschrittenen Marktwirtschaft ein sehr abstrakter Dienst an fremdem Privateigentum: der Vollzug vorgeschriebener und vorgegebener Teilarbeiten, deren Einteilung und Zusammenhang ganz in der Hand der Firma liegt.
Dass der enorme technische Fortschritt, mit dem das Kapital den zur Güterherstellung nötigen Arbeitsaufwand senkt, den Arbeitskräften nichts erspart, versteht sich von selbst. Das ökonomische Grundgesetz, wonach nur das Gleichgültig-Austauschbare an den verschiedenen Teilarbeiten marktwirtschaftlich zählt, und das auch nur, soweit der Ertrag der Arbeit zum Preis der Arbeitskräfte in einem profitbringenden Verhältnis steht, wird durch fortschrittliche Technik ja überhaupt nicht relativiert; die Arbeitszeiten bleiben lang und die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit flexibel; Einsparungen beim Arbeitsaufwand haben Arbeitskräfte mit ihrer Entlassung auszubaden.
Eine etwas zwiespältige Konsequenz ergibt sich für die Veranstalter und Nutznießer der wertschaffenden Arbeit. Die Unternehmen, die mit der Verbilligung des Kostenfaktors und der Effektivierung des Produktionsfaktors Arbeit den Konkurrenzkampf gegen andere Produzenten gewinnen, weil sie ihre Ware preiswerter anbieten können, steigern ihren Gewinn. Die Masse des abstrakten, in Geld nachgezählten kapitalistischen Reichtums steigern sie damit nicht entsprechend. Soweit der Preisvorteil, mit dem sie ihren Absatz steigern, von den Konkurrenten wieder egalisiert wird, verschlechtert sich, tendenziell und insgesamt, das Verhältnis zwischen Gesamtaufwand und Ertrag – also die Profitrate, um die es doch geht.
Dass so – wie Marx es ausdrückt – die Methoden der Profitmacherei dem beabsichtigten Effekt in die Quere kommen können, haben Marx-Kenner so aufgefasst, als behielte die Gleichung, wonach der Wert sein Maß in dem Zeitquantum produktiver Arbeit hätte, letztlich Recht gegen die Ausnutzung der gesellschaftlichen Wertschöpfung durch die kapitalistische Profitmacherei. Das ist verkehrt, verrät dieselbe Fehldeutung der Marx’schen „Wertlehre“, die wir hier korrigieren möchten; deswegen hier noch einmal die Erinnerung: Inhalt des „Wertgesetzes“ ist die Degradierung der produktiven Arbeit zum bloß quantitativ wirksamen Hilfsmittel für die Schaffung von Geld, i.e. von Mengeneinheiten privaten Eigentums getrennt vom Eigentum an irgendetwas Bestimmtem und als derart abstrakte Verfügungsmacht vergegenständlicht; und als herrschendes ökonomisches Prinzip gibt es ein solches Gesetz überhaupt nur, weil alle produktive Arbeit der Gesellschaft durch die Macht des Eigentums in Beschlag genommen ist und als Hilfsmittel für die schrankenlose Vermehrung des Eigentums: für die Akkumulation von Kapital eingesetzt wird. Dass produktive Arbeit nur als abstrakte, wertschaffende zählt, ist keine der Arbeit eignende Fähigkeit, die vom Kapital okkupiert wird: Mit dem Kauf von Arbeitskraft, der Aneignung ihrer produktiven Potenzen, ihrer rechtlichen Verwandlung in seine eigene Potenz macht das kapitalistische Eigentum seine ökonomischen Bestimmungen, nämlich seine Macht über Arbeit und Reichtum, erst wirklich zu dem ökonomischen Inhalt, auf den es bei der Produktion nützlicher Güter ankommt, also zu den maßgeblichen ökonomischen Bestimmungen der Arbeit – nämlich: abstrakt, privat und als gesellschaftlich notwendige wertbildend zu sein. Wenn aus den Methoden des Kapitals zur Steigerung seines Wachstums eine dem Effekt entgegenwirkende Tendenz folgt, dann kollidiert die Macht des Geldes da nicht mit einem ihr vorausgesetzten Gesetz; schon gar nicht scheitert dann die Profitmacherei an einer Eigengesetzlichkeit der Arbeit, die dafür ausgenutzt wird. Dann produziert vielmehr das Kapital selber einen Widerspruch zwischen der Wachstumspotenz, die es sich einverleibt hat, dem kleinen „v“, und dem Aufwand, den es für die Steigerung dieser seiner Potenz treibt; es demonstriert, dass die gesellschaftliche Notwendigkeit, die das der abstrakten Arbeit abgewonnene Wertquantum bestimmt, allein von ihm definiert wird. Und es bewältigt die selbstverschuldete Verzögerung seines Wachstums dementsprechend; so nämlich, dass es genau so weitermacht und die Einsparung von Arbeitskosten durch immer perfektere und technologisch immer weiter entwickelte, daher tendenziell auch immer kostspieligere Methoden der Ausbeutung unerbittlich vorantreibt. Wer davon den Schaden hat, wer da scheitert, das lässt sich z.B. an den Arbeitslosenziffern ablesen, die zur kapitalistischen Konkurrenz unvermeidlich dazugehören.
4.
Der Zweck der marktwirtschaftlichen Güterherstellung, die Akkumulation von Kapital, wird dadurch ganz wesentlich gefördert, dass Teilfunktionen des Verwertungsprozesses in eigenen Branchen als selbständiges Geschäft abgewickelt werden. Der wichtigste dieser Teilbereiche, der Warenhandel, spielt dabei eine besondere Rolle innerhalb der marktwirtschaftlichen Arbeitsteilung: Zur Herstellung des Reichtums an Gütern trägt er gar nichts bei, sofern man ihm nicht alle nötigen Transportleistungen zurechnen will. Notwendig ist er als unerlässliche Etappe in der Verwirklichung des kapitalistischen Zwecks der Güterproduktion: Er organisiert systematisch, im Großen und flächendeckend bis zum letzten Verkaufsakt, die Abtrennung des Werts der produzierten Güter von dem stofflichen Reichtum, der ja bloß dem abstrakten Reichtum als Vehikel dient. Der Warenhandel ist damit der Teil des Verwertungsprozesses, der erst wirklich über das Quantum entscheidet, in dem überhaupt neues Eigentum geschaffen worden ist; logischerweise hat er Anteil an diesem Reichtum. Und selbstverständlich sind da Kapitalisten aktiv, die die Arbeit, die für die kapitalistische Form des Produktionsprozesses, das Kaufen und Verkaufen, nötig sind, von schlecht bezahlten und kräftig ausgenutzten Dienstkräften erledigen lassen und dafür vom Wert der vermarkteten Waren so viel an sich bringen, wie sie ihren Lieferanten und ihren Kunden abpressen können.
Einen Beitrag anderer Art zur Akkumulation des Kapitals leistet das Finanzgewerbe. Es ist nicht Teil des Verwertungsprozesses, sondern macht diesen insgesamt zu seinem Geschäftsobjekt: Es trennt die Verfügung über Geld von dessen Entstehungsprozess ab, macht es sich und seinen Kunden in der verselbständigten Form des Kredits verfügbar. Mit seinem geschäftlichen Zugriff auf das aufgehobene wie das zirkulierende Geld der Gesellschaft sowie kraft staatlicher Lizenz und Ermächtigung geht das Finanzgewerbe dabei so weit, in ganz großem Stil seine Zahlungsversprechen als gesellschaftliches Zahlungsmittel zirkulieren und seine Verbindlichkeiten als Geldkapital wirken zu lassen. Was wir dazu in den bisher erschienenen drei Kapiteln über das Finanzkapital aufgeschrieben haben, wird sicher nicht dadurch leichter verständlich, dass wir es in Kurzfassung wiederholen. Im Hinblick auf die Zweifel, ob wir da nicht doch eine Revision der Marx’schen Wertlehre vornehmen, kann vielleicht aber doch ein Hinweis von Nutzen sein.
Mit seinen Kreditgeschäften bringt das Finanzgewerbe von ihm geschöpfte Zahlungsmittel in Umlauf. Die repräsentieren in Geldeinheiten gemessene Verfügungsmacht; und darin unterscheiden sie sich in gar nichts von dem Geld, das das anderweitig engagierte Kapital dadurch schöpft und mehrt, dass es Güter für den Tausch produziert und im Verkauf das Eigentum als solches von seinem Gegenstand trennt und dagegen verselbständigt. Ein Rechtsverhältnis zwischen Eigentümern ist das eine Geld so gut wie das andere: ein Rechtsverhältnis des Ausschlusses und der Zugriffsmacht in der irrationalen, von Marx als ‚fetischartig‘ verachteten Gestalt eines Dings, das der Verfügungsmacht des Eigentums ein quantitatives Maß verpasst. Da sind nicht zwei Sorten Wert unterwegs, sondern ein und derselbe abstrakte Reichtum; in unterschiedlicher Verwendung, aber in derselben kapitalistischen Mission, sich zu vermehren. Die Macht dazu funktioniert in beiden Fällen aus demselben Grund, nämlich nur deswegen, weil das staatlich durchgesetzte Regime des Eigentums den gesamten gesellschaftlichen Lebensprozess beherrscht. Denn auch darin unterscheiden sich produktives und Finanzkapital überhaupt nicht: Mit der Verwendung des Geldes als Geldquelle machen sie die Gesellschaft insgesamt zur Manövriermasse der Macht ihres auf Vermehrung programmierten Eigentums und dafür haftbar, dass ihre Rechnungen aufgehen – wie sie sich dabei voneinander unterscheiden und wie ihre unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten zusammenhängen, davon handeln unsere drei Artikel.
Anders gesagt: Wer verstanden hat, was für ein Unding der abstrakte Reichtum ist, um den es einzig und allein geht, wenn nützliche Güter einzig und allein für den Tausch gegen Geld fabriziert werden – dazu die Erinnerungen in den vorstehenden drei Punkten –, der hat damit noch nicht erklärt, was das Finanzkapital mit dieser Abstraktion alles anstellt, wie es mit seiner Kreditschöpfung den sich verwertenden Wert verselbständigt und vervielfacht und wie es daran verdient. Der wird aber auf alle Fälle die Abstraktion des Eigentums schlechthin, die die Kommandanten des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses dem Reichtum an Gütern, den sie herstellen lassen, als dessen wahre ökonomische Natur beilegen und zum totalitär herrschenden Zweck und Sachzwang machen, nicht für wirklicher, handfester oder wie auch immer substanzieller halten als die ökonomische Macht, die die Finanzkapitalisten mit ihren verbrieften Schulden in Händen halten und mit ihren spekulativen Geschäften ausüben und die sich durch ihren Gebrauch vermehrt, ohne dass deswegen auch nur eine Ware mehr hergestellt und verkauft worden sein müsste. Was in deren Händen als Kapital fungiert, nennt Marx im Gegensatz zu den Produktionsmitteln und Arbeitskräften, die die anderen Kapitalisten als ihr Eigentum in Besitz nehmen und zu Potenzen der Verfügungsmacht ihres Geldes degradieren, „fiktiv“; er erinnert daran, dass die Welt ohne die Reichtümer des Finanzkapitals gebrauchswertmäßig kein bisschen ärmer wäre, nichts konkret Nützliches fehlen würde – übrigens ebensowenig wie ohne den „Fetisch“ Geld. Damit will er aber gerade nicht gesagt haben, die Macht, die diesem rechtsförmig fingierten Kapital im System der politischen Ökonomie des Eigentumsrechts zukommt, wäre eine bloße Einbildung oder auch nur im Geringsten weniger real als das, was andere Kapitalisten – solche, die an den materiellen Bedürfnissen der Menschheit und deren geschäftlicher Ausnutzung Geld verdienen – in ihren Bilanzen aufschreiben. Die selber halten ja im Gegenteil ihren Reichtum erst dann für wirklich real, und kapitalistisch frei anwendbar ist er ja auch wirklich nur dann, wenn er die Gestalt einer Ziffer auf ihrem Bankkonto angenommen hat. In diesem verrückten System sind es tatsächlich die vom Kreditgewerbe hergestellten und vermarkteten Schuldverhältnisse, die die ganze Macht des Werts repräsentieren und universell anwendbar machen. Es ist das ‚fiktive‘ Kapital, das seine Produzenten dazu befähigt, alle anderen kapitalistischen Geschäfte zu finanzieren, zu dirigieren, in Schwung zu bringen oder abzuwürgen – und insgesamt zu gefährden, wenn das Spekulieren nach seinen eigenen Kriterien nicht mehr gelingt.
Deswegen sind es im Übrigen auch solche Geschäfte – mit dem Kreditrisiko, mit der spekulativen Bewertung von Wertpapieren, mit Spekulationspapieren zur Absicherung gegen Verluste aus spekulativen Engagements, schließlich mit der Abtrennung solcher Spekulationspapiere von ihrem Versicherungszweck und der Vermarktung reiner Finanzwetten –, mit denen sich in der globalen Marktwirtschaft am meisten Geld verdienen lässt. In dieser Welt gelten Herstellung und Vertrieb der absurdesten Derivate glatt als geldwerte Dienstleistung, so wie die Herstellung von Armbanduhren und der Vertrieb von Nüssen oder Nachrichten; nur viel, viel teurer. Und wenn der marktwirtschaftliche Sachverstand Recht hat mit seinem Dogma, dass die Höhe eines Entgelts – zumindest im Prinzip – den Wert des entgoltenen Dienstes ausdrückt, dann leistet in Sachen Wertschöpfung tatsächlich niemand so viel wie Investmentbanker, die Verpackungen für Derivate erfinden.
II.
1.
Unsere Überlegungen zur Macht des Kreditsektors, Geld zu schöpfen, Kredit zu vergeben und mit Techniken eigener Art Geldkapital zu akkumulieren, sind von manchen skeptischen Lesern so verstanden worden, als läge uns daran, die Unabhängigkeit dieser Geschäftssphäre von der Welt der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeit zu beweisen; als wollten wir quasi den Derivatekünstlern recht geben, die ihre Tätigkeit nicht für das hinterletzte Produkt des Systems der Lohnarbeit, sondern für die wahre Quelle des Reichtums der modernen Weltwirtschaft halten. Dabei wird wohl übersehen, dass die Ableitung des Finanzgeschäfts und seiner Autonomie aus den Prinzipien der politischen Ökonomie des Kapitals die theoretische Rückführung der Branche und ihrer aparten Stellung im und zum sonstigen kapitalistischen Betrieb auf diese Prinzipien leistet. Vielleicht hilft auch in dieser Hinsicht ein Hinweis:
Die Freiheiten in Sachen Geldschöpfung und Gewinnerwirtschaftung, die das Finanzgewerbe sich herausnimmt, halten wir für die zu erklärende Sachlage; sie in Abrede zu stellen, weil man sich eine Erklärung der Kapitalakkumulation zurechtgelegt hat, die dazu nicht passt, ist nicht gut. Diese Freiheiten sind die Errungenschaften einer Macht über den gesellschaftlichen Geldverkehr und den geschäftlichen Gebrauch des Geldes, die nicht vom Himmel gefallen ist, sondern in der politischen Ökonomie des Geldverdienens ihre Grundlage hat: Die Macht des Finanzkapitals, durch den Handel mit ge- und verliehenem Geld Geld zu machen, beruht darauf, dass in der Marktwirtschaft überhaupt Geld als Geldquelle fungiert – die kommerzielle Kundschaft der Banken treibt ja nichts anderes. Diese Macht des Geldes, durch seinen geschäftlichen Gebrauch mehr zu werden, ist ihrerseits keine mysteriöse Eigenschaft des Geldes, obwohl sie in der Marktwirtschaft glatt so wirkt, nämlich als sachliche Gegebenheit. Sie ist die Konsequenz daraus, dass sich in diesem System ein Lebensunterhalt nur mit dem Erwerb von Geld erwirtschaften lässt, die meisten Betroffenen aber nie genug Geld haben, um dessen Macht zur Selbstvermehrung durch den richtigen geschäftlichen Gebrauch freizusetzen; die sind vielmehr genötigt, für Geld zu arbeiten – dafür nämlich, dass für die Minderheit, die genug davon hat, „das Geld arbeitet“. Welche Jobs die auf Gelderwerb durch Arbeit angewiesene Mehrheit sucht und findet, ist im System der marktwirtschaftlichen Freiheit egal; da ist nichts unmöglich; in allen erdenklichen Dienstleistungen kann die Arbeit suchende Menschheit ihre Chance finden. Dabei wird allerdings ein Unterschied gern übersehen, der für die allgemeine unbedingte Notwendigkeit, sich Geld zu beschaffen, entscheidend ist: Auch die fortschrittlichste kapitalistische Gesellschaft, in der die Industrie zu den aussterbenden Branchen gezählt wird, lebt von den materiellen Gütern, die mit materiellen Produktionsmitteln hergestellt werden müssen. Auch wenn die meisten Lohnabhängigen und kleinen Selbstausbeuter mit anderen Aufgaben beschäftigt werden – massenhaft solchen, die mit der Vermarktung von Gütern, der Verwaltung der mit Geld wirtschaftenden Gesellschaft, den finanziellen Sachzwängen der bürgerlichen Existenzweise zu tun haben –: Die Gesellschaft lebt von der Arbeit, die die lebensnotwendigen Güter produziert. Der allgemeine Zwang, für Geld zu arbeiten, hat seinen letzten ökonomischen Grund darin, dass die Produktionsmittel für diese Güter denen gehören, die darin ihr Geld angelegt haben und nur produzieren lassen, was und wenn es sich für ihr Geldinteresse lohnt. Mit der Notwendigkeit des Gelderwerbs für den Lebensunterhalt ist eine Produktionsweise definiert.
Die Freiheiten des Finanzkapitals sind also das systemeigene Produkt der kapitalistischen Produktionsweise. Der Stoff des Finanzgeschäfts bezeugt, dass es aus dem System der Lohnarbeit folgt.
2.
In unserer umgekehrt argumentierenden Erklärung des Finanzgewerbes legen wir allerdings Wert darauf, dass diese Branche sich vom kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozess förmlich trennt, mit eigenen Mitteln und Methoden Geldmacht akkumuliert und sich als maßgeblicher Anstifter und zusammenfassender Nutznießer auf das Geschäftsleben bezieht, das im marktwirtschaftlichen Jargon „Realwirtschaft“ heißt. Weshalb das theoretisch nötig und sachlich wichtig ist, ist wohl auch nicht recht verstanden worden; deswegen auch dazu zwei Hinweise, ein methodischer und ein sachlicher.
In einer Ableitung, so wie Marx sie fürs Kapital lehrbuchmäßig darlegt und wie wir versucht haben sie fortzusetzen, ist – wenn sie richtig ist – jedes wichtige Ergebnis der Ausgangspunkt für Konsequenzen, die ihrer eigenen „Logik“ folgen und nicht mehr der, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Das fängt bei Marx schon mit dem Übergang vom Tauschwert der Ware zum Geld als allgemeinem Äquivalent an; mit dem Fortgang vom Geld als allgemeinem Zugriffsmittel zum Geld als Zweck und als Kommandomittel über seine eigene Quelle beginnt die politische Ökonomie des produktiven Kapitals; usw. Wenn dann – auf viel späterer Stufe – die Geldhändler aus ihrem Dienst an der Geldzirkulation ein Geschäft mit dem Verleihen aktuell nicht gebrauchter Geldsummen machen, nämlich fremdes Kapital vergrößern und dafür am Profit partizipieren, dann ist die Natur dieses Geschäfts zu begreifen. Wer da nur bemerken will, dass Mehrwert umverteilt wird und der Zins den vom kommerziellen Kreditnehmer ausbeuterisch angeeigneten Früchten der Arbeit entstammt, wer sich also, methodisch gesprochen, mit der theoretischen Zurückführung der Konsequenz auf ihre Herleitung zufrieden gibt, der verpasst das Entscheidende: dass diese Geschäftssphäre sich mit dem neuen Instrumentarium der Eigentumsübertragung und der Rück- und Zinsforderung, also mit der rechtlich verselbständigten Macht des Geldkapitals auf den Verwertungsprozess des angewandten Kapitals bezieht. Man muss also schon das verselbständigte Geldkapital und den Zins als Fortschritt in der – wie Marx es ausdrückt – „Veräußerlichung des Kapitalverhältnisses“ weiterdenken. Da gibt es dann den Fortgang – um den wir zu Beginn des 2. Kapitels länger gerungen haben – vom Gebrauch des Geldes als Leihkapital zum Kapitalmarkt, auf dem das Kreditverhältnis selber zur Handelsware wird. Die „Logik“ dieses Handels, die Berechnungen, die da zum Zuge kommen, die neue ökonomische Kategorie der Bewertung, der spekulativen Ableitung eines Kapitalwerts aus der erwarteten Rendite: das alles ist gerade nicht verstanden, wenn man immer nur auf den Endpunkt des vorherigen Ableitungsschritts zurückblickt und festgehalten haben will, dass in Wertpapieren „letztlich“ doch auch nichts anderes drinsteckt als ein Stück Leihkapital. Da werden eben finanzkapitalistische Rechtsverhältnisse in neuer Weise produktiv. Und wenn der spekulative Charakter dieser eigenartigen Produktivkraft, die Wertschöpfung per Bewertung, selber zum Geschäftsobjekt wird, dann liegt mit den Derivaten schon wieder ein – theoretisch weniger bedeutender, praktisch dafür recht brisanter – Übergang vor. Nur so jedenfalls kommt man der Logik der Sache auf die Spur – am Ende eben jener Verselbständigung des Finanzkapitals, die ihm seine praktische Wucht verleiht.
Denn die Macht der Branche: ihre Potenz, sich selbst und die restliche Geschäftswelt auf Schuldenbasis mit Zahlungsmitteln auszustatten, damit die Akkumulation des eigenen Geldkapitals wie die Kapitalakkumulation in allen anderen Geschäftszweigen von den Schranken des schon verdienten Geldes freizusetzen usw., steht und fällt mit ihrer Autonomie, ihrer aparten Stellung im und zum System, die sie sich mit ihren Diensten an dessen Funktionieren verschafft. Das Finanzkapital ist das Gewerbe, das der Konkurrenz der Kapitalisten insgesamt als die verselbständigte Zusammenfassung, die systemeigene Vergesellschaftung der Privatmacht des Geldes gegenübertritt und darüber Regie führt. Damit ist es die gesamtwirtschaftliche Triebkraft dafür, dass die kapitalistische Produktionsweise sich sämtlicher gesellschaftlicher Ressourcen und Überlebensbedingungen bemächtigt; dass „das“ Kapital alle Länder des Globus zu seinen Investitionssphären macht; dass es nach seinen Bedürfnissen immer neue anspruchsvolle Verwertungsbedingungen entwickelt und Mensch und Natur dafür zurechtmacht, also verschleißt. Kraft seiner Sonderstellung im und zum System ist das Kreditwesen die „systemische“ Branche schlechthin: Indem es die weltweite Geschäftswelt mit Geschäftsmitteln versorgt, für seinen Geschäftserfolg in Beschlag nimmt und von seinen Erfolgen abhängig macht, geht es wie selbstverständlich von der totalen und totalitären Herrschaft des Geldes über den Lebensprozess der Menschheit aus und besorgt das Herrschaftsmittel. In dieser Funktion wird es von der politischen Gewalt nicht gebremst, sondern anerkannt, beansprucht und gepflegt; der letzte Teil unseres Aufsatzes wird davon handeln, wie die Staatsgewalt sich in ihrer Konkurrenz gegen ihresgleichen dieser Macht des Finanzkapitals bedient – und wie das Finanzkapital auch dadurch an Macht gewinnt.
Aus alldem folgt übrigens ein politischer Schluss: Der Kampf um eine Beschränkung der Freiheiten des Kreditgewerbes gehört in seiner normalen Fassung und auch dann noch, wenn er in der Krise zum offenen Streit ausartet, zur unauflöslichen Symbiose von Staatsmacht und Bankwesen dazu. Auch in seinen radikalsten Varianten hat er mit einem Kampf gegen die Herrschaft des Kapitals nichts zu tun. Deren Abschaffung geht nur per Kündigung: dadurch, dass das Kommando des Geldes über die Arbeit von denen aufgekündigt wird, die sie tun. Damit ist auch aus der Macht der Finanzwelt die Luft ’raus – und nicht nur aus den Blasen.
[1] Praktisch in jeder Nummer seit Heft 3-07.
[2] In den Nummern 3-08, 2-09 und 1-10 dieser Zeitschrift.
[3] Alle Welt versteht die Sache lieber umgekehrt: Mit der Krise würde offenbar, dass die Kredite, die das Finanzgewerbe vergibt, wichtig und produktiv und überhaupt unverzichtbar sind, die besseren Kreditpapiere jedoch, an denen dieses Gewerbe am meisten verdient, eigentlich bloße Blasenbildner, Vorspiegelung falscher Tatsachen, jedenfalls kein wirklicher geldwerter Reichtum. Wenn das die Wahrheit wäre: was wäre dann schlimm daran, dass in der Krise „die Blase platzt“ und die vorgespiegelten Werte ihrer Nichtigkeit überführt werden? Wenn man über das Finanzkapital Bescheid wissen will, dann sollte man erst einmal versuchen zu begreifen, was es leistet und was überhaupt los ist, wenn seine Rechnungen aufgehen; nur dann weiß man auch, woran es scheitern kann und was alles fällig ist, wenn es scheitert. Seine Produkte, weil sie sich entwerten können, für „eigentlich“ nichtig zu erklären, ihr Kaputtgehen also mehr oder weniger für ihre Erklärung zu nehmen, ist verkehrt, ist eine Art, sich das Nachdenken darüber zu ersparen, und ist außerdem bedenklich nahe an der bürgerlichen Denkweise, die die Dinge nach ihrem Erfolg beurteilt.
[4] Es ist der große Fehler der Freunde der „Arbeitswertlehre“, dass sie im Wert nicht die Indienstnahme der gesellschaftlichen Arbeit – dieses notwendigen „Stoffwechsels des Menschen mit der Natur“ – für einen ihr fremden und feindlichen Zweck erkennen, sondern, den bürgerlichen Ökonomen ähnlich, den Wert für eine hilfreiche Abstraktion halten, nämlich für die Gleichsetzung verschiedener Arbeiten und Arbeitsprodukte zum Zweck ihrer leichteren Vergleichbarkeit und Addition. Ihnen gilt die fürs Eigentum verrichtete Arbeit als eine ganz vernünftige Weise, die für die Gesellschaft notwendige Arbeit zu organisieren; kritikwürdig finden sie nur, dass die bürgerliche Welt nicht zugeben mag, dass der ganze schöne Wert aus Arbeit stammt. Marx’ Kritik der wertschaffenden Arbeit verstehen sie als deren Rehabilitation und Aufwertung und setzen dem bürgerlichen Standpunkt den proletarischen Stolz der „Schöpfer allen Reichtums und aller Kultur“ entgegen, dass ihre Maloche die einzige und ganze Quelle des Reichtums sei. Aus dem Dienst, den die Arbeiterschaft dem Gemeinwesen leistet, leiten ihre politisch-ideologischen Fürsprecher ab, dass der „volle Arbeitsertrag“, der ihr zustünde, größer auszufallen hätte als der Lohn, den man ihr zahlt. Marx aber war kein Freund des echten Werts; er mochte den Arbeitern nicht dazu gratulieren, dass sie und nur sie den ganzen Wert schaffen. In seiner Kritik des Gothaer Programms (1875) tritt er einem entsprechenden Lob der Arbeit durch die damaligen Sozialdemokraten ausdrücklich entgegen: Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums
– jedenfalls nicht, soweit nicht vom Wert, sondern vom materiellen Reichtum die Rede ist. Der hängt ebenso von Bedingungen der Natur wie vom Stand von Wissenschaft und Technik ab. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpferkraft anzudichten
, setzt Marx hinzu: Sie sind die Nutznießer der Arbeit, die den Wert schafft. Ein sozialistisches Programm aber hätte sich solcher bürgerlicher Redensarten
zu enthalten (MEW 19, S. 15).
[5] Marx greift zu allerlei verwegenen Bildern, um diese Subsumtion der Arbeit unter das kapitalistisch angewandte Eigentum, die Inkorporation ihrer Potenzen durch das Kapital, so kenntlich zu machen, dass auch der an jede marktwirtschaftliche Gemeinheit gewöhnte Verstand die der kapitalistischen Produktionsweise eigentümliche und sie charakterisierende Verkehrung, ja Verrückung des Verhältnisses von toter und lebendiger Arbeit
(Das Kapital Bd. 1, MEW 23, S. 329) begreift: Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich vampyrmäßig belebt durch die Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.
(ebd. S. 247)