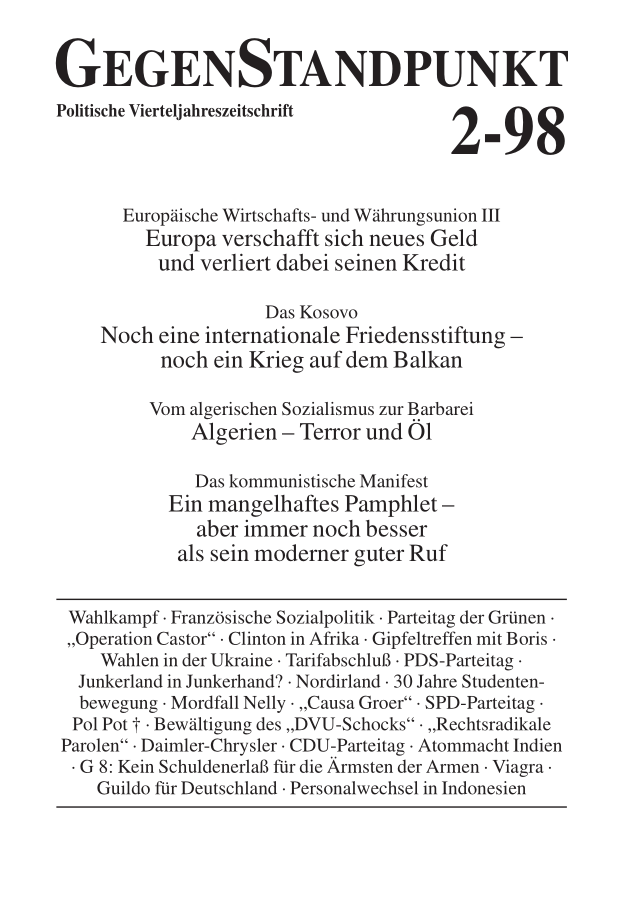Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Das Wahlversprechen der SPD:
„Der nächste Kanzler wird ein Niedersachse sein!“
Einige Erläuterungen dazu, warum die SPD-Wahlstrategie, statt auf ‚Überzeugungsarbeit‘ einfach auf Schröder und seinen unbedingten Willen zur Macht als alleiniges Argument zu setzen, tatsächlich das perfekte und endgültige Angebot an den demokratischen Wähler ist.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Das Wahlversprechen der SPD:
Der nächste Kanzler wird ein Niedersachse sein!
Gerhard Schröder gewinnt die Landtagswahl in Niedersachsen. Die SPD legt sich ihm umgehend zu Füßen, akklamiert ihn als ihren Kanzlerkandidaten – und verfügt damit schlagartig über ein vollständiges und perfektes Wahlprogramm. Das besteht aus folgenden vier Punkten:
- Schröder
ist bereit
. Wozu – das versteht sich von selbst: zum Regieren, wozu denn sonst. Sein Wahlversprechen besteht in der nichts beschönigenden Ankündigung:Ich will die Macht!
Ansprüche an die Handhabung der Macht, wenn sie erst einmal in Schröders Händen liegt; Bedingungen, an die die von ihm gewünschte Ermächtigung geknüpft wäre; erst recht irgendwelche speziell parteipolitischen Zielsetzungen, mit deren Verwirklichung er sich vom Wähler „beauftragen“ lassen möchte: den ganzen Schein, im Wahlkampf würden sich Wähler und Gewählte über die Vorhaben des Gemeinwesens einig, wischt Schröder damit vom Tisch. Deutschland gehört regiert, und zwar gescheit, also durch ihn: Das ist Programm genug – mehr hat der Wähler ja ohnehin nicht zu entscheiden. Eine zusätzliche Parteiprogrammatik könnte diese Hauptsache nur verwässern. Umgekehrt verbürgt die klare Zurückweisung aller eventuellen parteieigenen „Sonderwünsche“ die Überparteilichkeit des Kandidaten, seine unbedingte Hingabe an die Sache der Macht – worin auch immer die besteht; im Großen und Ganzen kennt man sie aus den Geschäften der amtierenden Regierung. Die Konkurrenz zu den derzeitigen Machthabern wird also mit der unmißverständlichen Ankündigung eröffnet, die SPD werde sich von denen in der Sache, nämlich was die anzupackenden „Probleme“ der Nation, die herrschenden „Sachzwänge“ – „der Wirtschaft“ vor allem – und die politische „Tagesordnung“ betrifft, nicht unterscheiden. Der Kandidat legt damit den unwiderleglichen Beweis seiner Regierungsfähigkeit vor: Alles das, was die Koalition treibt, und nur das will die Opposition auch.Damit ist die Bahn frei für Programmpunkt 2: die Antwort auf die Frage, warum es dann überhaupt einen Personalwechsel geben soll.
- Gerhard Schröder ist neu, Helmut Kohl hingegen alt, verbraucht, mit seinen unvorsichtigen Versprechungen – „blühende Landschaften“ im Osten, Halbierung der Arbeitslosenzahl – gescheitert, mit allen groß angekündigten Reformvorhaben steckengeblieben, an seinen eigenen Maßstäben gemessen also erfolglos, ein Repräsentant des politischen Stillstands – und nicht nur das. Irgendwie – Umfrageergebnisse zeigen das – ist die Nation ihn leid; und nicht einmal die eigene Partei steht noch so völlig fraglos hinter ihm wie bisher: ein Machthaber im Niedergang. Der „Kanzlerbonus“ – jene wunderbare Ausgeburt demokratischer Vernunft, derzufolge die Tatsache, daß einer die Macht hat, auch schon beweist, daß er sie verdient, eben weil er es geschafft hat, sie zu kriegen – verkehrt sich bei Kohl allmählich in sein genauso logisches Gegenteil: Wenn ein Machthaber nicht mehr unumschränkt über die Macht verfügt, die er hat, ist das der Beweis, daß er sie nicht mehr verdient, eben weil er sie nicht mehr wirksam zur Sicherung seines persönlichen Machtmonopols einzusetzen vermag. Von dieser „Schwäche“ des Kanzlers profitiert der Konkurrent: Der „Kanzlermalus“ Kohls ist sein Wahlargument. Das läßt sich auch als Sachprogramm ausdrücken und lautet dann
Innovation
: Bei dem Stichwort soll der Wähler sich gar nichts weiter denken, als daß der alte Kanzler schon viel zu lange an seinem Sessel klebt.Und das langt schon als Empfehlung für Schröder?
- Eben das ist der demokratische Clou am diesjährigen Wahlprogramm der SPD: genau diese Frage öffentlich aufgeworfen, kontrovers diskutiert und dann – nicht, wie beim letzten Mal, einem parteiinternen Mitgliederentscheid, sondern – dem deutschen Wähler, Abteilung Niedersachsen, zur Entscheidung vorgelegt zu haben. Ohne monatelange Vorbereitung – das berüchtigte „Offenhalten der Kandidatenfrage“ und Schröders Zielvorgabe, maximal 2 Prozentpunkte verlieren zu dürfen – hätte der wahlberechtigte Niedersachse womöglich bloß über die Zusammensetzung seines Landtags abgestimmt. Mit ihrem zielstrebigen Einsatz ist es der SPD aber gelungen, die Wahl zum Test darauf zu machen, ob Schröders unverbrauchter, also innovativer Machtwille als Konkurrenzwaffe gegen Kohl taugt. Und siehe da: Er hat getaugt. Die 2 Prozentpunkte Stimmenzuwachs sind der über jeden Zweifel erhebende Beweis. (Nörgelnden Nostalgikern der Sozialdemokratie, die in dieser Beweisführung zu wenig Traditionsbestand und „Idee“ entdecken, bleibt ohnehin keine andere Wahl und außerdem der Trost, daß ihr Parteichef für sie ein Herz hat.)
- Es bleibt die alles entscheidende Aufgabe, die Überzeugungskraft dieses Beweisstücks bis zur Wahl im September lebendig zu erhalten. Daraus ergibt sich Punkt 4 des sozialdemokratischen Parteiprogramms: nichtendenwollender Jubel für den Kandidaten; so als gäbe es mindestens jeden Monat einmal einen Wahlsieg zu feiern. Das will sorgfältig inszeniert sein, damit es der Wähler einerseits merkt, andererseits nicht leid wird. Als gutes Hilfsmittel dafür wird der altbekannte Kunstgriff eingesetzt, die kritische Öffentlichkeit mit der Strategie bekanntzumachen, die die Parteijubelinszenierungszentrale sich ausgedacht hat, und das Urteil einzuholen, auf dem übrigens auch sonst die Wirkung aller Reklame beruht, nämlich die anerkennende Würdigung: „gut gemacht!“ Letzter und Hauptpunkt des Schröder-Wahlkampfs lautet daher: beim Wahlkampf den Eindruck von Professionalität professionell ‚rüberbringen‘. Allerdings ist in der gehobenen Öffentlichkeit kurzfristig Besorgnis über eine
Amerikanisierung des Wahlkampfs
laut geworden. Den Schein, es käme darauf an, den Wähler mit guten Argumenten von den Leistungen der Politik des jeweiligen Kandidaten zu überzeugen, will man nicht einfach aufgeben. Die berufenen Vertreter der Lüge, Wahlen seien noch etwas anderes als Ermächtigung, nämlich politische Überzeugungsarbeit, haben sich deshalb betroffen zu Wort gemeldet – und prompt wieder abgemeldet. Ziemlich umstandslos ist ihre Besorgnis über den schlagartigenWandel der demokratischen Wahlkultur
– als ob bisher ganz anders um Stimmen gekämpft worden wäre! – der Bewunderung gewichen, wie gekonnt und erfolgreich, geradezugenial
einfach Schröder sich und seinen Willen zur Regierungsmacht als alleiniges Argument durchgesetzt und damit den Kanzler in Bedrängnis gebracht hat.
*
Diese schlaue Art, um Wählerstimmen zu werben, ist alles andere als neu. In funktionierenden Demokratien ist sie im Gegenteil längst die Regel; und überhaupt ist sie das perfekte und endgültige Angebot an den mündigen Wähler. Deswegen bedarf sie auch immer von neuem einer kleinen Erläuterung.
Einerseits ist diese Sorte Wahlpropaganda nämlich schon selber fast die entlarvende Wahrheit über die demokratische Freiheit, die im Wahlakt zu ihrer Höchstform aufläuft: Es wird gar nicht geleugnet, daß es für den Wähler in der Sache des Regierens gar nichts zu entscheiden gibt; es wird überhaupt nicht verheimlicht, daß es allein Sache des Gewählten ist zu entscheiden, was er genauso weitermacht wie bisher und was eventuell anders; es wird nicht im geringsten beschönigt, daß vom Volk Ermächtigung pur, also – umgekehrt – die Zustimmung zu einer an keinerlei Bedingungen geknüpften Unterwerfung unter die Macht und ihren inskünftigen Inhaber verlangt ist. Und wenn für diesen so zirkulär mit seinen guten Erfolgsaussichten geworben wird, dann kommt das dem Eingeständnis nahe, daß es einen vernünftigen Grund für diesen Gehorsamsakt ohnehin nicht gibt, und daß die ganze Freiheit des demokratischen Wählers sich darin verwirklicht, vorweg der Figur akklamiert zu haben, der er hinterher sowieso staatsbürgerliche Gefolgschaft schuldet.
Andererseits will die demokratische Wahlwerbung, die die Sozialdemokratie mit ihrem Schröder jetzt so mustergültig durchzieht, bloß beinahe so verstanden sein – nämlich exakt umgekehrt. Der entscheidende Knackpunkt ist dabei der: Der Kandidat und Machthaber in spe unterwirft sich mit der Kundgabe seines Machtwillens der Prüfung durch das wahlberechtigte Volk. Das ist die formelle Sachlage und zugleich die entscheidende Verkehrung des wirklichen Verhältnisses: Die Leute, die in und mit allen ihren wirklichen Lebensverhältnissen der Staatsmacht bloß unterworfen, Objekt des Regierungshandelns sind, werden in aller Form als Berufungskommission in Anspruch genommen, und zwar nicht für irgendein, sondern fürs allerhöchste und wichtigste Staatsamt. Aus dem Status der Manövriermasse der angesagten Herrschaft werden sie – ideell und für den Akt der Stimmabgabe sogar praktisch – in den des entscheidungsbefugten Prüfers der konkurrierenden Bewerber befördert. Alle Gegensätze zwischen Herrschaft und Regierten sind damit zum Verschwinden gebracht, und zwar ohne großartige ideologische Erklärungen über den Nutzen staatlicher Gewalt für die Leute, die ihr gehorchen müssen: Herrschaft wird als Job vorstellig gemacht; ihre Ausübung: das Vorschriften-Machen und das gewaltmonopolistische Durchsetzen herrschaftlicher Anliegen, erscheint als Berufsbild, dem der Kandidat zu genügen hat; passenderweise mit einem entsprechend groß dimensionierten persönlichen Machtwillen. Umgekehrt brauchen die Leute auch als Wähler ihre gemischten bis schlechten Erfahrungen mit der staatlichen Herrschaft, der sie unterliegen, keineswegs zu vergessen. Im Gegenteil: Sie sollen sich an die materiellen und sonstigen Sorgen und Wünsche, Erwartungen und Enttäuschungen, die sich mit ihrem Dasein als Manövriermasse der Staatsmacht unweigerlich einstellen, durchaus erinnern – allerdings nicht, um daraus einen vernünftigen Schluß zu ziehen. Ihre Freiheit als Wähler erstreckt sich auf den höchstpersönlichen Beschluß, nichts anderes als die eine Alternative zu entscheiden, die die Demokratie ihnen vorgibt, und dem einen Bewerber eher als dem andern die Ausübung der Macht für die nächste Periode anzuvertrauen. Demokratisch reif ist ein Volk, dessen Mitglieder diesen Gebrauch ihres freien Urteilsvermögens ganz normal finden; also gar keine besonderen – und dann doch nur allzu leicht zu enttäuschenden – Illusionen über den menschenfreundlichen Nutzen staatlicher Gewalt benötigen, um den ihnen angetragenen Perspektivenwechsel – vom Untergebenen des politischen Willens, der an die Regierung kommt, zum letztentscheidungsbefugten Auftraggeber der Regierenden – zu vollziehen; vielmehr gleich gar keine andere Frage stellen und sich beantworten als die nach der Qualifikation ihrer wahlkämpfenden Machthaber für den angestrebten „Job“. Dementsprechend beweisen Politiker demokratische Perfektion, wenn sie ihren Wählern gar nicht erst mit verlogenen Versprechungen kommen, was sie mit der Macht für menschenfreundliche Dinge anstellen würden, wenn sie sie erst haben, sondern schlicht mit den Tugenden prunken, die sie tatsächlich an den Tag legen: mit ihrem unbedingten Willen zu uneingeschränkter Macht und mit ihren sichtbar von Erfolg gekrönten Bemühungen, damit bei einer sachkundigen Wählerschaft auch tatsächlich gut „anzukommen“.
Darauf, wie gesagt, hat sich die deutsche Sozialdemokratie mit ihrem niedersächsischen Kanzlerkandidaten ohne Wenn und Aber festgelegt: Der Mann mit seiner Arroganz ist die Substanz ihres Wahlprogramms. Den Maßstäben perfekter Demokratie genügt sie so genau, daß sie gleich ihrerseits Maßstäbe dafür setzt, wie im Deutschland der Jahrtausendwende Demokratie im allgemeinen und Sozialdemokratie im besonderen funktioniert. Jetzt muß sie nur noch konsequent alle Rückfälle in alte Sozi-Heucheleien, in den ideologischen Schein eines speziell „linken“ Auftrags an die staatliche Macht, in parteispezifische Idealismen der Versöhnung von Herrschaft und „Unterprivilegierten“ vermeiden – dann bekommt die Koalition mit ihrem „Kanzler des Stillstands“ tatsächlich noch ein Problem.