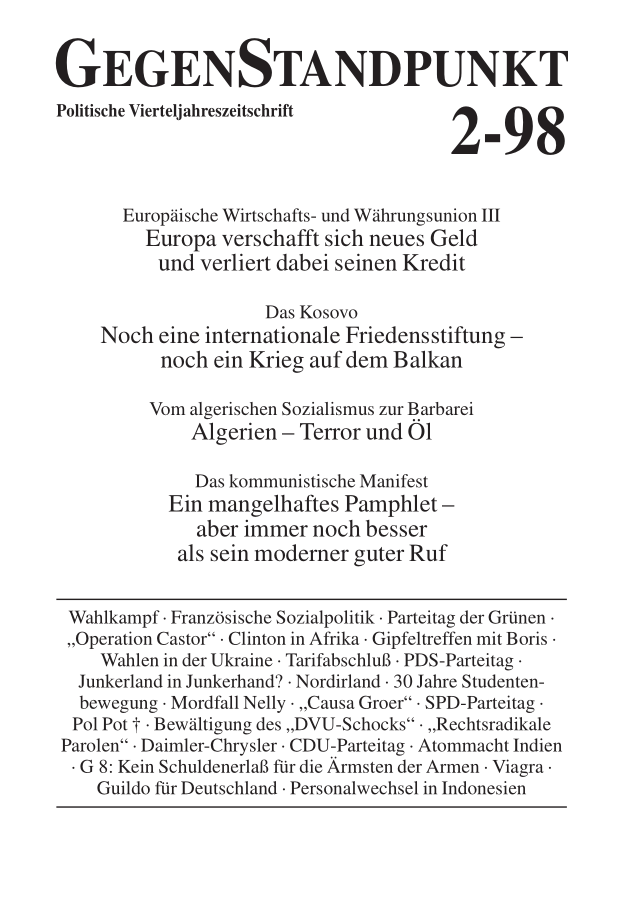Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt, CDU-Parteitag in Bremen
Endlich ein Wahlkampfthema: Antikommunismus!
Neu am Wahlkampf 98 ist nicht der Kampf um ‚Glaubwürdigkeit‘, das Inszenieren der Fähigkeit zum Herrschen als Eigenschaft der Person; neu ist die Penetranz, mit der die Parteien die Techniken der Wahlwerbung öffentlich aufsagen und selbst zum werbenden Argument machen: Ein Musterbeispiel dafür ist die ‚Rote-Socken-Kampagne‘ der CDU.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt, CDU-Parteitag in Bremen
Endlich ein Wahlkampfthema: Antikommunismus!
„Verzweifelt sucht die Union ein neues Wahlkampfthema. Auf dem Parteitag in Bremen soll nun Gerhard Schröder als Kommunistenfreund vorgeführt werden – wegen einer PDS-tolerierten SPD-Regierung in Magdeburg. Doch das alte rote Gespenst schreckt die Deutschen kaum noch.“ (Spiegel, 18.5.)
„Die Angst in der CDU: Wird Kohl es noch mal schaffen, das Steuer herumzureißen? Wird Wolfgang Schäuble dem Parteichef mit einer brillanten Rede wieder die Schau stehlen? Das soll Kohl nicht noch einmal passieren: Seit zwei Wochen bereitet er sich auf seinen Auftritt vor. Die Parteitagsregie hat vorgesehen, daß der direkte Vergleich zwischen Kohl und Schäuble erschwert wird. Schäuble spricht einen Tag später. Und sollten die Delegierten Schäuble zu lange zujubeln, sollen die Mitglieder des Parteipräsidiums demonstrativ mit Klatschen aufhören und sich einfach hinsetzen.“ (Bild am Sonntag, 17.5.)
Worum geht’s? Kindergarten? Vorlesewettbewerb? Gruselfilm? Jeder weiß es sofort: Der Bericht handelt von der Vorbereitung einer freien Wahl, dem höchsten Gut der Demokratie. Keiner fühlt sich an Manipulation und Jubelperser erinnert, an finstere Kalte-Kriegs-Zeiten und Horror-Reportagen über maoistische Klatschorgien. Nein, all diese Berechnungen der Parteien in Hinblick auf den Wählerverstand, die Wirkung, auf die sie zielen, die Albernheiten und Gemeinheiten, mit denen sie auf einander und ihr Stimmvolk losgehen, stehen jeden Tag in der Zeitung – und jeder versteht sie, ohne am Verstand der Akteure zu zweifeln. Was ist da los?
- Im Wahlkampf werben die Parteien um den Wähler. Sie bitten ihn, sie mit der Lösungsgewalt für die immer selben „Problemlagen“ zu betrauen: In dieser Hinsicht – Wachstum, Arbeitslosigkeit, Standort, Europa, Frieden – gibt es auch nichts zu vergleichen, weil sie einander gleichen. Umso mehr wollen sich die Kandidaten darin unterscheiden, wer das, worin sie sich nicht unterscheiden, besser kann: Sie bewerben sich um die Führung der Nation und werben damit, daß sie diese Eignung besitzen, andere dagegen weniger. Die Parteien werben dafür, daß der Wähler ihnen das glaubt. Sie eröffnen den Kampf um „Glaubwürdigkeit“ – um die Beglaubigung jener fürchterlichen, original-demokratischen Tugend, die darauf zielt, die Fähigkeit zum Herrschen als Eigenschaft der Person darzustellen: Wem das geglaubt wird, ist der Macht würdig; der verdient sie. Wahlen und Politbarometer sind darauf der Test, Wahlkampf und Parteitage dessen Instrumente: Je massenhafter die Akklamation, je lauter der Jubel, desto perfekter der Eindruck. Auf den kommt es nämlich an.
- Deshalb hat die CDU neidisch auf die „Showveranstaltung“ (Kohl) nach Leipzig geschaut, wo „der Kandidat Schröder Modernität vorgaukelte, ohne konkret zu werden“ (Schäuble). Dessen Tour, sich als die Inkarnation des „Modernen“ und den Kanzler als „verbraucht“ hinzustellen, macht ihr zu schaffen. Daß er einfach der bessere, effektivere Mann für die Führung der Staatsgeschäfte ist: Mit dieser nüchtern ins Laserlicht gesetzten Botschaft kommt der Mann bei den Wählerinnen gut an. Er hat es damit zum Leidwesen der C-Partei auch geschafft, den Krieg der Werte abzusagen, mit dem sie bisher noch jeden Kampf um die Glaubwürdigkeit gewann. „Freiheit oder Sozialismus“! Daran konnte man die Parteien noch unterscheiden; mit moralischen Alternativen höchsten Kalibers wurde der Wähler belämmert, und immer erfolgreich. Jetzt ist der Russe weg und ein Gegenkandidat da, dem Kommunismusverdacht nur schwer anzuhängen ist. Schäuble über das Leiden der CDU an Schröder: „Unser Problem ist, daß man einen Pudding nicht an die Wand nageln kann“ und der Pudding immer bessere Umfrage-Werte erzielt.
- Mit der Schlappe in Sachsen-Anhalt ist unwiderruflich klar: Die CDU braucht eine Wählerrückgewinnungs-Strategie. Die besteht pikanterweise in der öffentlichen Bekanntmachung ihrer Sorgen: „Verzweifelt sucht die Union ein neues Wahlkampfthema“ – ein Thema, irgendein Thema muß her, ein
zündendes
, wenn ihre Politik schon nicht „honoriert“ wird. Es gehört zur berufsmäßigen Arroganz der Mächtigen, daß sie ein schlechtes Wahlergebnis nie als Kritik ihrer Taten, sondern stets als Unterlassungssünde in Sachen Wählereinseifen begreifen. Sie denken nicht nur heimlich so, sie wälzen ihre Betörungsprobleme sogar vor den Augen derer, die sie von sich überzeugen wollen: Der doofe Wähler hat uns in ein „historisches Stimmungs-Tief“ gestürzt; also müssen wir überlegen, wie wir seine Laune wieder auf uns ziehen. Vielleicht bekommt er ja Mitleid, wenn wir ihm unsere Nöte erzählen, ihn rumzukriegen. Da wird den Christen eine „wundervolle Hilfe“ zuteil: Die SPD will sich von der PDS „tolerieren“ lassen – und die CDU freut sich. Genauer gesagt, sie hat die Gelegenheit, ein Wahlfiasko selten produktiv zu machen, selbst herbeigeführt. Anstatt sich eine Runde zu schämen, wird die an sich gar nicht üble Aussicht, als Verlierer an der Macht beteiligt zu werden, zugunsten eines noch höheren Gesichtspunkts geopfert: Das ist die Chance, den Schröder doch noch auf „Kommunismus“ zu nageln. Endlich kein „Europa“-Wahlkampf mehr, der den Wähler nur anödet: Wir zünden die Rakete Antikommunismus und führen einen „kristallklaren Lagerwahlkampf“ (Hintze). „Kristall“klar, das ist bekanntlich noch klarer als klar, also eigentlich unwidersprechlich: Mit solch offensiv vorgetragenen Dummheiten rufen sie den Antikommunismus auf und ab, den sie selber erzeugen. -
„Niemals in Deutschland darf die Regierung von den Stimmen der Kommunisten abhängig sein“ (Hintze). Kohl warnt vor „dem Weg in eine andere Republik: Im Kampf gegen den politischen Extremismus darf man auf keinem Auge blind sein. Rechts- und Linksradikale dürfen in Deutschland nie wieder Einfluß bekommen“ (SZ, 19.5.). „Die PDS ist eine kriminelle politische Vereinigung“ (Waigel). „Es spricht nicht für eine Partei, daß sie gewählt wird. Hitler ist auch gewählt worden“ (Scharnagl, CSU).
Endlich hört man es einmal aus berufenem Munde: Daß eine Partei gewählt wird, spricht in keinster Weise für sie. Diese Wahrheit erfährt der Wähler des Jahres 98 allerdings nur, weil die Tatsache, daß die Deutschen vor 65 Jahre einen Hitler wählten, der dann den Krieg gegen die Russen verlor, heute eindeutig nicht gegen die CSU, sondern gegen die „SED-Nachfolgepartei“ spricht. Das Bedürfnis deutscher Demokraten, Kommunisten umso heftiger ausrotten zu wollen, je weniger sie sich störend bemerkbar machen, ist offenbar so unausrottbar, daß seine Erfüllung zu dem Wahlversprechen 1998 wird. Mit dem schieren Hinweis „Diese Partei will die Gesellschaft verändern“ – eine andere Republik – wird der Wähler im dürrsten und abstraktesten Nationalismus aufgerufen, den man sich nur vorstellen kann.: In der Tugend, pur und bedingungslos für diesen Laden zu sein, wie er geht und steht. Wer mit Hilfe der bewährten Gleichung Rot=Braun Verfassungsschutzpatriotismus zum Wahlprogramm erhebt, der spricht den Bürger als lupenreinen Anhänger seiner Staatsgewalt an und verspricht ihm ein Kampfprogramm gegen die Feinde der Demokratie als Befriedigung des einzigen Bedürfnisses, in dem die Politik ihre ansonsten eher „verwöhnten“ Untertanen noch verwöhnen mag. Kohl, der „verzweifelt“ sein Wahlkampfthema gesucht und gefunden hat – keine Bange: Er muß den Antikommunismus nicht heucheln! –, stellt sich als Retter aller höchsten Werte auf, die ihm, also uns allen, lieb und teuer sind: Retter der Einheit der Nation, die „Schröders Magdeburger Modell“ der kriminellen „Partei Der Spaltung“ (Waigel) opfert; Verteidiger der Einheit aller wehrhaften Demokraten, die „Kommunistenfreund“ Schröder untergräbt, gegen „die Gefahr von rechts und links“; Bollwerk gegen den Sittenverfall, gegen das „unmoralischste Angebot, das die SPD je hatte“ (Hintze über Schröder), „indem wir Tugenden wie Fleiß, Leistungsbereitschaft und nationales Verantwortungsgefühl dagegensetzen“ (Schäuble in Bremen). Kein Wunder, daß für diese Appelle, die mitten und exklusiv auf die Moral von Nationalisten zielen, Horrorszenarios der Unregierbarkeit und Verbrechervorwürfe gerade recht sind.Daß die interessierte Öffentlichkeit die Frage aufwirft, ob das „Gespenst“ Kommunismus „noch erschreckt“, ist da nur konsequent und wirft ein Licht auf ihr Interesse: Gegen die plumpe Tour des Antikommunismus hat sie einzuwenden, daß sie zu plump ist und deshalb nicht verfängt. Damit bestätigt sie einerseits den Maßstab der Kritik; andererseits täuscht sie sich auch. So „verstaubt“ ist der Antikommunismus wirklich nicht, als daß zur Macht strebende, moderne Sozialdemokraten keine Angst vor dem „Kommunistenfreund“-Vorwurf hätten:
- Die umgehende Beteuerung der SPD (Schröder:
Das größte Problem der Nation ist nicht die PDS, sondern sind die Arbeitslosen
) zeigt, daß sie die „Drohung mit einem Lagerwahlkampf“ in der Tat als Drohung sieht. Als Bedrohung ihres Wahlkampfthemas eben. Es gehört zur berufsmäßigen Arroganz der Mächtigen, daß sie die Betroffenen der Politik immer gleich und nur als Kronzeugen für ihre eigenen Sorgen zitieren: Also heißt der Vorwurf nicht, Kohl zieht den Arbeitslosen das Geld aus der Tasche, sondern er klaut der SPD ihr Thema. Wenn er ihr mit „Roten Socken“ kommt, zieht dann die Tour noch, die Arbeitslosen als „Kohls Arbeitslose“ und die vermessene Ankündigung ihrer „Halbierung“ als Bruch eines Versprechens anzuprangern? Wenn ihr Spitzenmann als „kommunistenabhängig“ gilt, beschädigt das die „Führungskraft Gerhard Schröders“, die doch sein glaubwürdigstes Markenzeichen ist? Da gilt es, die Retourkutsche auszufahren:Spiegel: „Aber das Magdeburger Modell liefert der Union eine Steilvorlage für den Vorwurf, die SPD mache sich abhängig von den Kommunisten.“
Lafontaine: „Ausgerechnet Kohl muß das sagen, der große Freund von Staatsmännern wie Jelzin, Kwasniewski und Horn, die alle Ex-Kommunisten sind. Ausgerechnet Kohl, der ohne die Stimmen der Abgeordneten aus Ost-CDU und Bauernpartei, also einstiger SED-Spezis, heute nicht Kanzler wäre. Zudem arbeitet die Ost-CDU auf Landkreis- und Kommunalebene intensivst mit der PDS zusammen. Das Ganze ist der Gipfel der Unglaubwürdigkeit.“ (21/98)
Herr Lafontaine, wir danken Ihnen für die Klarstellung: Zu glaubwürdiger antikommunistischen Hetze ist nur befugt, wer selber sauber ist. Eines wird beredt offengelassen: Ist Kohl jetzt auch böse, weil er mit Jelzin sauniert, oder ist die SPD nicht böse, weil auch Kohl mit der PDS kann? Wahrscheinlich beides. Jedenfalls gibt auch die SPD zu erkennen, daß sie das Geschäft der moralischen Wähleranmache versteht. Den Wettkampf, wer ist der bessere Antikommunist, nimmt sie gerne auf, um sich vom schlimmsten aller Vorwürfe reinzuwaschen. Der Versuch, die CDU im Gegenzug als Faschistenfreundin zu brandmarken (Höppner:
Wer nicht bereit ist, die DVU zu bekämpfen, verharmlost den Holocaust
), war nur von kurzer Dauer. Anti-Ko zieht eben einfach besser als Anti-Fa. Günstiger erscheint es der SPD, sich als Verteidigerin der nationalen Ehre der Ossis aufzustellen. Das Kompliment, man dürfe mit der PDS „nicht alle Ostdeutschen verunglimpfen“, bringt das Interesse der Partei auf den Punkt: Wie der CDU, deren „Lagerwahlkampf“ brutal darauf setzt, daß die antikommunistischen Wessies einfach mehr sind, kommt es ihr bei der Umgarnung dieser 17-Millionen-Minderheit ausschließlich auf den Wähler an. - Dieser Standpunkt ist bei demokratischen Wahlen nichts Neues. Die Parteien beschäftigen Werbeagenturen und Wahlkampfberater, deren ganzer Sinn danach steht, wie sie ihren Mann dem Wähler als die optimale Verkörperung seiner nationalistischen Moral präsentieren, die sie mächtig bedienen. Neu am Wahlkampf 98 ist die Penetranz, mit der sie diese Berechnungen nicht nur anstellen, sondern öffentlich aufsagen. Sie entwerfen nicht nur Wahlkampfstrategien, das Erzählen dieser Strategien ist vielmehr selber ihre Strategie. Sie berichten dem Wähler von den Nöten ihrer Wahlwerbung, die sie mit ihm haben, und verfertigen daraus ein werbendes Argument: Schau hin, wir zeigen Dir im Fernsehen, mit welchen Tricks, Werten und Berechnungen wir Dich einzusammeln gedenken! Es ist seltsam: Was im privaten Leben gilt – wenn man jemanden rumkriegen will und denkt sich dafür eine List aus, dann verrät man sie nicht; tut man’s doch, funktioniert es nicht –, in der Politik gilt das nicht und gelingt. Ihre Strategen setzen und verlassen sich darauf, daß sie es mit Wählern zu tun haben. Das sind eben Leute, die über die Techniken der Inszenierung des Wahlkampfes sich umstandslos auf die Sache stoßen lassen, für die sie – abrufbar – wirklich parteilich sind: Die der Nation, ihr Recht auf Erfolg, pur hingesagt oder in Gestalt von Werten. Die sind durch die bemerkte Berechnung nicht verstimmt, sondern bereit, sie als Werbetechnik für ein gebilligtes Anliegen anzuerkennen – und verlangen da nach Personen, die gute Führung verkörpern. Wenn der Spiegel eine Umfrage macht, ob die „Rote-Socken-Kampagne“ beim Wähler „zieht“, hat er in jeder Antwort diesen perfekt politisierten Stimmbürger vor sich: Die unverhohlenen Techniken der Wahlwerbung sind für ihn Zeugnisse, und zwar mehr oder weniger überzeugende, für die Glaubwürdigkeit der Kandidaten.
- Wenn die Parteien so an die Öffentlichkeit treten und dort erzählen, wie und wofür sie den Wert und dessen Moral konstruiert haben, mit dem sie die Kreuze der Bürger unwiderstehlich attrahieren wollen, und wenn das ihrer Glaubwürdigkeit nicht einmal schadet, dann können sie diesen Widerspruch furchtlos und ungestraft noch mal extra fürs Herz inszenieren: Dann haben die Kandidaten ihren äußeren und das Fußvolk seinen inneren Reichsparteitag. In diesem Sinne ist der CDU-Parteitag in Bremen der Höhepunkt des Wiederaufstiegsversuchs dieser „von Niederlagen und Selbstzweifeln gebeutelten Partei“. Ein erwachsener Delegierter
hofft, daß der Kanzler es schafft, mich zu motivieren
, ist also vorsätzlich bereit, sich von seinem Führer bis zur Gänsehaut motivieren zu lassen, und der schafft das sogar:Wir wollen gewinnen und wir werden gewinnen.
Mit einem Satz ist dieZuversicht
wieder da! 8 Minuten Klatschen. Setzen. Aufstehen. Wieder Klatschen. Bis dem Chef und der ganzen Halle die Tränen kommen. Keine Frage, das ist Kindergarten hoch 3, aber die abgerufene und abrufbare Ergriffenheit gilt einer üblen Sache: Die Gerührtheit des Publikums dient dem Beweis, daß allein die öffentliche Demonstration eines ungebrochenen Willens zur Macht es hinkriegt, patriotisches Fieber für einen guten Zweck zu erzeugen. Denn darin müssen sich Parteileitung, -basis und „die Menschen draußen im Lande“ allemal treffen: In der verstandes- und gefühlsmäßigen Überzeugung, daß sie alle nichts anderes brauchen und verdienen als eine Nation mit einer starken Führung. Das ist es, was das Herz erwärmt.Professionelle wie amateurhafte Beobachter der Ereignisse, die des Kanzlers Rede „wenig mitreißend“, als „eine Ansammlung bekannter Kohlscher Plattheiten“, „kein bißchen kämpferisch“ (taz) und als „Showveranstaltung“ (ARD) empfinden, sollen sich mal fragen, wovon sie sich gerne mitreißen lassen würden. Die an den Tag gelegte Distanz bezeugt nämlich eher Distanzlosigkeit zum politischen Geschäft: Wer über „Führerkult“ und „Waschmittel-Werbung“ die Nase rümpft, hat an der eigentlichen Hardware der Inszenierung – Führung und Agitation für die Sache der Nation – nichts auszusetzen.