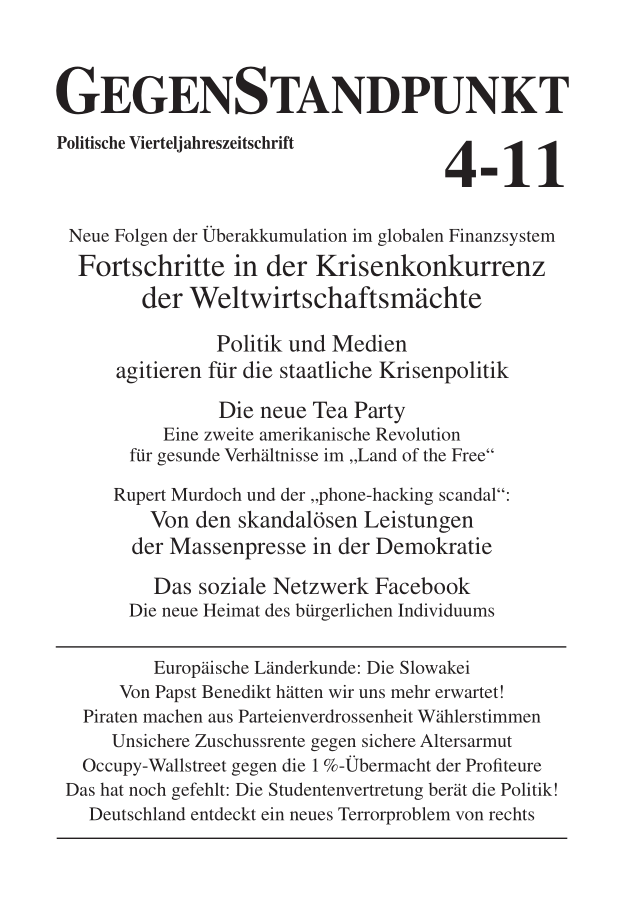Politik und Medien agitieren sich den Bürger für die staatliche Krisenpolitik zurecht
Wie das Volk geistig die Krise bewältigen soll, für die es praktisch in Haftung genommen wird
Die Völker sind dabei nur in einer Hinsicht gefragt. Sie sind die Manövriermasse dieser Krisenkonkurrenz und der für sie verordneten ‚Sparprogramme‘. In diesen Tagen lernt die Menschheit die Verarmung nicht nur als eingetretene kennen, sie kommt auf Ansage und als Anforderung der Sanierung der nationalen Bilanzen daher. Damit die Zumutungen auch geistig verkraftet werden, agitiert die Öffentlichkeit das Volk: für die Unausweichlichkeit der nationale beschlossenen Härten wegen ‚unseres Euro‘; gegen die Schuldigen vor allem im Ausland, die ihren Völkern angeblich zu viel gegönnt und über ihre Verhältnisse gelebt, statt ihr Land ordentlich als Geschäftsquelle bewirtschaftet und ihr Volk als billige Arbeitskraft mobilisiert haben... Kurz: Das Volk erhält geistige Orientierung – im Geist eines Nationalismus, der die ökonomische Durchsetzung der eigenen Nation als Sachzwang und Opfer lohnende Aufgabe versteht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- „Die Maßnahmen der Regierung sind alternativlos!“
- „Der Euro muss unbedingt gerettet werden!“
- „Die Krise hat viele Schuldige: finanzkapitalistische Zocker, unverantwortliche Staatshaushälter und – letztlich – unser aller Anspruchsdenken!“
- „Die Hauptschuld an der Euro-Krise tragen die anderen: faule Völker bringen die fleißigen und anständigen in Gefahr!“
- „Helfen müssen wir ihnen trotzdem, aus Eigeninteresse!“
- „Aber zu bestellen haben die Griechen dabei nichts. Eine Volksabstimmung – das wäre eine Katastrophe!“
- „Ohne Europa gibt es keinen Frieden!“
Politik und Medien agitieren sich
den Bürger für die staatliche Krisenpolitik
zurecht
Wie das Volk geistig die Krise
bewältigen soll, für die es praktisch in Haftung genommen
wird
Die Krise auf den Finanzmärkten hat sich zu einer Staatsschuldenkrise ausgewachsen. Die Rettungsaktionen mit gigantischen staatlichen Kreditsummen, die das Finanzgewerbe und die in Mitleidenschaft gezogene Realwirtschaft vor dem Kollaps bewahren sollten, haben sich zu einem Schuldenvolumen in den staatlichen Haushalten addiert, dem die Investoren zunehmend das Vertrauen entziehen. In die meisten Staatsanleihen investieren sie nur noch zu höheren Zinsen, bei nicht wenigen Staaten droht der Kreditentzug. Damit kündigt sich die nächste Etappe an, die den Ausgangspunkt der Krise auf einem neuen Niveau reproduziert. Entwertete Staatspapiere, Schuldenschnitte wie bei Griechenland, am Ende der komplette Zahlungsausfall eines Landes, all das beschwört eine neue Bankenkrise herauf, weil die Großen der Branche zu den wichtigsten Investoren in Staatsanleihen gehören, die mehr und mehr wertlos werden. Im Gefolge droht eine neue, weit größere Rezession, am Ende das Aus für das Geld, in dem gewirtschaftet wird. Alles steht auf dem Spiel. Die finale Frage in den Börsensälen und auf den politischen Gipfeltreffen lautet: Wer rettet die zunehmend zahlungsunfähig werdenden staatlichen Retter, die bei den geretteten Finanzakteuren ihren Kredit verlieren?
Das sind so Fragen, bei denen die Völker nur in einer Hinsicht gefragt sind: Sie sind die Manövriermasse, die für alle Wirkungen und Anforderungen geradezustehen hat, die die Verantwortlichen in Kommerz und Politik für geboten halten. Was die Wirkungen betrifft, so hat das Gros der arbeitenden Bevölkerung in den diversen europäischen Mitgliedstaaten seine Entwertung als Arbeitsmaterial auf die eine oder andere Weise längst erfahren. Im Gefolge der Krise haben die Leute auf Lohn verzichten müssen oder gleich ihren Arbeitsplatz verloren. Wer seinen Kredit nicht länger bedienen kann, verliert sein Eigenheim und bleibt auf Schulden sitzen. Wer seine Ersparnisse bei der falschen Bank wie Lehmann angelegt hat, büßt auch das ein. Und ganz am Rande erfährt man, dass die Zahl der Hungernden in den letzten drei Jahren auf der Welt um 40 Millionen gestiegen ist, weil große Finanzinvestoren mangels brauchbarer Anlagealternativen im Rohstoff- und Lebensmittelmarkt spekulieren und die Ernährung für immer mehr Menschen endgültig unerschwinglich machen.
In diesen Tagen aber, in denen die Überschuldung der Staaten Schlagzeilen macht, lernt die Menschheit die Verarmung nicht nur als eingetretene kennen, sie kommt auf Ansage und als Anforderung daher, als groß angelegte politische Strategie. Der sogenannte Sozialabbau im großen Stil, zumeist kombiniert mit Steuererhöhungen, gilt nämlich allen Euro-Staaten als Mittel der Wahl, um das Vertrauen der Finanzkapitalisten in ihre Staatsschuldpapiere wiederherzustellen. Und es geht ums Ganze, die Rettung des Euro. Deutschland brüstet sich damit, dass es bei den sozialen Abbrucharbeiten seit der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder bereits Vorbildliches geleistet hat, und zieht sich damit bei seinen Nachbarn nicht Verachtung, sondern Achtung und neidvolle Blicke zu. Aber auch das ist längst nicht genug. Das Erreichte muss gesichert und ausgebaut werden, und mit einer Schuldenbremse schreibt sich die amtierende Regierung die Fortsetzung der Rosskur gleich in die Verfassung.
So etwas muss die Manövriermasse erst einmal verkraften. Praktisch sowieso. Aber damit ein Volk auch willig tut, was es muss, wollen die auferlegten Zumutungen auch als geistig verkraftbar dargestellt sein, um Verständnis und Zuspruch zu wecken. Politik und Öffentlichkeit geben jedenfalls ihr Bestes, um den Bürger auf die geistige Orientierung festzulegen, die für die Durchsetzung staatlicher Krisenpolitik nötig ist.
„Die Maßnahmen der Regierung sind alternativlos!“
Das ist das erste, in Stein gemeißelte Argument, mit dem die Oberen dem Volk kommen. Die Botschaft ist klar: Niemand soll angesichts der rigiden Sparmaßnahmen mit Gesuchen auf Milde oder Rücksichtnahme bei Rentnern oder sozial Schwachen antreten. Denn es gibt sie nicht, die alternative Vorgehensweise, für die mancher Verbandsvertreter oder linker Sozialpolitiker werben mag. Nicht das bessere Argument reklamiert die Regierung für ihr Vorgehen, mit dem sie Alternativen als schlecht begründete abweist, sie bestreitet schlichtweg deren Existenz. Und damit ist jeder Einspruch argumentlos zur Ohnmacht verurteilt. Das Regierunghandeln vollstreckt einen Sachzwang, der gar keine Wahl lässt. So soll es die Menschheit auffassen.
Das sollten die so angesprochenen Völker einmal beim Wort nehmen. Die Genesung der Sorte Wirtschaft, die ihnen als unabweisliches Lebensmittel vorgesetzt wird, ist nur durch eine durchgreifende Verschlechterung ihrer Lebenslage zu haben, und das nicht nur vorübergehend, sondern so dauerhaft, wie die Kürzungsorgien bei Renten, Gesundheit und anderen Bereichen angelegt sind. Nicht aus bösem Willen, sondern weil das Sachgesetz unseres Wirtschaftens so etwas verlangt. Das wäre doch einmal als vernichtendes Urteil über dieses wirtschaftliche System ernst zu nehmen. Genommen werden soll es aber als Ausweis für die Notwendigkeit der Einschnitte.
Dabei hat die mit dem Argument Sachzwang verordnete Verschlechterung der Lebenslage gar nichts mit einem sachlichen Mangel zu tun, der zu einer vorübergehenden Einschränkung bei der Lebensführung zwingen würde. Finanzkrise hin oder her, keine Naturkatastrophe hat die Ernte verhagelt, kein Hektar Ackerland ging verloren, Fabriken und Maschinen für die Herstellung von Essbarem und Nützlichem sind ebenso reichlich vorhanden wie Hände, die arbeiten könnten. Alle sachlichen Voraussetzungen für eine gediegene Versorgung der Menschen liegen vor. Aber um der Geldrechnungen willen, denen der Gebrauch all dieser Faktoren in dieser Wirtschaft unterworfen ist, wird der arbeitenden Menschheit ihr Lebensstandard beschnitten, damit diese Rechnungen wieder zur Zufriedenheit ihrer großen Nutznießer aufgehen können. Die Finanzbranche verliert angesichts der aufgelaufenen Staatsschulden ihr Vertrauen in die staatlichen Papiere und verlangt neue Beweise ihrer Solidität, wenn sie den Staaten weiterhin Geld borgen soll. Europas Regierungen liefern, so gut sie können, und tun das Nötige. Sie betreiben Schuldenminderung durch Ausgabenkürzungen und Einnahmeerhöhungen, vornehmlich bei den großen Massen in ihrer Eigenschaft als Rentner, Krankenversicherter oder Verbraucher, weil das dem gleichzeitig nötigen Wachstum in der realen Wirtschaft am wenigsten wehtut oder sogar nützt. Denn das ist das zweite Kampffeld: Viel Wachstum aus möglichst billiger Arbeit, das braucht der Staat, um das Vertrauen der Finanzinvestoren zurückzugewinnen, und das brauchen die Unternehmen sowieso und immer. Finanzkapital, Realwirtschaft, Staat, drei Instanzen, eine Rechnung: Die Verarmung der Massen ist einfach notwendig, um alle Bilanzen wieder ins Lot zu bringen, in der Krise mehr denn je!
Es stimmt tatsächlich, in diesem System ist die schlechte Behandlung der arbeitenden Menschheit alternativlos; aber dieses System ist nicht alternativlos. Der Sachzwang, auf den sich berufen wird, ist ein gemachter, der von dem Regime des Geldes ausgeht, das der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt für seine Art von Wirtschaft verbindlich macht. Es ist also nur folgerichtig, wenn in zahlreichen Euro-Staaten das soziale Abbruchunternehmen mit Polizeigewalt gegen Widerstände in der Bevölkerung durchgesetzt wird. Denn der Sachzwang hat dann doch nicht den Status eines Naturgesetzes, das aus sich heraus gilt, sondern wird nur in dem Maße wirksam, wie der Staat ihn mit seinem Zwang durchsetzt.
„Der Euro muss unbedingt gerettet werden!“
Immerhin, was die Regierung macht, ist nicht nur alternativlos, sondern hat auch ein Ziel: Der Euro soll gerettet werden. Welcher Euro eigentlich, so möchte man einmal fragen. Der Euro auf der Gehaltsabrechnung eines Schichtarbeiters oder im Rentenbescheid der Alten? Oder der Euro in den Bilanzen von Betrieben, Banken und Staatshaushalt? Das Wie der Rettung gibt da näheren Aufschluss über das Was. Gerettet werden soll die famose europäische Geldeinheit nämlich dadurch, dass man Arbeitern und Rentnern möglichst viel davon bei Lohn und Pension wegnimmt, damit der Euro für das Wachstum von Betrieben, Banken und einen gesunden Staatshaushalt wieder taugt.
Das ist konsequent. Der Euro bezeichnet eben die Maßeinheit für den allgemeinen Reichtum, der kapitalistisch im Land erwirtschaftet wird, er beziffert keineswegs einen gemeinsamen Reichtum. Derselbe Euro bedeutet daher für die verschiedenen Figuren in der Wirtschaft sehr Unterschiedliches. Für die einen ist er Maßgröße und Stoff ihres Vermögens, für dessen Vermehrung sie auf die Arbeit anderer zurückgreifen, die keines haben und deswegen stets auf der Suche sind nach einem Unternehmer sind, den sie mit dem Einsatz ihrer Arbeitskraft bereichern können. Für diese anderen ist er ein äußerst bescheidenes und prekäres Mittel ihres Konsums. Ein Klassenunterschied, der sich in den Zehnerpotenzen und Nullen ausdrückt, durch die sich die Geldsummen unterscheiden, mit denen beide Seiten da wirtschaften. Was sind schon die paar Tausend Euro Lohn gegen die Milliarden-Vorschüsse kapitalkräftiger Investoren. Und kaum verdient, ist er fürs Lebensnotwendige ausgegeben und zwingt die Lohnempfänger dazu, sich erneut für die Vermehrung fremden Vermögens herzugeben – sofern man sie überhaupt lässt. Wachstum durch Ausbeutung ist das, wie auf jedem kapitalistischen Standort in jedem anderen Geld. Dieses Verfahren haben die Euro-Staaten mit ihrem Beschluss zu einer gemeinsamen Währung auf größere Füße gestellt. In einem vergrößerten Wirtschaftsraum mehr Wachstum durch immer größere Kapitale in einem einheitlichen Geld – das nutzt europäischen Global Players in der Weltmarktkonkurrenz, verschafft dem Bankkredit ein lohnendes Gefechtsfeld und dem Staat viel stabiles Geld, das dem Dollar Konkurrenz macht.
Dass die Nutznießer dieser Konstruktion sie unbedingt retten wollen, kann man verstehen. Aber sie wollen ja auch die Opfer darauf festlegen. Also argumentieren sie für ihre Sache, aber ohne dass diese überhaupt zur Sprache kommt. Die Erfolgsgeschichte des Euro, die in Umlauf gebracht wird, liest sich daher etwas anders: „Wir alle haben vom Euro profitiert!“ Nicht nur Börsen-Gurus und DAX-Vorstände mit ihren Milliardenumsätzen, auch Karrosserieschlosser mit ihrem lumpigen Salär sollen sich angesprochen fühlen. Der alberne Hinweis auf den entfallenen Geldumtausch für Touristen in Europa ist angesichts der existenziellen Bedrohung durch die Krisenlage eingeschlafen. Dafür werden die deutschen Exporterfolge zum Schlager, die ohne Euro und Euroraum nicht möglich gewesen wären und von denen doch jeder etwas hat. So wird der Arbeiter zu einer Verwechslung eingeladen, die es in sich hat. Die Exporterlöse deutscher Firmen, die er sich als Vorteil ans Revers heften soll, beziffern gar nicht seinen Ertrag, sondern den Ertrag, den diese Firmen aus ihm herausgeschlagen haben. Ein schöner Beleg sind die Beschwerden aus den europäischen Partnerländern wie Frankreich, die am deutschen Niedriglohnsektor und Billigexport leiden, weil ihre heimischen Betriebe dadurch in den Konkurs getrieben werden und das Arbeitslosenheer wächst.
Und damit niemand beim Nachzählen seiner verdienten Cent und Euro ins Grübeln kommt, wie eigentlich die zitierten Exportziffern und der Lohn des Arbeiters zusammenhängen, greift die öffentliche Propaganda gleich zu der Währung, mit der sie ihrem Arbeitsvolk schon seit langem die Lage schönrechnet. Diese Währung heißt „Arbeitsplatz“ und ist über so kleinliche Fragen längst hinaus, was der Platz eigentlich in der Währung einbringt, mit der wirklich das Lebensnotwendige bezahlt werden muss. Das Mittel des Arbeiters, überhaupt ein Einkommen verdienen zu dürfen, ist zum höchsten Zweck erklärt worden, für den Einkommensbestandteile sogar großzügig geopfert werden müssen – „Hauptsache Arbeit!“ In dieser Hinsicht, aber auch nur in dieser, soll sich das deutsche Arbeitsvolk durch den Euro-Raum bestens bedient sehen. Ohne Euro und Export gehen nämlich Millionen Arbeitsplätze verloren. Streng genommen sind nicht sie es, die sich davon machen, sondern die Konzernherren streichen sie, wenn sie an anderen Standorten bessere Absatzchancen oder billigere Arbeitskräfte wittern. Wie auch immer, der angepriesene Vorteil besteht bestenfalls in der Vermeidung eines anders gearteten Nachteils. Die Abhängigkeit des Proletariats vom Erfolg seiner Anwender ist das ganze Überzeugungsargument, das der Erpressung gleichkommt, den Erfolgsweg deutscher Firmen im Euroraum durch Arbeitsbereitschaft in nahezu jeder Form und Verzichtsbereitschaft beim Entgelt in fast jeder Größenordnung weiter mitzutragen.
„Die Krise hat viele Schuldige: finanzkapitalistische Zocker, unverantwortliche Staatshaushälter und – letztlich – unser aller Anspruchsdenken!“
Diese wunderbare Geschäftsordnung ist durch die Krise gehörig durcheinander gebracht worden. Und auch das muss ja einer arbeitenden Bevölkerung klar gemacht werden, wie es in der besten aller Welten zu so einer Entgleisung kommen konnte, die nicht wenige vor existenzielle Fragen stellt und für die sie nun in jeder Hinsicht haftbar gemacht werden.
Die Finanzkrise ist global, die Überschuldung der Staaten ebenso, die sich mit ihrer Kreditausweitung an der Rettung der Finanzbranche zu schaffen machen. Reihum entziehen Investoren staatlichen Papieren daher ihr Vertrauen und bringen ganze Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Angefangen hat es bei den vergleichsweise kleinen Peripheriestaaten des Südens. Griechenland markiert den vorläufigen Höhepunkt. Doch auch die Zahlungsfähigkeit der großen Südstaaten Spanien und Italien ist längst massiv in Zweifel gezogen. Und selbst Frankreich gehört inzwischen zu den Kandidaten, denen die Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit oder Schlimmeres droht. Wenn eine Finanzkrise so global wirkt, dass sie kaum einen Standort verschont, wenn ein notleidender Staatshaushalt wie ein fallender Dominostein den ganzen Rest der Staatengemeinde samt Bankenwelt mit in den Abgrund zu reißen droht, dann hat die Sache offenbar System. Ein System, das die vielen Dominosteine in einen ökomomischen Zusammenhang stellt, der dazu angetan ist, die Krise als allgemeines, am Ende weltweites Desaster ablaufen zu lassen. Ihrem eigenen ökonomischen Getriebe, insbesondere den großen Banken darin, hatte die Politik selbst sogar kurzzeitig das Attribut „systemisch“ zugeschrieben, um die teure kreditfinanzierte Rettung notleidender Finanzinstitute zu legitimieren. Eben nach dem Motto: Was „systemisch“ ist, darf nicht kaputtgehen, weil sonst das ganze System ruiniert ist. Von diesem sachlichen Funktionsprinzip ihrer Wirtschaft, eben ihrem systematischen Charakter, der für die Rettungsbemühungen als brauchbare Begründung herhalten durfte, will sie bei der öffentlichen Erklärung der großen Krise nichts wissen. Die Belehrung hat vielmehr die eindeutige Stoßrichtung, ökonomische Sache und Ursache zu trennen, um das famose System namens Marktwirtschaft selbst davon freizusprechen, in irgendeiner Hinsicht ursächlich zu sein für das Desaster, das sie in der Krise über die Menschheit bringt. Das pflegt den guten Glauben an ihre grundsätzliche Tauglichkeit.
Der Ersatz für die Kritik an der Sache besteht in der ausgiebigen Suche nach Schuldigen, die sich weniger an rechtlichen als an moralischen Maßstäben vergangen haben sollen. Unverantwortliche Buchführung und Gier stehen da ganz weit oben im Sündenregister. So wird die Krise verständlich, ohne das wohlwollende Verständnis für den ganzen Laden aufs Spiel zu setzen. Denn eine solche Kritik gilt nicht mehr dem ökonomischen Betrieb, sie prangert die Stellung der Akteure zu ihm an und wirft ihnen Regelverstöße und Pflichtverletzungen vor. Krise wird dadurch zur vermeidbaren Fehlentwicklung, die einem erspart bliebe, würde jeder an seinem Platz seine Pflicht und Schuldigkeit tun. Und mit dieser frohen Botschaft setzt sich die Politik gleich ins rechte Licht, weil mit bloßen Fehlern oder Pflichtverstößen Einzelner die Rezepte feststehen, die dagegen helfen. Man muss sie eben in die Pflicht nehmen, mit neuen Auflagen und Regeln, damit ein Weg aus der Krise gefunden wird und sich dergleichen künftig nicht wiederholt.
In der ersten Reihe auf der Anklagebank sitzen die Spieler des Casino-Kapitalismus.
Zocker der Finanzbranche
Übertreibung heißt ihr Vergehen, Gier der Motor. Damit steht als Prämisse fest, dass nicht das Finanzkapital, sondern sein überzogener Gebrauch durch gewisse Leute zu beanstanden ist, die den Hals nicht voll kriegen. Zu diesem Befund kommen die Sachverständigen aus den Redaktionsstuben ganz ohne langatmiges Studium der Finanzbranche. Sie verfahren umgekehrt. Dass eine Verfehlung der Grund für das Desaster sein soll, steht vor aller Befassung mit dem Gewerbe fest. Die Aufgabe besteht darin, für das Vor-Urteil das Material und die Maßstäbe passend zu konstruieren, gegen die verstoßen worden sein soll.
Also wird auch der Teil des Publikums, der noch nie einen Börsensaal von innen gesehen hat, mit kniffligen Details der Spekulation bekannt gemacht. Der Leerverkauf, am Ende noch der ungedeckte, wird plötzlich populär. Ein Geschäft, bei dem Investoren Aktien, die sie gar nicht besitzen müssen, zu einem Stichtag und zu ihrem heutigen Preis an Dritte verkaufen, um nach dem erwarteten Kursfall der Papiere diese später zu einem billigeren Preis zu erwerben. Die Preisdifferenz streicht der Investor ein. Und was soll uns das lehren? Erstens, dass so ein Geschäft in höchstem Maße unmoralisch ist, weil hier an fallenden Preisen, am Niedergang eines Marktes verdient wird. Wie sollte sich denn ein Investor gegenüber fallenden Aktienpreisen anständig verhalten? Im Wert verfallende Papiere aufkaufen, um ihren Abwärtstrend zu stoppen, und dafür sein schönes Vermögen in den Schornstein schreiben, weil der Abwärtstrend womöglich weitergeht? Das wäre wider alle ökomomische Vernunft, so wie sie hierzulande gefeiert wird. Welcher finanzkräftige Teilnehmer der Marktwirtschaft hat denn je etwas anderes im Auge als seinen Gewinn? Woraus er ihn macht, ob mit steigenden oder fallenden Preisen bei den Produkten seines Investments, ist dabei völlig egal, Hauptsache, der Gewinn stimmt. Die Förderung eines Marktes insgesamt, dem man seinen Niedergang ersparen will, das ist jedenfalls das ökonomische Handwerk keiner einzigen Figur in der ökonomischen Konkurrenz ums Geld und wäre völlig unverträglich damit. Zweitens soll mit dem Verweis auf das unmoralische Agieren von Investoren, die mit Leerverkäufen reich werden, auch noch ein gutes Stück Krise, mindestens ihre Verschärfung, erklärt sein, weil die Leerverkäufe die Aktienkurse weiter nach unten treiben, an deren Fallen verdient wird. Als müsste es den Abwärtstrend der Papiere nicht bereits geben, wenn man an ihm verdienen will.
Die Leistung solcher Ergüsse besteht darin, dem Alltagsmenschen die Krise als moralischen Fehltritt gieriger Zeitgenossen zu verdolmetschen, und zwar mit Verweis auf eine Technik der Aktienspekulation, die bis neulich als Geniestreich der „Märkte“ durch die Schlagzeilen ging. Genial, wie die Brüder es glatt schaffen, auch noch aus fallenden Märkten steigende Renditen zu erwirtschaften. Chapeau! Nach Eintritt der Krise, aber auch erst ab da, gilt dasselbe Verfahren als anrüchig bis gefährlich, und ein anderes Kriterium als der eingetretene Misserfolg liegt dafür auch gar nicht vor, obwohl so getan wird, als ob.
Was tun? Eine Finanztransaktionssteuer wird zum Beispiel empfohlen, so als könnte eine Gebühr auf die entlarvte böse Tat diese ungeschehen machen. Zumindest aber ihre Bremsung verspricht sich mancher davon. Zu hoch darf sie aber nicht sein, sonst vertreibt man Finanzinvestoren ins Ausland, die man unbedingt hier haben will. An den Pranger stellen will sie jeder, die Zocker, aus dem Spiel werfen will sie keiner. Sie erfüllen nämlich eine doppelte Funktion. Als vorgeführte Schuldige dürfen sie den gerechten Volkszorn befriedigen, der endlich weiß, wer ihm die Krise eingebrockt hat und wer nicht. Und als geläuterte, durch politische Regulierung gezähmte Investoren sollen sie den Finanzplatz und Standort voranbringen. So wird die von oben geschürte Wut auf die Hasardeure im Casino wieder eingefangen und politikkonform gemacht. Denn das ist es ja, worauf die Krisenlehre der großen Politik zielt. Durch Kredit und einige neue Regeln will sie das Finanzgewerbe wieder für den Staat nützlich machen.
Und damit findet die Kritik wie von selbst zu ihrem zweiten Adressaten. Wenn die Politik jetzt, nachdem die Krise hereingebrochen ist, eine Neuregulierung der Finanzmärkte für nötig hält, dann kommt das dem Eingeständnis gleich, dass sie es genau daran vor der Krise hat fehlen lassen. Sie ist ihrer finanzpolitischen Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen, mehr noch, sie hat den geschmähten Zockern die Lizenz für deren waghalsige Spekulationen erteilt und das Geschäftsmaterial durch eine „Politik des leichten Geldes“ gleich mitgeliefert.
Unverantwortliche Staatshaushälter
Seitdem die Schulden im Staatshaushalt in Billionen gemessen werden und das Finanzkapital sein Misstrauen gegenüber staatlichen Anleihen ausspricht, weiß jeder dank kundiger Anleitung der Medien, was falsch gelaufen ist: „Man kann einfach nicht mehr ausgeben, als man einnimmt!“ Ganz offenkundig kann der Staat sehr viel mehr ausgeben, als er einnimmt, und das sogar auf Dauer. Das zeigt ja der unaufhörlich gestiegene Schuldenberg, in dem sich die Kreditmassen addieren, die er sich bei der Finanzbranche leiht. Warum das so ist, wieso das funktioniert und für wen das gut ist, das wäre interessant zu erfahren. Das will aber keiner wissen.
Lieber vergleicht man den Staatshaushalt mit einer Kegelkasse oder einem Privathaushalt, um eine Verletzung der Fürsorgepflicht durch den politischen Kassenwart anzuprangern. So wird aus der ökonomischen Schuld des Staates auch noch eine moralische: Der staatliche Haushaltsvorstand hat unsere ideelle Gemeinschaftskasse unseriös verwaltet! Damit sitzt die Finanzpolitik moralisch wie ökonomisch auf der Sünderbank, weil sie gegen eine wirtschaftliche Vernunft verstoßen haben soll, wie sie jeder Hausfrau einleuchtet. Nichts gegen Haushaltspolitik, aber unseriöse Haushaltspolitik hat böse Folgen. Den harten und letztlich gültigen Beweis, dass sich ökonomische Unvernunft im Finanzministerium eingenistet hat, holt man sich dann natürlich nicht bei den Hausfrauen, sondern bei den Finanzkapitalisten selber ab. Die Märkte zeigen doch mit ihrem Misstrauen in den staatlichen Schuldenturm, wie unseriös da gewirtschaftet worden ist, raunt die Presse ihren Lesern zu. Ausgerechnet die gerade noch abgekanzelten Zocker der Finanzindustrie, die diesen Turm von Schulden gekauft und vermarktet haben, werden zum Richter darüber ernannt, wie eine ökonomisch vernünftige Haushaltspolitik auszusehen hätte!
Es ist schon interessant, wie die Mosaiksteine der von oben angeleiteten Kritik ineinandergreifen. Die Schelte des Finanzbranche gilt eigentlich gar nicht ihr selbst, sondern ihrer rückblickend entdeckten mangelhaften staatlichen Regulierung. Der staatlichen Finanzpolitik wird nicht ihr Werk zur Last gelegt, sondern ihre nachträglich behauptete mangelhafte ökonomische Vernunft. Keine Sphäre wird für sich einer Kritik unterzogen, sondern jede am Maßstab der anderen gemessen. Der Wunsch nach Restaurierung eines für beide Seiten gedeihlichen Miteinanders, das in der Krise Schiffbruch erlitten hat, ist darin unübersehbar und liegt der gesamten Krisenkritik von oben als Blaupause zu Grunde. Dem auf diese Weise belehrten Publikum wird das Programm von oben wie eine Forderung in den Mund gelegt. Eine staatlich regulierte Finanzökonomie und eine nach ökonomischen Kriterien gestaltete Politik samt Haushalt, das wäre doch was!
Es versteht sich also, dass die vorgetragene Politikerschelte nicht nur den Gerechtigkeitssinn des Publikums bedient, dem ein neuer Schuldiger für die aktuelle Staatsschuldenkrise präsentiert wird. Diese Kritik ist auch ganz nach dem Gusto der politischen Führer. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in ihrer einfältigen Diagnose den Weg zu einer Therapie weist, die die Politik ohnehin auf der Agenda hat. Was hat denn die Finanzpolitiker zu ihrer ökonomischen Unvernunft und einer „Politik auf Pump“ (Merkel) getrieben? Hat nicht der Staat viel zu lange einer „Vollkaskomentalität“ seiner „Wähler“ und ihrem notorischen Hang, „über ihre Verhältnisse zu leben“, fahrlässigerweise nachgegeben?
Unser aller Anspruchsdenken
Als hätte der Normalverdiener je Gelegenheit erhalten, eine Aufstockung staatlicher Schulden für seinen Lebensunterhalt zu beantragen, geschweige denn zu beschließen, wird er nun wie ein letztverantwortlicher Baustein des politischen Finanzdesasters angesprochen, dem die demokratische politische Aufsicht alles in den Rachen geworfen hat, um sich das Wohlverhalten ihrer Wählerbasis zu erkaufen. Das Anspruchsdenken im Volk, hofiert von eigensüchtigen Politikernaturen, die um Wiederwahl und Pfründe bangen, hat ins Desaster geführt. Jetzt sitzen die Demokratien auf ihrem Schuldenturm, der ihnen dank der Finanzmärkte zum Verhängnis wird. Das sind Klarstellungen in Sachen Demokratie, die dazu angetan wären, ihren guten Ruf zu untergraben: Ein Lebensmittel der Leute zu sein, das ist wohl das Letzte, wozu sich eine Demokratie hergeben darf!
So schreibt man den Angesprochenen ins Stammbuch, dass es in einer Volksherrschaft – Demokratie! – nicht darum gehen darf, dem wählenden Volk Vorteile oder eine auskömmliche Lebensführung zu bieten, damit es wenigstens einen guten Grund zum Wählen weiß. Das ist nicht nur nicht im Programm, sondern das gilt als verhängnisvoller Fehler, der sich rächt. Siehe Staatsschuldenkrise. Damit haben sich die Agitatoren in der öffentlichen Arena das passende Konstrukt geschaffen, auf das sie nun beherzt einschlagen, das unbarmherzige Anspruchsdenken kleiner Leute und Wähler. Als würde nicht jeder Wahlkampf das glatte Gegenteil bezeugen. Parteien buhlen um die Gunst der Wähler mit dem Hinweis, von jeder Art Populismus frei zu sein, den sie ihren Konkurrenten zum Vorwurf machen. Nicht die Bedienung, die Zurückweisung jeder Art von Anspruchsdenken aus dem Volk wird diesem da als bester Zustimmungsgrund für eine verantwortungsvolle Regierungspolitik geboten. Nicht einmal ohne Erfolg, wie die Wahlergebnisse zeigen.
So steht das Volk einerseits in einer Reihe mit den anderen Schuldigen des Finanzdesasters, den finanzkapitalistischen Zockern und politischen Versagern. Aber nur einerseits. Andererseits ist seine herausgehobene Stellung überdeutlich. Mit Blick auf die Staatsschuldenkrise trägt es mit seinem Anspruchsdenken nicht nur eine Mitschuld an der Krise, es ist die Wurzel des Übels, von dem die überschuldeten Staatshaushalte nur das Derivat, die abgeleitete Größe, darstellen sollen. Und deswegen gilt den öffentlichen Krisenauguren das Volk auch ganz zu Recht, wieder im Unterschied zu anderen Akteuren, als die Quelle, die mit ihrer Arbeit und ihrem Geld hergeben muss, was die anderen „Versager“ brauchen, um wieder Tritt zu fassen. Sie sind es jedenfalls nicht, die die Zeche bezahlen, die auf ihre Kappe geht. Dass der kleine Mann als Arbeitnehmer für das Wachstum herhalten muss, das „die Märkte“ brauchen, darf er dann als Wohltat an seiner zweiten, vornehmen Eigenschaft als „Steuerzahler“ verbuchen, weil er ja für den überschuldeten Staatshaushalt zu haften hat, der mit dem Wachstum wieder in Ordnung kommen soll.
„Die Hauptschuld an der Euro-Krise tragen die anderen: faule Völker bringen die fleißigen und anständigen in Gefahr!“
Nach diesem Muster verfahren alle Staaten Europas mit ihren Völkern. Der einzige Umstand, der die aktuelle deutsche Innen- und Sozialpolitik moderat im Vergleich zu den brennenden Barrikaden in Griechenland erscheinen lässt, liegt darin, dass Europas Musterland seinem Volk bereits über anderthalb Jahrzehnte Sozialleistungen und Löhne drastisch zusammengestrichen und in der Welt mit seinem Niedriglohnsektor und billigen Renten einen ökonomischen Erfolg errungen hat, der Deutschland eine Sonderstellung in Europa als stärkster Wirtschaftsmacht verschafft. Das alles ohne nennenswerten Widerstand seitens der Betroffenen.
Auf dieser Grundlage kommt die hiesige Propaganda ihrem Volk mit einer Grußadresse und einem Angebot, das auf die gehässigste Weise ausgebeutet wird. Es darf sortiert werden zwischen den staatlicherseits in Europa so schlecht behandelten Völkern. „Wir“ sind das fleißige und sparsame Volk. Glückwunsch! Die Griechen und andere Südländer aber, das sind die schlechten und faulen Völker, die an der aktuellen Krise schuld sind und „uns“ zur Last fallen und als Zahlmeister in Anspruch nehmen wollen. Was ein Ergebnis der Konkurrenz ganzer nationaler Standorte ist, die ihre jeweiligen produktiven Firmen und Banken auf dem Weltmarkt gegeneinander antreten lassen, um aneinander und gegeneinander zu verdienen, sollen sich die Völker als ihre ureigene Leistung, als ihr jeweiliges Gemeinschaftswerk zuschreiben, bei dem Fleiß oder Faulheit, guter oder schlechter Charakter über Wohl und Wehe entscheiden. So soll gedacht werden. Stimmen tut es nicht.
Was das große „Wir“ betrifft: War nicht der hauseigene Sprengel gerade noch ein Sammelsurium verschiedener bis gegensätzlicher Figuren, bestückt mit finanzkapitalistischen Zockern, die die arbeitende Menschheit mit verwegenen Finanzwetten um ihre Ersparnisse bringen, und unseriösen Finanzpolitikern, die für ihre Versäumnisse die steuerzahlenden Massen zur Kasse bitten? Spätestens der Blick nach außen macht aus diesem Dickicht konkurrierender Interessen ein großes „Wir“ von Leuten, die angeblich alle am selben Strang ziehen. Die vielen Einzelkämpfer, die als Arbeiter oder Angestellte in Abertausenden von heimischen Betrieben schaffen, haben weder einen gemeinsamen Plan noch eine gemeinsame Aufgabe, die sie bewältigen. Mit ihrem Arbeitseinsatz werden sie in einen Konkurrenzkampf ihrer jeweiligen Unternehmen am heimischen Markt verstrickt, die ebenfalls nicht daran denken, mit anderen gemeinsame Sache zu machen, weil jeder, auch auf Kosten anderer, auf seinen Gewinn aus ist. Ob oder wie viel Fleißarbeit ein werktätiger Mensch in solchen Betrieben abliefert, darüber entscheidet er in keiner Hinsicht. Maschinentakt und Stechuhr verlangen ihm ab, was die Betriebskalkulation braucht. Und nicht selten braucht sie ihn gar nicht und macht ihn arbeitslos, weil sich die Arbeit gerade für den Gewinn nicht rentiert. Was aus diesem anarchischen Verhau konkurrierender Unternehmen und Belegschaften überhaupt erst eine Größe macht, die für so etwas wie den Nachweis einer fassbaren Gemeinsamkeit taugt, das ist die nationale Aufrechnung aller Betriebsergebnisse an einem Standort zu einem Wachstum und Exportvolumen durch den Staat, am Ende alles noch übersetzt in die Güte einer Währung, die dann „unsere“ heißt.
So steht es also mit „uns“. Und was „die anderen“ betrifft: Was weiß denn der deutsche Elektroniker oder Hausmeister über Fähigkeiten und charakterliche Eigenschaften eines Müllwerkers oder Steuerbeamten aus Athen, die er als Faulenzer für die miserable Lage verantwortlich macht? Nichts, er kennt diese Figuren ja gar nicht, deren Volkscharakter er so brilliant durchschaut und brandmarkt. Er braucht sie aber auch gar nicht zu kennen, um als Arbeitnehmer und Besitzer von Euros in der Geldbörse in heftigste Gegensätze zu ihnen zu geraten. Das besorgt allein der über die nationalen Grenzen hinweg geführte Wettbewerb ihrer nationalen Wirtschaften, in denen sie als kleine Dienstleister antreten dürfen, vorausgesetzt, sie werden gerade gebraucht. Unproduktive Betriebe in Südeuropa holen einfach im Vergleich zu deutschen Exportunternehmen viel zu wenig aus ihren Belegschaften heraus. Das kostet sie Umsatz, den Standort Arbeitsplätze, die Leute ihren Lohn. Da hat der Südeuropäer seinen Gegensatz zu deutschen Kollegen, die ihm persönlich wildfremd sind: Ihr billiger Fleiß ist es, den die Unternehmen für ihre Rechnung produktiv machen und in Verkaufserfolge gegen die unterlegene südeuropäische Konkurrenz ummünzen, mit denen südländischen Arbeitern Arbeitsplatz und Einkommen bestritten wird. Die Mitglieder der verschiedenen Völkchen stehen nicht von Haus aus in einem Gegensatz, sie werden durch ihre nationalen Wirtschaftseinheiten und politischen Machtapparate in einen solchen versetzt. Und insofern sie sich als über alle Gegensätze hinweg einiges Volk begreifen und ihrer Nation die Stange halten, nicht, weil sie ihnen nützt, sondern weil es die ihre ist, sind sie zu jeder Gemeinheit gegen die Konkurrenten ihrer Nation und ihr lebendes Inventar bereit.
Die Überschuldung der Staatshaushalte gibt der Geschichte ihre eigene Pointe. Kaum darf sich der fleißige Deutsche zu Erfolgen beglückwünschen, die gar nicht er, sondern die deutsche Wirtschaft mit seinem billigen Fleiß einfährt, wird er schon mit den bösen Folgen des Triumphes konfrontiert. Die schönen Geschäftserfolge, auf die er stolz sein soll, untergraben nämlich die Geschäftsgrundlagen im europäischen Markt und produzieren Verlierer, über die die erfolgreichen Nationen gar nicht froh werden. Deutsche Exporterfolge schlagen in vielen anderen Ländern als wirtschaftliche Einbußen und Wachstumsrückgänge zu Buche, weil die heimische Industrie der deutschen Exportware einfach nicht gewachsen ist. So hat Südeuropa aus dem vielen Kredit, den es wie andere auch beim Finanzkapital genommen hat, viel zu wenig Wachstum gemacht und wird deshalb von den Finanzinvestoren abgestraft. Und um die Schuldenwirtschaft dieser Länder überhaupt halbwegs in Gang zu halten und den großen Bankrott wenigstens hinauszuschieben, sind Billionen an Stützung aus den Hauptstädten Europas nötig. Und ein weiteres Mal läuft alles auf die Doppelrolle hinaus, für die der gute Deutsche nach dem Willen seiner Elite einfach die Idealbesetzung ist: Nicht nur Fleißarbeiter für die deutsche Wirtschaft, sondern auch noch Sparschwein für den nationalen Haushalt, der zur Rettung des Euro neue Milliardenkredite mobilisieren muss.
„Helfen müssen wir ihnen trotzdem, aus Eigeninteresse!“
Der volkstümliche Imperialismus, der dem tüchtigen Volk den Erfolg gönnt und die Faulenzer und Versager abgestraft sehen will, passt auf den wirklichen Imperialismus also nur halb. Die harte Hand lassen die Gläubigernationen ihre überschuldeten kleineren Partner unbedingt spüren. Aber die nationalen Konkurrenten im europäischen Verbund sind eben nicht nur Last, sondern auch Mittel, als Markt für den Ex- und Import, vor allem aber als Basis und Baustein einer gesamteuropäischen Wirtschaftspotenz, die dem Euro das Gewicht verleiht, mit dem er seine Weltgeldkonkurrenten ausstechen will. Und in dieser Eigenschaft, als Mittel der eigenen politökonomischen Ambitionen der Großen, werden die Südländer unterstützt und so gut es geht vor dem drohenden Bankrott abgeschirmt. Einstweilen.
Den Zorn auf die faulen Südvölker, den die Verantwortlichen nach Kräften geschürt haben, lassen sie also soweit gewähren, wie er nach der harten Behandlung fremder Standorte und ihrer Insassen ruft, die ohnehin auf der Agenda des nationalen Krisenmanagements stehen. Andererseits aber hat diese Bezichtigung auch das Zeug zu einer Absage an alle Rettungsmanöver: Warum sollten die fleißigen Völker die faulen auch noch unterstützen und belohnen und dabei am Ende ihren eigenen Stand verspielen? Die Regierung hat sich zu einem berechnenden Umgang damit entschieden, zieht die geschürte Wut gegen die fremden Versager nicht aus dem Verkehr, lässt sie aber als Einwand gegen ihre Rettungsmanöver nicht gelten. Deswegen stellt sie alle Rettungsmaßnahmen unter das Motto: Wenn „wir“ heute „die anderen“ retten, dann nicht deretwegen, sondern unseretwegen! Die Rettungsschirme und Kredite verdienen nicht den Verdacht, sie würden aus dem Geist frommer Nachbarschaftshilfe oder Solidarität aufgespannt. Sie dienen pur dem nationalen Eigennutz. Und auf diese Weise angesprochen, dürfen sich die vielen kleinen Dienstleister am deutschen Wachstum dazu beglückwünschen, bei einer großen Nation mitzutun, die anderen auf der Welt sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das sollte doch für Vieles entschädigen. Das sind so Botschaften der Regierung und ihrer Sprachrohre, die zu einer europäisch-abendländischen „Wertegemeinschaft“ passen, in der es um nichts als den Wert geht.
„Aber zu bestellen haben die Griechen dabei nichts. Eine Volksabstimmung – das wäre eine Katastrophe!“
Den in Aussicht gestellten Kredit müssen sich die Südstaaten nicht nur mit härtesten Sparmaßnahmen gegen ihr eigenes Volk verdienen, sie haben in wichtigen Fragen von Wirtschaft und Haushalt ihre Souveränität abzutreten. Ein Papandreou schrumpft da in deutschen Zeitungen auf die Statur eines Schülersprechers, der zu Gipfeln „antanzen“ muss, um seine Hausaufgaben vorzulegen und von „Merkozy“ abzeichnen zu lassen. Das sollen sich die Völker Europas und ihre Führungseliten also hinter die Ohren schreiben: Für das Gros der Mitglieder gilt, dass ihre Souveränität und der Euro einfach nicht zusammengehen. Das Schicksal Griechenlands und anderer wird in Berlin, vielleicht noch Paris entschieden, aber nirgendwo sonst. Schon gar nicht in den betroffenen Ländern selbst.
Und dann das: Papandreou kündigt ein Referendum an und will die Griechen selbst entscheiden lassen, wie es mit dem Land und dem Euro weitergehen soll. Nicht, weil er die Auftragsarbeit aus Berlin und Paris hintertreiben, sondern weil er sein eigenes Volk mit einem Entscheid darauf festnageln will. Damit aber wird die längst beschlossene Agenda, die die griechische Politik umzusetzen hat, einem unerträglichen Risiko ausgesetzt. Dass der griechische Souverän dabei den eigenmächtig angepeilten, mit den Auftraggebern nicht abgesprochenen Weg als Sternstunde der Demokratie, als Volksentscheid eben, organisiert und damit bei seinen demokratischen Freunden in den europäischen Schaltzentralen der Macht auf Zustimmung zu treffen hofft, hilft ihm gar nichts. Im Gegenteil, kaum angekündigt, setzt eine harsche Belehrung der demokratisch gesinnten Menschheit in Europa über den Sinn und Zweck von Demokratie ein, die in jeder Hinsicht aufhorchen lässt.
Die Völker haben als erstes zu lernen, dass die angeblich größte Errungenschaft ihres Lebens, die Demokratie, einfach nur stört, wenn es um so wichtige Fragen wie die Rettung des europäischen Geldes geht. Jedenfalls die Demokratie in Gestalt des immer vorgestellten Ideals, dass es sich bei dieser Form von Herrschaft eigentlich um eine immerwährende Volksabstimmung handelt, bei der die Menschen ihren Vertretern ein Programm aufgeben, an das die sich zu halten hätten. Die Mehrzahl der Sachverständigen aus Politik, Presse und Wissenschaft kann nur davor warnen, dieses wunderbare Prinzip jetzt und in dieser Lage in Griechenland zum Zug kommen zu lassen. Die einen verkünden, dass die enttarnten Faulenzer aus Hellas, die noch Jahre nach dem Ableben ihrer Anverwandten deren Rentenbezüge abgreifen, so ein Schmuckstück aus dem Schatzkästlein der Demokratie einfach nicht verdient haben. Eigennutz ist keine gültige Eintrittskarte für dieses ehrwürdige demokratische Ausnahmeprozedere. Andere gehen nicht so hart mit den Griechen ins Gericht, müssen aber aus anderen, ebenfalls aufschlussreichen Gründen dringend abraten. Ein Volk, das wegen der bereits erlittenen Beschädigung seiner Interessen auf Hundertachtzig ist, hat doch nicht den kühlen Kopf für eine sachgerechte Entscheidung. Ein ganz schlecht gewählter Zeitpunkt! Dann, wenn auf Grund eines harten und landesweit ausgetragenen Interessengegensatzes zwischen Führung und Geführten ein Entscheid am nötigsten wäre, geht er am wenigsten. Da droht er nämlich aus dem Ruder zu laufen und geht am national gewünschten, daher „sachgerechten“ Ausgang womöglich vorbei. Also hat das Volk die Schnauze zu halten.
Es sei denn, die Politik schafft es, die Fragestellung des Referendums so raffiniert zu formulieren, dass den Befragten gar nichts anderes bleibt, als das verlangte Ergebnis abzuliefern. Kurzzeitig wird der Zeitungsleser mit der Kalkulation behelligt, dass die Regierung in Hellas ihr Volk vielleicht doch erfolgreich in einen Widerspruch verstricken könnte, damit es das verlangte Abstimmungsresultat ausspuckt. Angeblich sind die Hellenen ja mehrheitlich gegen die Sparmaßnahmen, aber für die Beibehaltung des Euro – so etwas geht überhaupt nicht, weil die Euro-Mächtigen beschlossen haben, dass so etwas überhaupt nicht geht. Damit säße der Grieche also in der Falle und müsste zähneknirschend sein Ja zum Euro ankreuzen, in dem das Ja zu seiner Verarmung gratis eingeschlossen ist. Der demokratische Dialog zwischen Volk und Führung ist also von einer erlesenen Hinterlist und Berechnung geprägt, damit das Volk sagt, was es soll, wenn man es schon einmal fragt.
Und darin gleichen sich beide Belehrungen. Die eine schließt ein Referendum, also das ganze Verfahren kategorisch aus, weil die Stimme des Volkes die Freiheit der Regierung zur Umsetzung ihrer Maßnahmen nur stört. Die andere kann sich mit dem Verfahren anfreunden, aber nur unter der Bedingung, dass man das Ergebnis im Vorfeld garantieren kann. Der Wille des Volkes, einmal nicht genommen in seiner einsilbigen Fassung als Wahlkreuz, mit dem er eine Führung über sich ermächtigt, ist in der Demokratie immer eine tendenziell verdächtige Größe und in Krisenzeiten, wo er besonders strapaziert wird, mit größter Vorsicht zu behandeln und unter Kontrolle zu halten.
Wieder andere, die vom Verdacht basisdemokratischen Sektierertums völlig frei sind, beziehen sich in aller Scheinheiligkeit auf das angesetzte Referendum. Sie stimmen gegenüber ihren Lesern ein hohes Lied auf die direkte Demokratie an, die ihnen bei anderer Gelegenheit wie etwa in Atomkraftfragen einfach nur verhasst war. Nicht aus einer demokratischen Läuterung heraus, sondern einfach nur deshalb, weil ihnen der Ausgang des Referendums, so wie sie ihn vermuten und sich wünschen, in den eigenen Kram passen würde: Ein Nein der Griechen zum Euro würde sich im Ergebnis exakt mit ihrer eigenen Forderung decken, die Brüder aus dem Euro raus zu werfen!
Geradliniger kommt man zum selben Resultat, wenn man den Kurs der Bild-Zeitung einschlägt und einen Volksentscheid in Deutschland verlangt. Natürlich nicht über die Kürzung von Rente oder Lohn hierzulande, sondern über den Rauswurf Griechenlands und anderer schwacher Kantonisten aus dem Euro-Raum. Das Massenblatt kann sich gut vorstellen, die Aktionen der Bundesregierung gegen die faulen Versager der Südschiene mit einer Volksabstimmung zu begleiten, die den politischen Diktaten den schönen Schein gelebter Demokratie von unten mit auf den Weg gibt. Das belebt die Völkerfreundschaft ganz ungemein.
So geht der Crash-Kurs in Sachen Demokratie seinen Gang und bereichert die Völker um neue Einsichten: Volksentscheide stören den Herrschaftsbetrieb in Europa! Und wenn man sich mit so etwas überhaupt anfreundet, dann nur unter der Bedingung, dass es dem nationalen Nutzen dient, nicht dem Stimmvieh.
*
So weit sind die Gegensätze der Nationen und die Freundschaft der Völker in Europa also gediehen. So weit, dass sie zu einer Sprengkraft für Europa und seinen Bestand zu werden drohen. Solange die Hauptmächte aber auf dieses Europa setzen, muss das Zerwürfnis zwischen den Staaten und Völkern, das sie mit ihren Krisenprogrammen auf die Spitze treiben, unter Kontrolle gehalten werden. Dafür taugt die letzte Lektion für die Völker Europas. Auch wenn sie ihre Hochzeit fürs Erste hinter sich hat, verdient sie Beachtung, weil sie unfreiwillig, aber in aller Grundsätzlichkeit Auskunft darüber erteilt, wofür das Leben der Menschheit in einer demokratischen Nation verplant und verschlissen wird.
„Ohne Europa gibt es keinen Frieden!“
Das soll er also sein, der letzte und höchste Grund, warum die Völker trotz aller Gegensätze und Widerwärtigkeiten dem vereinten Europa und seinem Geld die Treue halten sollen. Es ist schon erstaunlich, wie Staaten sich mit einem einzigen Satz als monströse Apparate zu erkennen geben: Das, wovor sie warnen, sind sie selbst! Der Krieg, den sie als Folge eines europäischen Zerfalls an die Wand malen, kann überhaupt nur als ihr Werk auf die Tagesordnung kommen. Sie sind die einzig denkbaren Täter der militärischen Auseinandersetzung, die sie dem Publikum als eine durchaus denkbare Möglichkeit in Aussicht stellen.
Ohne geeintes Europa kein Frieden, das ist zudem ein deutlicher Hinweis darauf, wie die Interessen beschaffen sein müssen, die die Nationen aktuell am besten in der Europäischen Union aufgehoben und verfolgt sehen wollen. „Entweder wir bewerkstelligen unseren ökonomischen und politischen Machtzuwachs mit und in der EU, oder die auf sich allein gestellten Nationen Europas könnten wieder den Krieg als Option ihres Kräftemessens ins Auge fassen!“ – in dieser Alternative bewegt sich das unausgesprochene Kalkül, das in der Warnung vor einem euroäpischen Zerfall und seinen Folgen unterwegs ist. Dann handelt es sich aber auch um zwei Optionen für dasselbe Ziel, dann sind die nationalen Interessen im geeinten Europa auch nicht ein harmloser Beitrag zu einem gemeinschaftlichen Werk, sondern von Gegensätzen eines Kalibers geprägt, denen man selbst die Einmündung in einen Waffengang zutraut.
Dass sich überhaupt und immer noch die Mehrzahl der europäischen Nationen zu diesem Verbund bekennt, kommt gewiss nicht daher, dass sie aus zwei Weltkriegen ihre Lektion gelernt hätten. Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass die Staaten und Völker ein für allemal ihre Feindseligkeiten und Gegensätze begraben und sich auf eine Kooperation zum wechselseitigen Vorteil verlegt hätten. Dass dem nicht so ist, beweisen ja die aktuellen Zerwürfnisse überdeutlich. Gegensätze zwischen den europäischen Nationen sind nie erloschen. In erster Instanz hatten sie zurückzutreten hinter einen weltpolitischen Gegensatz des gesamten Westens gegenüber der Sowjetunion, angeführt durch die amerikanische Supermacht und das von ihr dominierte Militärbündnis namens NATO. Da haben sich die europäischen Nationen als Mitmacher und Schutzobjekte des globalen US-Atomschirms viele bilaterale Streitigkeiten versagen müssen und sich in eine ausdrücklich so genannte Bündnisdisziplin gefügt. In zweiter Instanz dann haben die europäischen Partnerländer nationale Gründe entdeckt, ganz aus eigenem Antrieb heraus Gegensätze untereinander zu relativieren und hinter einen viel größeren Gegensatz gegenüber einem Dritten, diesmal der westlichen Führungsmacht selbst, zurückzustellen. Die gemeinsame Sache, die Europas Staaten mit ihrem Wirtschaftsraum und Gemeinschaftsgeld betreiben, will der Weltmacht und ihrem Weltgeld den Rang ablaufen. Diese Fassung aus der Gründungsakte ist durch die inzwischen eingetretene Verschiebung der weltweiten Kräfteverhältnisse dahingehend erweitert worden, dass ohne geeintes Europa und gemeinsames Geld der Untergang in der eingeläuteten Neuaufteilung der Welt zwischen Amerika und den mächtigen Aufsteigern in Asien und Südamerika wie China und Brasilien droht. Die Bündelung der europäischen Kräfte für dieses Projekt, von dem jede Nation sich einen ökonomischen und politischen Machtzuwachs verspricht, den sie auf sich allein gestellt nie zuwege brächte, hat die Gegensätze untereinander nicht zum Erliegen gebracht. Im Gegenteil, mit der aktuellen globalen Staatsschuldenkrise nehmen sie an Fahrt auf.
Der von Regierung und Öffentlichkeit geschürte deutsche Volkszorn gegen die Parasiten in den Verlierernationen der EU ist recht, so weit er sich hinter die regierungsoffiziellen Sanierungsmaßnahmen im Euro-Raum stellen lässt. Als Einwand gegen das imperialistische Erfolgsbündnis insgesamt muss er dagegen entschärft werden. Deswegen sendet die Kanzlerin dem europaskeptischen Teil ihres Volkes eine Grußadresse, die sich sehen lassen kann: Entweder, ihr lasst euch für die Rettung Europas einspannen und verarmen, oder es könnte mit dem Zerfall ein neuer Krieg drohen, in dem weit mehr von euch gefordert ist! Geld oder Leben.
Das sind sie, die Signale, die Europas Völker auf dem vorläufigen Höhepunkt der Krise zu hören kriegen.