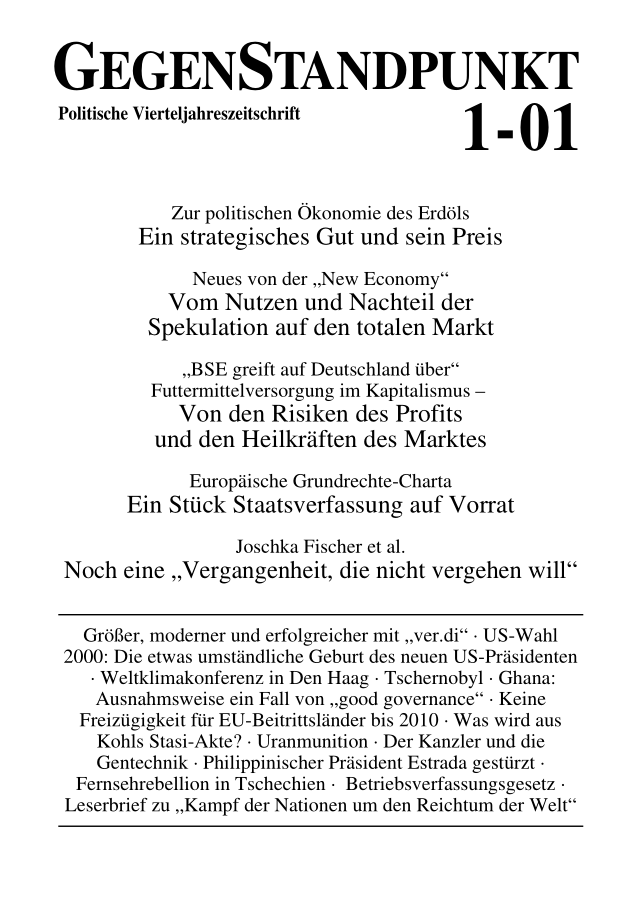Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
US-Wahl 2000:
Die etwas umständliche Geburt des neuen US-Präsidenten und die sie begleitenden demokratischen Sorgen
Die Präsidentschaftswahl gibt erstens darüber Aufschluss, worum die Kandidaten konkurrieren: die Überzeugung der Wähler als Führerpersönlichkeit, und welche Qualitäten dafür gut sind; und zweitens, was der Wähler, der stumme Lieferant einer Stimme zur Ermächtigung des Führers, für eine Figur ist. Nach der Wahl kommt diesmal noch die Suche nach dem Richter, der entscheidet, welcher Führer zu Recht die Mehrheit auf seiner Seite hat; und wie immer melden sich die Europäer mit ihrer Sorge, ob mit dem Neuen auch ihre Ansprüche aufs Weltordnen zur Geltung kommen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
US-Wahl 2000:
Die etwas umständliche Geburt des
neuen US-Präsidenten und die sie begleitenden
demokratischen Sorgen
Das war nichts für die Freunde der Demokratie und
ihren feinen Geschmack. Erst diese Kandidaten.
Unerfahren
der eine, wertkonservativ
, aber
angreifbar
, hinterlässt irgendwie immer einen
nicht gerade intelligenten Eindruck
. Der andere
zwar erfahrener, intelligenter und
professioneller
. Dafür aber immer vage
,
konturenlos
, irgendwie null Charisma
, also
ungefähr so zweitklassig
wie der Langweiler von
der Konkurrenz. Dann dieser Wahlkampf. Typisch
amerikanisch, so was von inszeniert
,
Hollywood
. Und dann noch, der Höhepunkt, dieses
Wahlergebnis und das Theater hinterher. Erst ein so
vielversprechender Wahl-Krimi
– und dann diese
matte Sache von unentschieden
! Eine Weltmacht
im Schwebezustand
! Mit einer Macht ohne
Auftrag
! Mit einer ganz dünnen
Legitimationsbasis
! Also noch mal von vorne, ein
nicht endender Wahlkampf
. Und schon wieder Kintopp:
Hollywoods Gerichtsdramen
diesmal. Amerika auf dem
Weg vom Rechtsstaat zum Rechtsanwaltsstaat
. Sie
ist am Arsch, die Weltmacht, eigentlich: In Amerika
und der demokratischen Welt lässt sich Macht mit solch
einer Hypothek eigentlich nicht ausüben.
Und dann
lässt die Macht doch noch mit sich reden. 1 Monat später
macht sich ziemlich rasch und allgemein Erleichterung
über das Ende der Ungewissheit
breit. Die
demokratische Welt gratuliert ihrem höchsten Präsidenten,
der Sturm im Wasserglas der politischen Meinungsbildung
legt sich. Viel Lärm um nichts? Nicht ganz. Auch wenn
hiesige Parteigänger eines formvollendeten Wahlverfahrens
vom Grund ihrer eigenen Aufgeregtheit nichts wissen und
auch nichts zu wissen brauchen: Neben der Befriedigung
ihres Geschmacks ist diese demokratische Wahl tatsächlich
auch in sachlicher Hinsicht eine Leistung schuldig
geblieben. Doch eines nach dem anderen.
1. Akt. Der Wahlkampf: Demokratisch ohne Fehl und Tadel
Gut möglich, dass beide Kandidaten fürs Präsidentenamt in
Washington nicht wissen, wie man Kartoffel richtig
schreibt. Das macht gar nichts. Die intellektuelle
Herausforderung eines erfolgversprechenden demokratischen
Wahlkampfs bewältigen sie auch so glänzend. Immerhin will
ja ein ganzes Volk mehrheitlich davon überzeugt werden,
dass sich vor ihm gerade der Beste für Amerika
aufstellt, und dafür wissen beide das allein Richtige zu
tun. Sie sagen es ihren Wählern, immer wieder. Sie sind
genau darüber im Bilde, was der Staat für Aufgaben hat,
und versprechen ihrem Volk, sich wirklich um nichts
anderes als um die kümmern zu wollen. Dabei legen sie
natürlich besonderen Wert auf die Botschaft, dass die
Wirtschaft und die Arbeitslosen, die Kranken und die
Neger, die Bildung, die Umwelt, die Rentner und die Moral
im Lande überhaupt bei ihnen ganz speziell gut, nämlich
viel besser als beim Konkurrenten aufgehoben sind. Und
damit sich die Bürger bei ihrer Entscheidung, wirklich
ihren Besten nach Washington zu schicken, auch nicht
vertun, helfen die Kandidaten ihnen gerne. Wie es sich im
Wahlkampf gehört, sprechen sie ihre Klientel in allem an,
wo die der Schuh drückt. Ob reich, arm, krank, alt oder
auch nur Neger: Jeder soll an sich, an seine eigenen
Interessen und Bedürfnisse denken – nur um sich einmal
vorzustellen, wie er als Reicher, Kranker, Alter oder
Neger denn Amerika gut regieren würde. Freilich: Das
wollen schon exklusiv die Kandidaten. Aber damit sie das
auch können, müssen sie ihr Volk, über dessen Bedürfnisse
und Interessen sie regieren wollen, eben von ihrer
Eignung fürs Regierungsamt überzeugen. So will es der
demokratische Brauch, und um dem zu genügen, scheuen sie
keine Mühe. Im teuersten Wahlkampf der
Menschheitsgeschichte
lassen sie in einem
Dauer-Bombardement in Presse, Funk, Fernsehen und live
keine Sorge ihrer Bürger aus, damit die sich wirklich nur
noch die eine machen: Wie sie sich mit ihrem Wahlkreuz
für Amerikas Besten entscheiden. Ersichtlich
beruht der Sieg im Wahlkampf also auch in Amerika auf
derselben Überzeugungsarbeit, die man von hier kennt.
Insofern sich deren Inhalt aber darin erschöpft, dass
einer der Kandidaten diese Entscheidung mehrheitlich für
sich verbuchen kann, hält sich auch in Amerika der dazu
nötige gedankliche Aufwand in sehr engen Grenzen. Beide
wissen nämlich gut, worauf es da letztlich ankommt: Dass
sie wahrhaft und wirklich und viel wahrhafter und
wirklicher als der Konkurrent die zum Vorstand einer
Weltmacht berufene Führerpersönlichkeit sind –
nur das, das dafür aber umso gründlicher haben sie ihren
Bürgern glaubwürdig zu vermitteln. Also Luftballons und
Marschmusik. Sie selbst laufen grundsätzlich als ‚v‘ für
victory herum, und weil echte Glaubwürdigkeit nur von
innen kommen kann, knutschen sie vor ihren kreischenden
Anhängern auch noch auf ihren Weibern. So überzeugen sie
doch recht viele davon, wie unwiderstehlich gut sie sind
und ankommen, und am Ende hat es jeder von beiden
geschafft. Vom nationalistisch angemachten Volk hat sich
die Hälfte von dem einen oder dem anderen betören lassen.
Von dieser Hälfte sieht eine Hälfte den Willen und die
Fähigkeit zum ordentlichen Regieren in dem einen, die
andere in dem anderen Kandidaten besser repräsentiert.
Auch das gehört zum demokratischen Verfahren, ist kein
größeres Problem und spaltet die Nation nicht wirklich.
Weil ja alles nur für den Wahltag und die Entscheidung
arrangiert ist, die bei dem herauskommt.
2. Akt. Die Wahl: Demokratisch astrein
So kommt es auch. Der Souverän der Demokratie tut, was
man von ihm will, und schreitet zur Tat: Er macht ein
Kreuz oder stanzt ein Loch. Das ist – verglichen mit dem
vorher betriebenen Aufwand an Überzeugungsarbeit – schon
ein recht einsilbiger Auftritt. Aber für eine Begründung
der eigenen Überzeugung oder auch für nur irgendeine Form
von Stellungnahme ist der Wahlzettel ja auch nicht
vorgesehen. Der Privatmensch waltet als Wähler seines
Amtes, hat mit seiner Stimme also nichts zu sagen,
sondern sie eben abzugeben. Alles, was er sich an
Argumenten zurechtgelegt haben und für welche seiner
Belange er sich engagieren mag, ist für den Akt völlig
bedeutungslos, zu dem man ihn in die Kabine bittet. Seine
ganze in ihm gereifte politische Überzeugung zählt genau
so viel wie die aller anderen, nämlich für sich genommen
nichts, dafür aber als 1 Stimme. So, als die kleinste
Einheit im Prozess der kollektiven Willensbildung, wird
sie mit allen anderen addiert, und mit dem
Zahlenverhältnis, das dabei herauskommt, steht fest, wer
der Beste für Amerika
ist: Der Sieger ist es. Weil
das wählende Volk in seiner Freiheit mehrheitlich
ihn und nicht den anderen zur Ausübung
der Amtsgeschäfte bestellt hat, ist er mit seiner
Mannschaft ab sofort die vom Volk beauftragte und
ermächtigte, also demokratisch legitimierte
Herrschaft
. Pünktlich zur Entscheidung, auf die für
sie alles ankommt, verlegen sich daher auch die
Kandidaten in ihrer Schauspielkunst ganz auf das Amt, das
sie bekleiden wollen. Schlagartig ist Schluss mit allen
auf die Betörung der Volksmeinung und den Rufmord des
Konkurrenten berechneten Posen, Idiotien und
Niederträchtigkeiten. Jetzt machen sie den Staatsmann in
spe, bringen ihre Wahlkampftrupps für die Siegesfeier in
Stellung und lassen sich ihre Reden schreiben. Die fangen
mit dem unfasslichen Glück und Danksagungen an alle
Helfer – und an den fairen Gegner auch – an und hören mit
God Bless America auf. Ansonsten warten sie einfach
darauf, bis das Volk die Gewalt, die von ihm ausgeht,
endlich an sie delegiert hat, damit sie die dann wirklich
ausüben können.
3. Akt. Das Ergebnis: Demokratisch, aber kein Ergebnis!
Doch dazu kommt es blöderweise nicht. Ein riesiges
Vorspiel für einen noch riesigeren Höhepunkt – und der
bleibt einfach aus. Zwei in etwa gleich gut geeignete,
überzeugende und glaubwürdige Kandidaten fürs
Präsidentenamt überzeugen ihre Landsleute in etwa gleich
gut von ihrer Eignung und Glaubwürdigkeit – und dann
schafft es keiner von ihnen ins Amt! Der ganze Aufwand
eines Wahlkampfs: das Volk über die Frage, welches
Personal an der Macht sein soll, in zwei Lager von
Anhängern zu polarisieren – umsonst. Der ganze Sinn und
Zweck des Wahlgangs: die mehrheitliche Volksmeinung den
legitimen Sieger küren zu lassen, unter dessen
Führerschaft die Nation sich wieder geschlossen vereint –
vergeigt. Und das nur, weil an entscheidender Stelle die
Stimmen zur Entscheidung einfach fehlen. Anstatt den
Kampf um die Macht im Weißen Haus
lege artis
abzuschließen, damit von dort aus wieder regiert wird,
lässt die Wahl ihn offen. Die Wahl ist gelaufen, und doch
noch nicht fertig.
4. Akt. Statt dessen schon wieder: „Kampf um die Macht“
Und schon hat Amerika und die interessierte Außenwelt Anlass, eine Gefahr fürs demokratische Gemeinwesen zu registrieren: Der Kampf um die Macht in Washington, der mit der Wahl des legitimierten neuen Amtsinhabers sein Ende gefunden hat, geht weiter, und worum es den zwei Kandidaten zusammen mit ihren Wahlvereinen immer gegangen ist, darum geht es ihnen jetzt erst recht: Weil die Wahl ihre Konkurrenz nicht abschließend entschieden hat, ziehen sie und ihre Parteien sich auf die Frontlinien des Wahlkampfs zurück – und konkurrieren auch nach dessen offiziellem Abschluss unverdrossen weiter um das Amt, das auf sie wartet. ‚Noch ist nichts verloren und alles zu gewinnen!‘, heißt ihre Parole, und das Mittel, mit dem sie alles gewinnen wollen, ist nur in zweiter Linie ihr Erfolg, den sie bei der Werbung um Stimmen vorzuweisen haben: Für sie kommt es ab sofort und in erster Linie darauf an, einen Richter zu finden, der ihnen irgendwie ihren Erfolg attestiert, nämlich im Kampf um des Volkes Stimmen gesiegt zu haben. So machen sie sich an die interessierte Interpretation der zusammengezählten, noch nicht zusammengezählten, keinesfalls mehr oder jetzt auf jeden Fall zu zählenden Wählerstimmen, und weil jeder das Interesse bemerkt, fällt das dann doch verbreitet störend auf. Wo die Konkurrenz um den Sieg per Stimmentscheid keinen legitimierten Herrscher zustandegebracht hat und sich daher die Konkurrenten um die Macht daran machen, ihre Konkurrenz selbst zu entscheiden, degradiert dies den eigens zur Legitimierung eines neuen Herrschers vorgesehenen Akt der Wahl merklich. Da hilft es auch wenig, wenn die Konkurrenten ihren Marsch vor die Gerichte nach eigenem Beteuern nur zur Ermittlung des so unklaren Wähler-Votums anstrengen. Wenn sie dazu ihre Rechtsanwälte losschicken, damit die ihre Kenntnisse über die Psychologie des menschlichen Stanzverhaltens, über stochastische Probleme bei der Umsetzung des Wählerwillens in eine Zahl, über Gerichtszuständigkeiten im Allgemeinen und in Florida im Speziellen und ähnlich sachverwandte Expertisen bei Gericht vortragen, merkt auch noch der blindeste Ami mit dem Krückstock, worum es bei dem ganzen Theater geht: Keineswegs der Wähler mit seinem Votum ist die Instanz, die den Machtkampf zu seiner definitiven Entscheidung bringt, sondern sie selbst haben vor, dies unter sich auszumachen. Wo jeder weiß, dass Richter dazu da sind, dem eigenen Interesse Recht zu verleihen, weiß nun auch jeder, dass auch die Kandidaten für das höchste Staatsamt keineswegs in Respekt vor dem Votum ihrer Wähler verharren, sondern im Recht das Instrument gefunden haben, das sie an die Macht im Staat bringen soll: Der Weg über die Gerichte ist ihr Dreh, sich den Entscheid des demokratischen Souverän so hinzumanipulieren, wo sie ihn haben wollen, und das ist nicht fürs Renommee der Herrschaftsweise, in der der Amtsträger vom Volk legitimiert und nicht von gewogenen Richtern an die Macht manipuliert wird.
Daher steht – und auch das ist nicht gut fürs Ansehen
dieser so edlen und erhabenen Herrschaftsweise – für
demokratische Gemüter dort und hier mit einem Mal fest,
dass es bloße Parteihänger sind, die sich da um das Weiße
Haus streiten und sich dazu verbittert
von einem
an den nächsten Gerichtsentscheid klammern
. Zwar
könnte man ja auch die Entdeckung machen, dass der
tiefere Sinn, der freien Wahlen und dem ganzen
komplizierten Ermächtigungsverfahren zugrunde liegt und
mit dem die Demokratie so gerne glänzt, nicht besonders
tief ist: Einen Streit um die Macht aufzumachen, um ihn
zu beenden; einen von mehreren machtversessenen Hängern
dorthin zu schicken, wo er nicht mehr nur Parteimann ist,
sondern den Staat regieren und sein Volk kommandieren
kann – dazu und zu sonst nichts geht in
der Demokratie die ganze Herrschaft vom Volk aus. Aber
den kleinen Kratzer, den die machtversessenen
Kandidaten in Amerika dem demokratischen Ethos zufügen,
bemerken Feingeister und Freunde einer vom Volk in
Auftrag gegebenen Herrschaft eben nur auf ihre Art, und
so drücken sie das, was ihnen unangenehm aufstößt, nicht
als Urteil über eine Wahrheit der Demokratie, sondern als
Verurteilung der Kontrahenten aus: Die und nicht
der in seiner ganzen Banalität offengelegte
herrschaftliche Witz dieser Staatsform wären so peinlich.
Weil die nämlich einfach nichts anderes im Kopf haben als
ihr – nun, nachdem die Schwindelmanöver des Wahlkampfs
vorbei sind: egoistisches
– Machtinteresse
.
Daher weiß einer, der Bush noch nie mochte, endlich auch,
warum: Bush ist im Wahlkampf als Versöhner angetreten,
nun spaltet er eigensüchtig die Nation
. Und aus genau
demselben Grund mag ein Kollege derselben Zeitung, der
Bush auch noch nie mochte, nun Gore nicht mehr, den er
schon immer mehr mochte als Bush: Die Rechtswege sind
nahezu erschöpft, die Geduld ist es schon lange. (…) Ein
politischer und juristischer Kleinkrämer betreibt
Inventur am Ende seiner Karriere.
Auf diese Art
hangelt man sich dann weiter zu der Frage, ob angesichts
des außerplanmäßig geführten Machtkampfs nun Republikaner
oder Demokraten keine Demokraten
mehr sind.
Experten für Demokratie machen zum wiederholten Mal die
sensationelle Entdeckung, dass das Wahlsystem in Amerika
gleich doppelt und dreifach so konzipiert ist, dass nach
einer Wahl ein Sieger auf jeden Fall
herauskommt. Aber weil diese Wahl eben nicht
augenblicklich den Sieger ausgespuckt hat,
halten sie die Sache mit den Wahlmännern für einen
eindeutigen Anachronismus
. Und nur weil eine
demokratische Wahl einmal nicht gleich und eindeutig den
Alle wieder vereinenden Schlusspunkt unter die
inszenierte Spaltung der Nation
gesetzt hat, ohne
die eine demokratische Wahlschlacht um die Macht nun
einmal nicht zu haben ist, faseln sie von Amerikas
Prüfung
und lassen gute Ratschläge vom Stapel, wie
eine Weltmacht, die auf den Mond fliegt, in Hinkunft
peinliche Pannen
dieser Art vermeiden könnte. Sie
macht so blind wie blöd, die Liebe zur Demokratie.
5. Akt. Endlich: Volkes Wille wird erhört
Aber dann wird doch alles wieder gut. Das Volk hat ihn
tatsächlich gewählt, seinen 43. Präsidenten, und
höchstrichterlich wird festgestellt, wer es ist. Ziemlich
gelitten hat der Schein, die Kandidaten und ihre Anwälte
hätten nichts anderes im Sinn, als den so uneindeutigen
Volkswillen von Gerichts wegen ermitteln zu lassen, in
dem regen Hin und Her zwischen den Instanzen ohnehin
schon – jetzt fliegt er endgültig auf. Keineswegs der
berühmte, in der Zahlenarithmetik des Wahlverfahrens zum
Vorschein gelangende „Wählerwille“, sondern die
höchste Rechtsinstanz des Landes verfügt, wer
von beiden zur Machtausübung legitimiert ist, und das ist
sehr gerecht. Die Instanz des Rechts unterbindet das
leidige Verfahren, dass das Recht in Gestalt seiner
Richter für einen der beiden Kandidaten entscheidend
Partei ergreift und ihm darüber zur Macht verhilft –
indem es in Gestalt seiner höchsten Richter ein
abschließend letztes Mal für einen Sieger Partei
nimmt und den zum legitimen Machthaber erklärt. Der
Rechtsstaat in Gestalt des Gremiums, das die über allem
partikularen Interesse stehende Souveränität des Rechts
repräsentiert, macht die Instrumentalisierung des Rechts
für das Interesse der Konkurrenten um die Macht zu seiner
Sache, um sie zu beenden. Letztinstanzlich hat in einer
Demokratie die Personalentscheidung bei der Besetzung der
Staatsämter keine Frage juristisch-taktischer Winkelzüge
der Bewerber, sondern einzig und alleine des
institutionalisierten demokratischen Verfahrens
zu sein und zu bleiben – auch und gerade dann, wenn die
Wahl als das bewährte Verfahren der Ermächtigung
ausnahmsweise die komplette Erfüllung ihres Zwecks
schuldig bleibt. Und wenn das Volk sich nicht auf die
Legitimation eines Herrschers einigen kann, erklärt eben
der Rechtsstaat selbst, wer in ihm zur Machtausübung
legitimiert ist. So bekommt das Volk von höchster Instanz
bescheinigt, worin die ganze Rolle besteht, die es als
Souverän der Demokratie spielt: Wirklich nur als
Hilfsgröße bei der routinemäßigen Auswechslung des
Herrschaftspersonals ist das Volk mit seinem Willen
vorgesehen und gefragt, denn wo der sich nicht eindeutig
für seinen politischen Herrn entscheidet, heilt der
Rechtsstaat das Versäumnis, springt mit seinem
über allen Parteiungen und Interessen stehenden
Verfahren für einen der Gewählten ein und
erklärt den zum legitimen Amtsinhaber. Damit steht zwar
abschließend und offiziell fest, dass der seine Gewalt ab
sofort demokratisch legitimiert ausübt, doch hängt es
schon auch am auserkorenen Verlierer, ob mit dem
Beschluss der Richter, dass der Kampf um die Macht in
Washington mit der Wahl sein Ende gefunden hat, der
Machtkampf nach der Wahl auch wirklich vorbei ist. Und
siehe da, er beugt sich dem Schicksal, dass das Recht
nicht ihm, sondern dem anderen gewogen ist. Weil es eben
gar nicht selbstverständlich ist, wird es ihm hoch
angerechnet, dass er sich gegen den
Parteigroll
und trotz der Enttäuschung
vieler Anhänger
zu der Verantwortung bekennt, die
Zerwürfnisse in der Nation, die er maßgeblich mit
herbeigeführt hat, jetzt, wo sie einfach keinen
politischen Sinn mehr machen, auch wieder zu heilen. Dazu
kommt es schon darauf an, dass er alle
Amerikaner und ganz besonders die
, die
ihn unterstützt haben, dazu auffordert, sich
vereint hinter unseren nächsten Präsidenten zu
stellen
. Und kaum tut er es, hat das Volk auch in
diesem Fall seine Lerneinheit hinter sich, dass die
volonté générale etwas anderes ist als die volonté de
tous.
Kleines deutsch-europäisches Nachspiel
Auch wenn der Wahlkampf in Amerika nun endgültig vorbei ist, den sie sowieso nur von Anfang an in Grund und Boden verachtet haben: In die Tour, ausschließlich aus seiner Perspektive über den Stoff zu urteilen, um den es wahlkämpfenden Politikern geht, haben sich die Meinungsbildner hierzulande so gründlich vernarrt, dass sie von ihr einfach nicht mehr loskommen. Einer, der aus seinem euro-imperialistischen Herzen einfach keine transatlantische Mördergrube mehr machen kann, hätte da gerne Folgendes nachgeschoben:
„Europa hätte Al Gore gewählt. George W. Bushs Hang zu Hinrichtungen, seine außenpolitische Unerfahrenheit und seine Amerika-zuerst-Rhetorik machen den Texaner vielen Europäern suspekt. Die neuen Herren in Washington werden (noch) forscher auftreten und ihren Supermacht-Status (noch) mehr herauskehren als ihre Vorgänger. (…) Die Zeit, als Westeuropa auf Gedeih und Verderb von den USA abhing und sich gerne unter das Kommando des großen Bruders stellte, ist aber vorbei. Die Europäer, die Deutschen zumal, sind selbstbewusster geworden. Deutlichstes Zeichen: Die EU bastelt an einer eigenen Armee und legt sich mit Washington wegen deren Unabhängigkeit an. (…) Und dennoch ist es gut, dass George Bush II. in Amerika gewonnen hat. Sein Sieg zwingt die Wirtschafts-Weltmacht EU, auch politisch enger zusammenzurücken. Die Europäer stehen vor einer doppelten Aufgabe: Sie müssen lernen, ihre Interessen ohne die USA durchzusetzen (…) Das Fernziel der EU sollte sein: Augenhöhe mit den USA, Emanzipation vom Sekundanten zum Kombattanten. Nicht um gegen, sondern um neben Amerika die Weltordnung mitzugestalten.“ (SZ, 19.12)
Nichts von dem, worüber der Mann sich so seine Sorgen
macht, hängt irgendwie davon ab, wer die
Weltmacht USA regiert. In seiner sehr grundsätzlichen
Sicht der Dinge stellt sich ihm die ganze Welt sowieso
nur als ein tendenzieller politischer Aufsichtsfall dar,
für den genau zwei Mächte exklusiv zuständig sind. Die
eine heißt Amerika, für die andere ist er einfach nur
parteilich. Und weil er das ist, bringt er auch zur
Sprache, dass es die Macht USA und vor allem ihr
Super-
ist, die einem unbefangenen Weltordnen von
Europa aus, das er gerne hätte, etwas im Wege steht. Aber
das hindert ihn überhaupt nicht daran, die Sache stur
durch die Brille des Wahlkampfberichterstatters zu
betrachten und auch noch die Konkurrenz um die
Weltherrschaft als Personalfrage aufzuwerfen:
Einen Softie hätte er sich schon lieber in den Vorstand
der lästigen Weltmacht gewählt
als einen knackigen
Henker! Sie sind schon herzig, diese Demokraten. Von
Europa aus mit einer eigenen Armee die Welt aufmischen,
neben, mit oder ohne, jedenfalls immer in Konkurrenz zu
Amerika – das ist keinesfalls suspekt
, das gehört
sich doch wohl so. Aber der Texaner
, der ist uns
vielleicht verdächtig. Insofern er jedoch mit allem, was
an ihm überhaupt nicht verdächtig, sondern so klar wie
nur etwas ist, Europa nur zusammenschweißt, hat er auch
wieder seine guten Seiten: Die Amis wählen einen
Patrioten mit Hang zum Blutrausch? Auch recht. Die Reihen
fest geschlossen, sagen wir Europäer da nur, und: Aug’
in Aug’ mit Bush
!