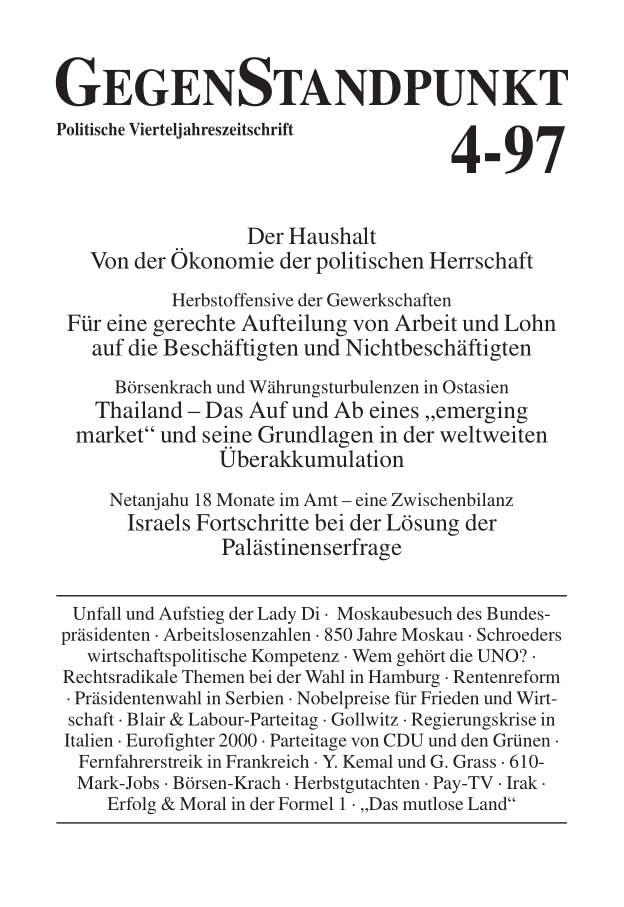Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Unfall und Aufstieg der Lady Di
Eine englische Revolution
Die Untertanenmoral rebelliert und huldigt der vom Königshaus exkommunizierten Prinzessin.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Unfall und Aufstieg der Lady Di
Eine englische Revolution
Ende August stirbt in Paris die geschiedene Frau des britischen Thronfolgers zusammen mit ihrem derzeitigen Geliebten und einem betrunkenen Chauffeur, der das Paar auf der Flucht vor „Paparazzi“ mit 190 km/h an einen Betonpfeiler fährt. Die Folge ist eine mittelprächtige Massenhysterie, die sich keineswegs auf England beschränkt, dort aber zu ungeahnten Konsequenzen führt:
„Das englische Volk hat gezeigt, daß das Königshaus seinen Bedürfnissen nicht gerecht wird.“
– so der einhellige Tenor aller sachkundigen Kommentare. Daß die Bedürfnisse, die ausnahmsweise einmal nicht zurückgewiesen werden, nicht dem Magen, sondern der Phantasie entspringen, ist offensichtlich. Welch widerlicher Art sie sind, muß einmal gesagt werden: Die niederste Untertanenmoral ist da rebellisch geworden, und an die Rebellion wird die Blumenzwiebelindustrie noch lange denken. Dennoch: Eine kleine Umwälzung hat tatsächlich stattgefunden. Die Psychologie, der große Wurmfortsatz der Moral und ihr Handwerkszeug, hat die Maßstäbe des vorzüglichen Menschentums, das Verehrung verdient, durcheinandergebracht. Eine vom Königshaus exkommunizierte Schlampe wird vom Volk rehabilitiert und wieder eingesetzt: Von so was läßt sich der Englischmann betören, der auf die Frage guter Repräsentation seinen Geschmackssinn richtet.
- Das Bedürfnis: einen würdigen Repräsentanten seines Gemeinwesens vor sich zu haben, vor dem man gerne den Hut zieht – solch perverse Neigungen sind nicht natürlich, also hergestellt. Sicher, die Untertanen legen es sich zu; aber das Bedürfnis ist zunächst einmal das Bedürfnis der Herrschaft. Repräsentation ist der Anspruch auf Anerkennung. Diesen anzumelden ist die Aufgabe eines Berufsstandes: Hofberichterstatter. Die moderne Demokratie hat dafür die freien Medien, die der Nationalmannschaft die Probleme der Herrschaft mit den eigenen und fremden Leuten erläutern. Die Aufgabe, die Sache des Regierens als ebenso nötig und gerecht wie schwierig darzustellen, ist schon der Übergang zur Forderung nach Respekt vor den Personen, die sich des großen Ganzen annehmen.
- Die Abtrennung des Amtes, das nur noch das Gemeinwesen und seinen Zusammenhalt bequatscht, halten die meisten Verfassungen für zweckmäßig. Der Grund: Die Ausübung der Herrschaft geht einfach nicht ohne Gegensätze zwischen Regierenden und Regierten ab. Die Spitze des Staates als gesonderte Repräsentation seiner Einheit mit dem Volk zu institutionalisieren, ist darauf berechnet, die unübersehbaren Gegensätze als dem Ganzen dienliche, nur der Einheit wegen fällige Verlaufsformen im Miteinander von Volk und Staat hinzustellen. Das geht und hat nur einen Haken: Es erzwingt die Kammerdienerperspektive. Die Würde des Repräsentanten wird ad personam überprüft, sein Leben an den moralischen Maßstäben gemessen.
- Der beabsichtigte Personenkult ist bei Bundespräsidenten und Königshäusern zwar insofern einfacher in Gang zu setzen, als diese Repräsentanten der Nation für nichts verantwortlich sind von dem, was die jeweilige Regierung dem Volk zumutet. Als Staatsanwälte des inneren Friedens und des Ansehens der Nation in der Welt sind diese Galionsfiguren sogar regelmäßig geneigt, Lob und Tadel ziemlich gleichmäßig auf Volk und Elite, auf arbeitende und wirtschaftstreibende Landsleute zu verteilen. Aber gerade dadurch ziehen sie sich auch ein Interesse zu, das seiner hohen Maßstäbe wegen dauernd in Kritik umschlägt. Wenn Nationalisten prüfen, ob die Repräsentanten ihre Sache gut machen, wird mancher Würdenträger schnell zum Ärgernis; ein deutscher Bundespräsident wurde seine gesamte zweite Amtszeit hindurch ausgelacht. Mangelnde Eignung ist rasch ermittelt, weil ein Recht auf Verkörperung der Werte angemeldet wird, die die Laienprediger den Leuten ans Herz legen, und eine so heikle Tugend wie die persönliche Glaubwürdigkeit auf dem Prüfstand steht. Ein befriedigendes Ergebnis wird um so mehr zum Anspruch der Untertanen, je tiefer diese der Überzeugung sind, Angehörige eines leistungsfähigen und hochanständigen Kollektivs zu sein.
- Die Kritik tritt dabei durchaus politisch auf: Ein Repräsentant, der Demokratie hochleben läßt und anmahnt, hat die ihm zustehende Achtung verspielt, wenn seine faschistische Karriere bekannt wird. Zumindest eine Güterabwägung zwischen nationalen Verdiensten und Irrwegen, Ohnmacht und Schuld etc. ist dann fällig. Auch Königshäuser sind von der historisch-vergleichenden Bewertung ihrer „Leistung“ betroffen: Sie sollten die Nation nicht auch schon bei Unternehmungen repräsentiert – und sich auch noch dazu bekannt – haben, die schief gegangen sind und heute als gemein gelten.
- Daß Kritik auf diesem Feld nichts mit einem Urteil über Politik (samt Repräsentation als Beruf) zu tun hat, sondern eine matte moralische Abrechnung darstellt, wird schnell klar: Die political correctness, die als unerläßliche Berufsqualifikation gilt, erstreckt sich auch auf ganz persönliche Betätigungen des Privatmenschen, der so ein Amtsträger auch noch ist. Als Verkünder der öffentlich anerkannten Werte hat er seinen Lebenswandel einigermaßen gottgefällig hinzukriegen. Wer Familie predigt, hat im Puff nichts verloren und bis zur goldenen Hochzeit durchzuhalten. Umgekehrt stellt sich ein Bonus für Repräsentanten allein dadurch ein, daß sie sich derselben stinknormalen Verrichtungen befleißigen wie alle anderen Leute auch. Vor dem moralischen Volksgericht, das Handlungen bewertet, geraten selbige in ihrer ganzen Banalität zum Zeugnis für die Rechtschaffenheit der Figur: Sie hat dieselben Probleme wie andere auch und bewältigt sie genauso, also untadelig.
- Das führt die Hofberichterstattung gerne vor. Krankheit und Übergewicht, Naturliebe und Häuslichkeit, Lesen und Wandern, sogar Essen und Trinken sind aus ihrer Kammerdienerperspektive ungeheuer mitteilenswert. Daß sie damit die Völker in einen gewissen Wahnsinn treiben, ist den Medien, die sich auch stolz „Meinungsmacher“ nennen, nicht nur egal, sondern ganz recht. Wenn die Ausübung des Amtes so sehr am Gelingen des privaten Lebens hängt, wie die Kammerdiener es zu sehen angehalten werden, dann ist Anteilnahme am Menschen – seinem Glück und seinem Pech, seinem Befinden und den Schwierigkeiten, mit denen er sich herumschlägt – ein unverzichtbares Stück Politisierung. Das Volk tut gut daran zu vergessen, daß der Einblick in die privaten Drangsale der politischen Prominenz nur deswegen interessant ist, weil es sich eben um zweibeinige Staatswappen dreht. Das Sich-gemein-Machen mit den alltäglichen
Kämpfen
, die die hohen Herrschaften zu bestehen haben, ist eine unschlagbare Manier der Verehrung. Und der Respekt, der sich da gegenüber der Staatsspitze aus Fleisch und Blut austobt, erstreckt sich sogar auf die Krämpfe, die sich diese Persönchen allemal leisten. Deshalb wird die Amnesie bezüglich der Quelle des Interesses, zu dem man sich als Bürger von den Medien erziehen läßt, ziemlich verwegen korrigiert: Es ist üblich, das Amt und seine „Bürde“ als eine einzige Belastung des Menschen und seines privaten Wohlergehens aufzufassen. Niemand anderem als solchen Figuren werden ihre Capricen und Marotten, sogar ihre moralischen Fehltritte auch wieder so gründlich verziehen. - Die Geschichte der Lady Di ist eine von Purzelbäumen, welche die organisierte Kammerdienerperspektive zu schlagen beliebt. Sie war personifizierter Anspruch auf Verehrung und hat sie gekriegt. Ihr Aufstieg wurde gefeiert, und ihr Glanz war Gegenstand geteilter Freude wie eines gewissen Neides. Mit ihr wurde gelitten, als ihr Leid nach allen Regeln des demokratischen Pressewesens bekannt gemacht wurde. Sie avancierte zum Opfer des Personenkults, als sie den Anforderungen des im Königshaus geltenden Protokolls nicht mehr genügte, wobei sich der Hof durchaus im Einklang wissen durfte mit dem moralischen Sensorium des englischen Volkes. Die rote Karte aber wollte sie sich nicht bieten lassen; sie hat deshalb die akkumulierte Verehrung, die ihr als schöner, leidender Mensch und Mutter zukünftiger Könige zuteil geworden war, gegen die Entthronung mobilisiert. Denn dieses öffentliche Interesse an ihr war schließlich nicht erlahmt. Mit Verweis auf die ihr entgegengebrachte Sympathie, die sie für jede Menge Patenschaften auf dem Feld der Mildtätigkeit qualifiziert hatte – mit ihrem Amt sollte das jedenfalls nie etwas zu tun gehabt haben! –, ist sie in die Offensive gegangen. Dabei konnte sie darauf setzen, daß sich niemand finden würde, der ihr bescheinigt hätte, ein Rad ab zu haben. Unwidersprochen konnte sie ihre Befähigung zum „Botschafter Englands“ damit belegen, daß sie es „mit Menschen kann“ und überall eine Abordnung der Kammerdienerpresse hinter ihr her war. Letztere Diener des Bürgers, der ein unveräußerliches Recht auf Information besitzt, haben nämlich im normalen wie im exzentrischen Haushalt von Lust und Leid der Dame nach wie vor einen heißen Geschäftsartikel behalten. Einen Geschäftsartikel, der auch für den Export über die britischen Grenzen hinaus ausgezeichnet geeignet war. Denn wenn erst einmal das Interesse am „wechselvollen Schicksal eines guten Menschen“ unterwegs ist – eine Anteilnahme, die so sehr an der Person haftet, daß der Grund für den ganzen Zirkus glatt vergessen wird –, dann werden nationale Grenzen ziemlich durchlässig.
- Das hätte alles noch ein paar Jährchen so weitergehen können: Der durchgedrehte, auf Anteilnahme am Schicksal einer prominenten Frau beruhende Personenkult im Krieg mit dem unverzichtbaren Respekt vor dem Königshaus, das auf die protokollgemäße, aber vergleichsweise „steife“ Ehrerbietung britischer Nationalisten dringt, also selbst steif ist; der offizielle Schein eines repräsentativen königlichen Familienlebens gegen den öffentlichen Augenschein einer menschlich berührenden Privatsphäre… Aber Diana mußte ja unbedingt und sofort ihren Triumph haben. Mit ihrem spektakulären Tod erringt sie bei den zahlreichen Kammerdienern, die eben auch noch als Jury dieses schwachsinnigen Wettbewerbs fungieren, den Sieg. Sie ist eindeutig der überlegene Nutznießer des Personenkults, auf den sie immer so viel Wert legte. Schuld an ihrem Tod freilich sind die Veranstalter des Personenkults, so daß sie zugleich deren Opfer ist. Deshalb halten die sich jetzt zur Mäßigung an. Da soll sich noch einer auskennen. Wäre sie doch zu Hause geblieben und hätte ein Paar Topflappen gehäkelt!
- Aber so gibt es am Ende auch noch einen überlebenden Nutznießer der Irrungen und Wirrungen im Königshaus. Die
New Labour
-Regierung macht sich zum Anwalt und Fürsprecher der Apotheose Dianas – Blairs Spruch von „the people’s princess“ gibt das Motto ab –, verhilft der Dame gegen die beabsichtigte Nichtanerkennungspolitik der Queen zu einem Staatsbegräbnis neuer Art und feiert die noch nie dagewesene allgemeine Tränen- und Blumen-Orgie als demonstrative Beglaubigung ihres nationalen Erneuerungsprogramms: Lady Di als Märtyrerin eines neuen,jungen
, postroyalistisch-sozialdemokratischen Herrschaftskults… Und was das Schönste ist: Blairs ex-königliche Ikone kann hierbei gar nichts mehr falsch machen!