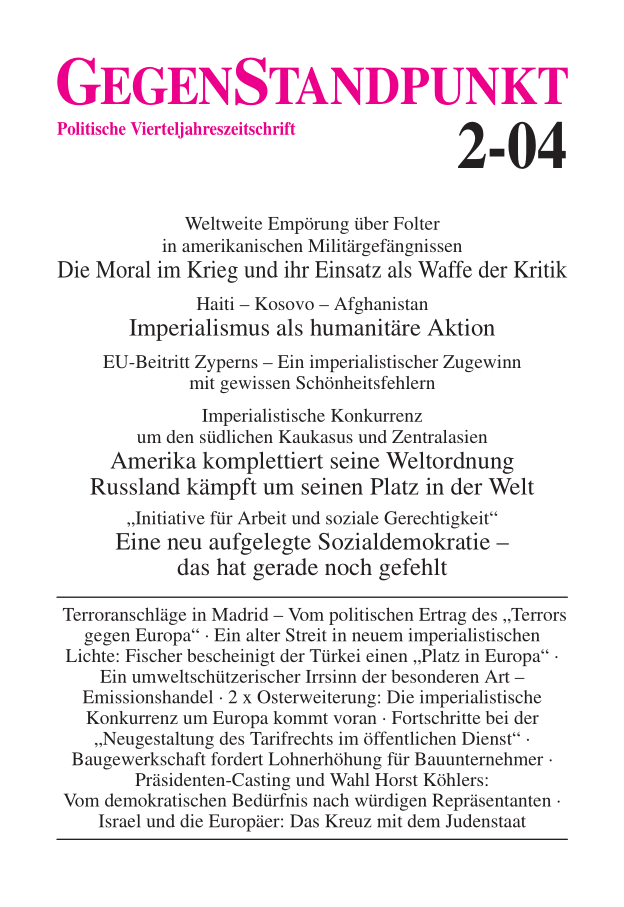Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Aus unserer Serie: Lohnsenkung – jede Woche eine gute Tat
1. Wie die „Neugestaltung des Tarifrechts im öffentlichen Dienst“ vorankommt und
2. die Baugewerkschaft Lohnerhöhung für Bauunternehmer fordert
Seit einem Jahr verhandelt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit den öffentlichen Arbeitgebern über eine tief greifende Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst. An die Stelle des „veralteten Dienstrechts“ mit seiner „hohen Regelungsdichte“ soll ein „bewegliches, zeitgemäßes Dienstrecht“ treten. Die öffentlichen Arbeitgeber wollen sich von der Gewerkschaft ein ganz neues Maß an Freiheiten im Umgang mit ihren Bediensteten genehmigen lassen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Aus unserer Serie: Lohnsenkung –
jede Woche eine gute Tat
1. Wie die „Neugestaltung des
Tarifrechts im öffentlichen Dienst“ vorankommt
Seit knapp einem Jahr verhandelt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit den öffentlichen Arbeitgebern über eine tief greifende Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst. An die Stelle des „veralteten Dienstrechts“ mit seiner „hohen Regelungsdichte“ soll ein „bewegliches, zeitgemäßes Dienstrecht“ treten – so die Gewerkschaft, die sich mit viel Verständnis für die Nöte, mit denen die Gegenseite ihren Handlungsbedarf begründet, im Tarifabschluss 2002/2003 auf „lösungsorientierte Verhandlungen“ eingelassen hat. Laut „Prozessvereinbarung“ will man in Arbeitsgruppen grundsätzlich über alle tarifvertraglich geregelten Arbeits- und Entgeltbedingungen nachdenken; die Verhandlungen sollen bis 2005 ein beschlussreifes Gesamtergebnis erbringen.
Ein weiterer Fall von Tarifverhandlungen, in denen nicht die Gewerkschaft fordernd auftritt und eine – wie auch immer bescheidene – Kompensation für die seit dem letzten Abschluss geschwundene Kaufkraft der festgesetzten Löhne und die seitdem gewachsenen Leistungsanforderungen verlangt. Einmal mehr sind es die Arbeitgeber, die Tarifverhandlungen auf die Tagesordnung setzen, um Korrekturbedarf anzumelden – über all die Korrekturen am Verhältnis von Lohn und Leistung hinaus, die sie sich zwischen den Tarifrunden sowieso schon laufend genehmigen. Auch im öffentlichen Dienst haben die Arbeitgeber in den letzten Jahren – auf Basis des „veralteten“ Dienstrechts – immer neue Wege zur besseren und kostengünstigeren Ausnutzung ihrer Dienstkräfte gefunden. Per „Vereinfachung von Abläufen“ haben sie für mehr Arbeitshetze gesorgt; durch die „Nichtbesetzung frei werdender Stellen“ haben sie Gehaltszahlungen eingespart und an den verbleibenden Arbeitsplätzen das Arbeitspensum erhöht; auf „stadtinternen Stellenmärkten“ verschieben sie unkündbare Angestellte auf neue Stellen und beschäftigen sie zu schlechteren Bedingungen weiter; mit der schöpferischen Anwendung von Eingruppierungsbestimmungen sparen sie sich manchen Lohnzuschlag und umgehen lästige Kündigungsschutzvorschriften etc. pp. Doch das langt ihnen nicht. Sie wollen sich von der Gewerkschaft ein ganz neues Maß an Freiheiten im Umgang mit ihren Bediensteten genehmigen lassen.
*
Dabei nehmen sie Maß an den Konditionen, zu denen die Arbeitgeber „in der freien Wirtschaft“ ihre Leute mittlerweile antreten lassen. Unter Verweis auf die niedrigeren Löhne, die längeren Arbeitszeiten und die schlechteren Arbeitsbedingungen, die dort gang und gäbe sind, verlangen sie vergleichbare Tarife für den öffentlichen Dienst. Zu entsprechenden „Anpassungen“ sei man wegen des Wettbewerbs gezwungen, in dem der öffentliche Dienst heute mit privaten Anbietern von Dienstleistungen stehe. In seiner Eigenschaft als Arbeitgeber beruft sich der Staat da auf einen Sachzwang, den niemand anders als er eingerichtet hat: Per politische Entscheidung hat er den Weg frei gemacht für die Privatisierung von Dienstleistungen, weil es ihn billiger kommt, Straßenreinigung, Müllentsorgung und anderes mehr von Privatfirmen erledigen zu lassen. Denen werden so neue Geschäftsfelder eröffnet, und wenn sie ihre Beschäftigten für weniger Geld und zu schlechteren Bedingungen mehr arbeiten lassen, so ist das durchaus im Sinne des Erfinders. Darauf beruht schließlich die staatliche Rechnung, durch Outsourcing den Staatshaushalt zu entlasten. Und darüber hinaus stellt sich wie von selbst ein Kollateralnutzen ein: Die im öffentlichen Dienst Beschäftigten und ihre gewerkschaftliche Vertretung werden so einem praktischen Vergleich ausgesetzt, der sie unter Druck setzt.
Auf der Grundlage werden die öffentlichen Arbeitgeber unverschämt: Wenn der private Bereicherungsgeist in Sachen Absenkung des nationalen Lohnniveaus ihre diesbezüglichen Leistungen noch in den Schatten stellt, dann haben sie ein Anrecht auf eine entsprechende Schlechterstellung ihrer Beschäftigten. Wo in Privatfirmen Arbeitszeiten von über 40 Stunden schon längst die Regel sind, da muss im öffentlichen Dienst eine „Mehrarbeit von nur 18 Minuten am Tag“ (Möllring, HAZ, 18.3.) ja wohl lässig drin sein. Wenn der Arbeitsplatz überall sonst schon unsicher ist, dann liegt doch wohl auf der Hand, dass unkündbare Stellen im öffentlichen Dienst unzeitgemäß und ein unhaltbarer Zustand sind. Und wenn es Trennungszuschläge, Vergütungspauschalen, Altersgratifikationen usw. bei privaten Unternehmern nicht gibt, dann kann es solche „Privilegien“ auch für die Staatsbediensteten nicht länger geben. Sonderzahlungen, die in den Zeiten der Vollbeschäftigung und allgemeiner tariflicher Lohnerhöhungen einmal als Nachteilsausgleich für die vergleichsweise bescheidene Grundvergütung im öffentlichen Dienst eingeführt worden sind, werden heute zur ungerechtfertigten Vorteilsnahme erklärt, die es abzuschaffen gilt. Die Lohngerechtigkeit, die einmal ein gewerkschaftliches Argument gegen die Schlechterbehandlung von Arbeitsleuten war, bekommt einen neuen Anwalt, der mit ihr Reformbedarf in der entgegengesetzten Richtung begründet. Jetzt ist es der Staat, der sich für „gleiche Löhne für alle“ stark macht und die Bezahlung seiner Bediensteten am miesesten Niveau ausrichten will.
Die politischen Dienstherren lassen es sich dabei nicht nehmen, zur Demonstration ihrer Führungsqualitäten damit zu renommieren, dass sie es sind, die die Maßstäbe setzen, unter denen in Deutschland gearbeitet wird: „Der öffentliche Dienst, so Stoiber, werde Vorreiter für eine Arbeitszeitverlängerung auch in anderen Wirtschaftsbereichen sein.“ (Die Welt, 29.3.) Sie dementieren also selber, dass die Gründe, die sie für ihren Reformbedarf anführen, mehr sind als Rechtfertigungen für ein ureigenes staatliches Interesse. Sachzwang hin, Lohngerechtigkeit her – sie wollen in Deutschland für ein niedrigeres nationales Lohnniveau sorgen. Billiglohn und Mehrarbeit sind für sie die Instrumente, mit denen sie alle nationalen Rechnungen, die krisenbedingt durcheinander gekommen sind, in Ordnung bringen und Deutschland in der Standortkonkurrenz voran bringen wollen. Und mit dieser politischen Orientierung gehen sie auch in die Verhandlungen über die Tarifreform im öffentlichen Dienst.
*
So ziemlich von Anfang an sind die Vertreter von Bund,
Ländern und Gemeinden mit dem Fortgang dieser
Verhandlungen unzufrieden. Zwar lässt die Gewerkschaft
über manches, was die Gegenseite an tarifrechtlichem
Änderungsbedarf anmeldet, mit sich reden. Beide Seiten
sind sich im Prinzip darin einig, dass sich die
Bezahlung künftig stärker an der Leistung orientieren
soll.
(FR, 2.4.) Was man
so hört, würde Verdi akzeptieren, dass sich die
Bezahlung künftig stärker an der Leistung statt am
Familienstand und Alter orientiert. Auch die Forderung
der Länder, die Unkündbarkeit älterer Beschäftigter
abzuschaffen, ist für Verdi kein Tabu.
(FR, 30.3.) Aber die auf Seiten der
Gewerkschaft vorhandene Bereitschaft zu Zugeständnissen
genügt den Arbeitgebern bei weitem nicht. Mit immer
weiter gehenden ‚Vorschlägen‘ geht die Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL) stets von Neuem in die Offensive:
„Die TdL hat nun vorgeschlagen, dass bis zu 20 Prozent des Einkommens von Leistungskriterien abhängig gemacht werden sollen… Konkret wollen die Arbeitgeber diverse Entgelt-Komponenten in Leistungszuschläge umwandeln. So sollen ältere Arbeiter und Angestellte nicht mehr automatisch mehr Geld erhalten, sondern nur noch dann, wenn ihre Tätigkeit für gut genug befunden wird. Erwogen wird auch, Zuschläge für Beschäftigte mit Kindern abzuschaffen und das Geld für Leistungsprämien zu verwenden. Zudem sollen die einzelnen Länder künftig zusammen mit den regionalen Verdi-Funktionären darüber verhandeln, wie viel Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt wird. Insgesamt müsse das neue Tarifrecht ‚finanzielle Entlastungsspielräume‘ eröffnen, fordert die TdL. Sparen könne man etwa, indem neu Eingestellten bestimmte Zulagen vorenthalten werden, heißt es bei der TdL. ‚Damit wird niemandem etwas weggenommen‘, sagte Rieger.“ (FR, 2.4.)
Und weil die Gewerkschaft bei allem Verständnis für die Sachzwänge, die „Einsparungen unabweisbar“ machen, dann doch nicht bereit ist, die geforderten „maßvollen und sozialverträglichen Kürzungen in erträglichen Schritten“, die sich nach ihren Rechnungen „locker auf bis zu 35 Prozent“ Lohnabsenkung aufsummieren, umstandslos und in vollem Umfang abzusegnen, stellen sich ihre Verhandlungspartner mehr oder minder lautstark immer wieder die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, mit so einer Gewerkschaft weiter zu verhandeln. Einzelne Bundesländer scheren aus der Tarifgemeinschaft der Arbeitgeber aus und stellen klar, dass sie auch anders können. Bereits im vergangenen Jahr haben Bund und Länder einseitig die Tarifverträge über Zuwendungen und Urlaubsgeld gekündigt und damit gegen die „Prozessvereinbarung“ mit der Gewerkschaft verstoßen, die eben vorsieht, dass auch Zuwendungen und Urlaubsgeld – wie eben grundsätzlich alle Arbeits- und Entgeltbedingungen – Gegenstand dieser Verhandlungen und einvernehmlicher Regelungen mit der Gewerkschaft sein sollen. Seitdem bekommen „alle Neueingestellten … gesenkte Sonderzahlungen, in Niedersachsen etwa nur noch 50 Prozent Weihnachtsgeld“, wie der dortige Finanzminister und Vorsitzende der TdL Möllring der Berliner Zeitung (BZ, 13.2.) berichtet. Nun hat die TdL – wiederum einseitig – zum 1. Mai dieses Jahres die tarifvertraglichen Regelungen zur Arbeitszeit gekündigt. Die Länder wollen sich nicht mehr an die vereinbarte 38,5-Stunden-Woche halten und sie schaffen auch da gleich die entsprechenden Fakten: Für ihre neu eingestellten und zur Beförderung anstehenden Dienstkräfte gilt ab sofort die 40-Stunden-Woche. In Bayern soll laut Ankündigung seines Ministerpräsidenten bei Höhergruppierungen die Wochenarbeitszeit künftig sogar auf 42 Stunden heraufgesetzt werden.
In ihrem Vorgehen machen die öffentlichen Arbeitgeber deutlich, dass sie es gar nicht nötig haben, die Gewerkschaft als Gegenmacht ernst zu nehmen und die von ihr vertretenen Interessen zu berücksichtigen. Sie bedeuten ihr, dass sie bei der Durchsetzung ihrer Belange auf die Zustimmung der Gewerkschaft nicht angewiesen sind. Wenn die TdL verlautbaren lässt, die Kündigung des Tarifvertrags über die Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst sei als „Appell an die Gewerkschaften zu mehr Beweglichkeit bei den Verhandlungen zur Reform des Tarifsystems im öffentlichen Dienst“ zu verstehen, so stellt sie damit unmissverständlich klar, dass die Gewerkschaft als Instrument zur Durchsetzung der Arbeitgeberinteressen zu funktionieren hat, wenn sie als Tarifpartner weiter ernst genommen werden will – oder sie ist mit der von ihr beanspruchten Zuständigkeit für die Regelung aller die Arbeitswelt betreffenden Belange aus dem Geschäft. Die Arbeitgeber sind sich unverschämt sicher, dass sie es mit einer Gewerkschaft zu tun haben, die dem nichts entgegensetzt. Und sie liegen damit ganz richtig.
*
Die Gewerkschaft ist empört über das Vorpreschen der Arbeitgeber:
„Das heißt im Klartext: Es geht um noch weit mehr. Es geht um den Versuch, uns zu erpressen mit dem Ziel, den umfangreichen Katalog der von den Arbeitgebern geforderten Absenkungen und Verschlechterungen tariflicher Standards zu erzwingen – nach dem Motto: länger arbeiten für weniger Geld und bei schlechteren Konditionen.“ (aus dem Tarifpolitischen Situationsbericht der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst, 2.4.)
Genau, darum geht es den Arbeitgebern in den Verhandlungen, in die die Gewerkschaft vor einem Jahr mit folgender Begründung gegangen ist:
„Ausgangslage … immer mehr Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungen … Damit steht der öffentliche Dienst mit seinem Tarifrecht in direkter Konkurrenz zu privaten Betrieben … Dabei wird das spartenspezifische Tarifrecht der in Konkurrenz stehenden Unternehmen oftmals als anpassungsfähiger an neue Bedingungen empfunden, als dies beim bestehenden Tarifrecht des öffentlichen Dienstes mit seiner Regelungsdichte möglich ist… Anpassungsdruck… Im Unterschied zum Arbeiter/innentarifrecht im öffentlichen Dienst ist es in privatwirtschaftlichen Teilbereichen in der Vergangenheit nicht gelungen, vergleichbare Bedingungen tariflich abzusichern (Entsorgungswirtschaft, Küchen- und Servicebetriebe, Gebäude- und Fahrzeugreinigung und so weiter). Die auseinander fallenden Tarifniveaus begünstigen Tarifflucht sowie Lohn- und Sozialdumping. Durch Liberalisierungsentscheidungen sind zum Beispiel kommunale Unternehmen heute gezwungen, mit privaten Anbietern um Marktanteile zu konkurrieren. Die Unterschiede in den Arbeits- und Einkommensbedingungen des öffentlichen und privaten Sektors werden dabei zu einem zentralen Moment der Konkurrenz.“ (Beschluss der Verdi-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst vom 6. Mai 2003)
Vor lauter Verständnis für die Drangsale ihrer Verhandlungspartner will die Gewerkschaft gar nicht mehr unterscheiden zwischen der Konkurrenz, der die kommunalen Unternehmen – aufgrund staatlicher „Liberalisierungsentscheidungen“ – unterliegen, und der Konkurrenz, der die öffentlichen Arbeitgeber ihre Untergebenen in erpresserischer Absicht aussetzen. Alles, was die Gegenseite betreibt, unterstellt sie als „Ausgangslage“, an der es für sie nichts zu rütteln gibt: Der Staat privatisiert; die Unternehmen im privaten Sektor sorgen für Löhne und Arbeitsbedingungen, welche die Tarife, die sie für den öffentlichen Dienst ausgehandelt hat, lässig unterbieten; die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst nutzen das per „Tarifflucht“ aus; auf der Grundlage erheben sie anschließend den Anspruch auf dieselben Dumping-Tarife in ihrem Sektor – und die Gewerkschaft quittiert das erst einmal alles. Bei der „Ausgangslage“ fällt ihr dann auch nichts anderes ein, als dass die Tarife im öffentlichen Dienst nicht mehr haltbar sind und nach unten reformiert werden müssen. Und um die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst vor der Tarifflucht der Arbeitgeber zu retten, macht sie sich zum Mit-Durchsetzer des Anpassungsdrucks, der für die Gegenseite so wohltuend als Lohnverbilligungszwang wirkt.
Der Vorwurf der Gewerkschaft an die Arbeitgeberseite, die würde die Lage unstatthafterweise zur Durchsetzung einer umfassenden Verschlechterung der Tarife ausnutzen, ist da schon ziemlich absurd. Er verweist schon sehr auf den wahren Grund ihrer Empörung. Ehrlich empört ist sie wieder einmal weniger darüber, was ihrer Klientel zugemutet werden soll, als vielmehr darüber, dass die Gegenseite diese Zumutungen an der Regelungskompetenz der Gewerkschaft vorbei durchsetzen will.
2. Baugewerkschaft fordert Lohnerhöhung für Bauunternehmer
Die Baugewerkschaft hat neue Wege gefunden, aus Arbeitslosigkeit und staatlichem Sozialabbau Gründe für Lohnverzicht und Mehrarbeit zu machen. Ausgangspunkt: Die neuen gesetzlichen Regelungen zum Arbeitslosengeld bringen die Beschäftigten im Baugewerbe in besonderer Weise in Bedrängnis:
„Bisher haben entlassene Bauarbeiter Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn sie in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens sechs Monate beschäftigt waren. Künftig werden zwölf Beschäftigungsmonate innerhalb von zwei Jahren verlangt. Dies hätte zur Folge, dass fast jeder dritte der rund 200.000 arbeitslosen Bauarbeiter nur noch in jedem zweiten Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld I hätte; in den anderen Jahren würde nur das niedrigere Arbeitslosengeld II oder, falls keine Bedürftigkeit vorliege, überhaupt keine Arbeitslosenunterstützung gezahlt“ (dieses und die folgenden Zitate aus FR, 29.4.04) –
denn den Anspruch auf Arbeitslosengeld II, das auf dem
Niveau der Sozialhilfe liegt und dessen Auszahlung an
entsprechende Bedingungen geknüpft ist, verliert der
Entlassene ganz, wenn er jenseits der Freigrenzen über
eigenes Vermögen verfügt oder die Ehefrau verdient
.
Bauarbeiter sind also nicht mehr bloß dadurch am Arsch gepackt, dass ihre reguläre Beschäftigung so aussieht, dass sie in den Wintermonaten regelmäßig entlassen werden, weil sich ihre Beschäftigung in diesen Monaten für ihren Unternehmer nicht rechnet. In den Zeiten, in denen ihr Arbeitgeber sich durch Entlassung Lohnzahlungen an sie erspart, spart nunmehr auch noch der Staat bislang fällige Unterhaltszahlungen an sie ein, indem er ihre Ersparnisse sowie die Einkünfte ihrer Frau in den Dienst seiner sozialpolitischen Fürsorgepflicht stellt und ihnen überhaupt nur mehr so viel Unterstützung zukommen lässt, wie er zum Durchfretten in Armut für unbedingt erforderlich hält.
Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen
können
, meint die Bau-Gewerkschaft und stellt
sogleich Überlegungen an, wie man den in diesen Zustand
versetzten Kollegen helfen kann, ohne die
unternehmerischen und staatlichen Rechnungen anzutasten,
denen sich dieser Zustand verdankt. Also sinnt sie auf
der Grundlage des geschäftsmäßigen Umgangs der
Bau-Unternehmer mit ihren Arbeitern nach Vorschlägen, die
sich denen als Angebote unterbreiten lassen. Und sie ist
auch glatt fündig geworden:
Einem ersten „Modell“ zufolge, könnte man dafür sorgen,
dass eine Lohnerhöhung von 2,2 Prozent … nicht an die
Arbeitnehmer ausgezahlt
wird. Sie soll statt dessen
auf ein insolvenzgeschütztes Konto fließen, das
kostenneutral bei den Sozialkassen der Bauwirtschaft in
Wiesbaden eingerichtet werden könnte. Jeweils im April
eines Jahres würde dann Bilanz gezogen und das Geld an
alle Arbeitgeber zurückgezahlt, die ihre Mitarbeiter
zwölf Monate beschäftigt haben. Der Topf werde jedes Jahr
vollständig geleert, betonte Wiesehügel: ‚Wir wollen da
keine Sparkasse machen oder eine neue Bank.‘
Falls
die Regelung Erfolg habe, ‚sind wir gerne bereit, es auch
in weiteren Jahren fortzusetzen‘, sagte der
Gewerkschaftsvorsitzende.
Die von der winterlichen Arbeitslosigkeit und von dem damit verbundenen regelmäßigen Absturz in die Sozialhilfe bedrohten Bauarbeiter wären damit ein weiteres Mal am Arsch gepackt. Sie würden nach dem Willen ihrer Gewerkschaft mit Teilen ihres Lohnes einen Motivationsfonds für beschäftigungswillige Unternehmer finanzieren – und zwar unabhängig davon, ob ihnen dieses ‚Schicksal‘ erspart bleibt; ihre Lohnerhöhung ginge auf alle Fälle in diesen Fonds. Die Unternehmer würde das zu nichts verpflichten; ihr Recht, gemäß ihren Geschäftskalkulationen zu heuern und zu feuern, bliebe unangetastet. Für sie wäre nur zu überlegen, ob es sich für sie nicht rechnet, den einen oder anderen Mitarbeiter zu behalten und dafür im April dann an der Leerung des Topfs beteiligt zu werden. Da der – unabhängig davon wie sie sich von dieser Aussicht in ihren Kalkulationen haben beeindrucken lassen – im Frühjahr jeden Jahres „vollständig geleert“ wird, würden Lohnerhöhungen künftig auf alle Fälle an sie zurückfließen. So hat die Gewerkschaft wirklich an alles gedacht, was den Arbeitgebern gegen ihre Beschäftigungsmodell einfallen könnte.
Eine zweite Brücke in den Winter könnte ihr zufolge so
ausschauen: Sie wäre für eine stärkere
Flexibilisierung der Arbeitszeiten
zu haben. Dem
sollen Arbeitszeitkonten dienen, die im Sommer gefüllt
und im Winter beansprucht werden könnten.
Logo!
Einfach mehr arbeiten in den Zeiten, in denen die
Auftragsbücher der Unternehmer voll sind und die ohnehin
gar nicht genug Mehrarbeit aus ihren Leuten herausholen
können. Dem Anspruch
– ? – ihrer Mitarbeiter, für
die Nicht-Bezahlung ihrer sommerlichen Mehrarbeit dann im
Winter eine bezahlte Anstellung zu haben, stünden
erhebliche Kostenvorteile durch die
Arbeitszeitflexibilisierung sowie den Verzicht auf
Überstundenzuschläge und auf die Verzinsung der
Arbeitszeitguthaben gegenüber.
Im Blick auf die
Unternehmer meint Gewerkschafts-Chefzyniker Wiesehügel:
Dazu nein zu sagen ist nicht ganz einfach.
Und in der Tat: Zwar können die Unternehmer mit der Idee eines ja doch irgendwie durch eine Lohnerhöhung finanzierten Kontos, an das sie nicht so ohne weiteres rankommen, nicht so viel anfangen. Aber wenn sie Arbeitszeitflexibilisierung hören, dann sind hell wach. „‚Dafür haben wir große Sympathien‘, sagte Stiepelmann.“