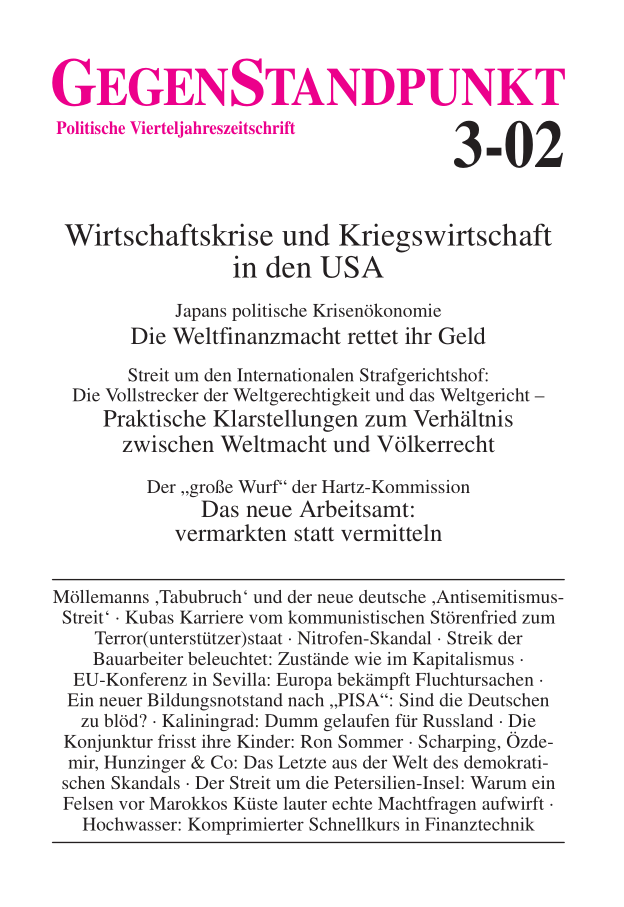Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Der Streit um die Petersilien-Insel:
Warum 13,5 Hektar Felsen vor Marokkos Küste lauter echte Machtfragen aufwerfen
Marokko erobert einen Felsen und macht so eine stärkere Berücksichtigung seiner Machtansprüche geltend. Mit der Demonstration militärischer Überlegenheit stellt Spanien dagegen klar, wer in diesem Teil der Welt die Ordnungsmacht ist. Von den EU-Partnern wird die Auseinandersetzung je nach Interessenlage beurteilt. Die USA stört der – weil von ihnen nicht genehmigte – Konflikt zweier Bündnispartner, den sie mit ihrer diplomatischen Intervention vorläufig beenden.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Gliederung
- 1. Von wegen „Absurdistan“ und „Operette“ (SZ) – Souveränitätskonflikte gehen so!
- 2. Ein Felsen als Symbol für die Selbstbehauptung einer missachteten Souveränität
- 3. Für Spanien Anlass genug, seine überlegene Macht in Stellung zu bringen
- 4. (K)ein Fall für die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik‘ Europas
- 5. Die USA ordnen den Konflikt als unerwünscht ein und ihren weltpolitischen Bedürfnissen unter
Der Streit um die Petersilien-Insel:
Warum 13,5 Hektar Felsen vor Marokkos Küste lauter echte Machtfragen aufwerfen
Ein knappes Dutzend marokkanischer Soldaten besetzt einen unbewohnten, küstennahen Felsen, der bei ihnen Leila heißt, und hisst die Flagge seines politischen Dienstherren. Eine Woche später wird die „okkupierte“ Insel, die gegenüber in Spanien Perejil (Petersilie) getauft ist, vom spanischen Militär „zurückerobert“, die gegnerische Fahne zusammen mit den gefangen genommenen Marokkanern in ihr Heimatland abgeschoben und die eigene des spanischen Königreiches montiert.
1. Von wegen „Absurdistan“ und „Operette“ (SZ) – Souveränitätskonflikte gehen so!
Der Streit um die Insel veranlasst hiesige Beobachter zu manch ironischem Kommentar. Sie prospektieren virtuell das umstrittene Gelände, vermissen jede Nützlichkeit des Objekts und mokieren sich von daher über seine kriegsmäßige Behandlung durch Marokko und Spanien. „Viel Fels und wenig Wert“, befindet Der Spiegel; wegen wilder Petersilie, die höchstens ein paar Ziegen ernährt, wird man doch weder eroberungssüchtig noch mobilisiert man dafür seine Wehrmacht! Abgesehen davon, dass sich bei einem satten Ölvorrat oder sonst einer profitträchtigen Ressource offenbar viel journalistisches Verständnis einstellen würde, geht der hier angelegte Maßstab eines geschäftstüchtigen Materialismus an der Sache, um die es geht, zielstrebig vorbei. Staaten kalkulieren schließlich anders als ihre rentabilitätsbewussten Unternehmer, und das springt gerade in der Affäre um das „wertlose“ Petersilien-Eiland ins Auge. Auch die sich kopfschüttelnd gebenden Auslandskorrespondenten wissen nur zu gut, dass es nicht um einen Felsen und seine Brauchbarkeit geht, sondern um die hoheitliche Verfügungsmacht über diese Insel – als ein Stück Territorium, das beide Nationen als das Ihre beanspruchen. Und die Behauptung von Souveränitätsrechten ist oberstes staatliches Anliegen, das sich nicht daran relativiert, ob aus dem betreffenden Landstrich ökonomisch Kapital zu schlagen ist oder nicht. Es geht insofern tatsächlich ums Prinzip – des politischen Eigentums, das die Elementarbestimmung der geographischen Reichweite einer jeden Staatsgewalt ausmacht. Der Anspruch auf exklusiven Zugriff auf ein Stück Land ist seiner Natur nach der Ausschluss anderer Staaten, also von vornherein eine Frage der Gewalt und ihrer Grenzen; wird ein und derselbe Flecken – wie in diesem Falle – von zwei Staaten beansprucht, entscheidet nicht die stichhaltigere Berufung auf einstige Verträge oder „die Geschichte“, und schon gar nicht die Unwichtigkeit des Objekts, sondern einzig und allein das Kräfteverhältnis darüber, wer Recht hat.
Dass der unvereinbare Hoheitsanspruch über die Petersilien-Insel bislang nicht zum Konflikt zwischen Marokko und Spanien geführt hat, hat seinen Grund in dem Umstand, dass beide Seiten auf die Vollstreckung ihres Eigentumstitels an dem Eiland verzichtet haben. Es war de facto herrenloses Gelände. Die Aufkündigung des bisherigen Schwebezustands durch Marokko setzt eine Konfrontation zwischen beiden Staaten auf die Tagesordnung. Was für die marokkanische Regierung das Geltendmachen ihres staatlichen Rechtsmonopols ist, erfüllt für die spanische den Tatbestand einer „widerrechtlichen Besetzung“ spanischen Territoriums und damit eines nicht hinnehmbaren „Angriffs“ auf die Nation. Der steht damit das „Recht auf Selbstverteidigung“ zu, womit die praktische Wiederherstellung des Rechts, sprich: die „Vertreibung der Besatzer“ beschlossen ist. Dass ein Land vom Rang Spaniens eine Verletzung seines Hoheitsanspruchs nicht dulden kann, leuchtet jedem kopfschüttelnden Berichterstatter hierzulande dann doch wieder irgendwie ein; als Patriot hält auch er es selbstverständlich für geboten, jeden Quadratzentimeter Heimaterde zu verteidigen, jedenfalls wenn’s um die „eigene“ geht.
Deutlich wird am Fall dieser winzigen Insel, wo der pure Hoheitsanspruch getrennt von jedem ökonomischen und strategischen Interesse reklamiert und exekutiert wird, der Fanatismus der Souveränität, dem Staaten – gleich welchen Kalibers – frönen. Die Anerkennung der eigenen Souveränität zu genießen, d.h. zu erzwingen, ist nämlich nicht das Gegenteil von nationalem Materialismus, sondern die Grundlage und der Gradmesser für die erpresserische Macht, die ein Staat im Verkehr mit seinesgleichen in die Waagschale werfen kann. Hier entscheidet sich, ob und in welchem Umfang die alltäglichen inter-nationalen politischen und Geschäftsbeziehungen zu eigenen Gunsten zu gestalten sind.
Dass auch der angeblich so überflüssige Streit um die nutzlose Petersilien-Insel von einer politischen Grundsatzaffäre zwischen Marokko und Spanien handelt, ist den auswärtigen Betrachtern im Übrigen nicht entgangen. Mit den Beziehungen zwischen beiden Staaten steht es nämlich nicht zum Besten. Fragt sich nur, warum sie sich dann ausgerechnet um das Hoheitsrecht über den Felsen schlagen, der sie Jahrzehnte lang nicht weiter interessiert hat.
2. Ein Felsen als Symbol für die Selbstbehauptung einer missachteten Souveränität
Die Unzufriedenheit des bis 1956 spanischen Protektorats Marokko mit der Behandlung, die das Land durch das heutige EU-Mitglied Spanien erfährt, hat sich in letzter Zeit kräftig gesteigert. Regierung samt König wehren sich gegen eine systematische Drangsalierung und Bevormundung aus Madrid. Dabei geht es nicht nur um die Schädigung elementarer staatlicher Interessen, sondern vor allem um die Vorenthaltung von – im Unterschied zum Eiland Leila – sehr substanziellen territorialen Souveränitätsrechten, deren Eroberung Marokko sich im Zuge seines Staatsgründungsprogramms vorgenommen und als Erfordernis einer längst überfälligen „Entkolonialisierung“ auf die Fahnen geschrieben hat. Die aktuelle Beschwerde-Liste umfasst u.a. folgende Punkte:
- das „unerfüllbare“ spanische Verlangen, gefälligst jedem Afrikaner den Zugang zum Mittelmeer zu versperren, damit er nicht, sofern er dem Tod durch Ertrinken entgeht, als ungebetener Gast in Spanien auftaucht und dort der Polizei und dem Staatshaushalt zur Last fällt;
- den schikanösen Umgang der spanischen Behörden und Unternehmer mit marokkanischen Flüchtlingen und Landarbeitern, die „unter Konditionen der Sklaverei“ gehalten werden;
- die fortgesetzten spanisch-europäischen Erpressungsmanöver in Sachen Fischereirechte, auf dass Marokko sich seine Hoheitsgewässer gegen eine geringe Lizenzgebühr leer fischen lässt;
- den Waren-Schmuggel über die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, mit dem sich spanische Geschäftemacher „jährlich um 4 bis 5 Milliarden Euro bereichern“ und das Steuerzahlen umgehen;
- die Weigerung Spaniens, Marokko die per Krieg faktisch durchgesetzte Herrschaft über die ehemalige spanische Kolonie West-Sahara zuzubilligen: Spanien erkennt die „Annexion“ der Wüste und ihrer Bewohner nicht an, bestreitet insofern den Hoheitsanspruch Rabats;
- die kategorische Weigerung Spaniens, „die Ära des Kolonialismus endgültig zu beenden“ und über die von Rabat geforderte Abtretung der Küstenstädte Ceuta und Melilla, die Marokko für sich reklamiert, auch nur zu verhandeln.
Marokko übersetzt – wie Staaten dies üblicherweise tun – die Tatsache, dass Spanien seine Interessen auf Kosten der marokkanischen durchsetzt und sich dabei auch über die Gebietsansprüche des nordafrikanischen Staats locker hinwegsetzt, in das allgemeine Fehlen von Respekt vor der eigenen Souveränität. Die Beschwerden über die „kolonialistische Arroganz“, die im vorigen Jahr bis zur Rückholung des Botschafters aus Madrid führten, zeitigen keine Wirkung. Um die Anerkennung der geltend gemachten „berechtigten Anliegen“ zu erzwingen, mangelt es dem Wüstenstaat an Mitteln – und deshalb auch an dem Willen, Spanien eine echte feindselige Konfrontation zu eröffnen. Die „Eroberung“ – ausgerechnet – des zwar ebenfalls hoheitlich umstrittenen, aber für beide Seiten materiell bedeutungslosen Eilands „Leila“ ist demzufolge nicht mehr und nicht weniger als ein demonstrativer politischer Souveränitäts-Akt, der vor allem von der Ohnmacht seines Veranstalters zeugt.
Das Flagge-Zeigen auf dem Petersilienfelsen, der – just am Tag der Königshochzeit – als Symbol des eigenen Souveränitätswillens auserkoren wird, ist eine wohl berechnete Provokation des spanischen Staates. Mit ihr protestiert Marokko gegen die ihm diktierte Rolle als purer „Befehlsempfänger“, also gegen die ihm abverlangte Unterwerfung unter die strategischen und ökonomischen Bedürfnisse Marke Spanien und EU, der es zugleich nicht auskommt. (Hämisch verweisen Spaniens Berichterstatter darauf, dass die Hauptdevisenquelle des Landes in den Überweisungen der in Spanien verdingten Lohnsklaven besteht!) Gemeint ist dieser Protest als dringlicher diplomatischer Antrag. Was der Außenminister gleich noch entsprechend erläutert, um Missverständnisse zu vermeiden: So soll die Insel-Expedition von ein paar Soldaten mit Fahne nicht unbedingt der Einrichtung eines „dauerhaften Postens“ dienen; vielmehr solle der Konflikt dazu „anstoßen“, „alle anhängigen Fragen zu lösen“:
„Die Regierung seiner Majestät wünscht weiterhin, dass die spanisch-marokkanischen Beziehungen sich auf einer gesunden, konstruktiven und von wechselseitigem Respekt bestimmten Grundlage entwickeln können.“ (El País, 15.7.02)
Und auch wenn es sich bei der politischen Rechtfertigung der Inselbesetzung – es gehe lediglich um „einen Kontrollposten, um den Terrorismus und die illegale Immigration in der Meerenge von Gibraltar zu bekämpfen“, wie Spanien es immer verlange (ebd.), um eine durchsichtige Heuchelei handelt, drückt sie doch allemal die Wahrheit aus, dass die Regenten Marokkos eine Zurückweisung der spanischen-europäischen Aufträge gar nicht beabsichtigen. Was sie allerdings erwarten, das ist ein größerer Lohn für ihre Bereitschaft, sich und ihr Land dienstbar zu machen für die ambitionierte Geschäfts-Ordnung der Europäischen Union.
Die Berechnung Marokkos, durch eine bewusst gering dosierte Verletzung spanischer Souveränitätsansprüche mit Nachdruck eine „konstruktive Entwicklung der bilateralen Beziehungen“ anzumahnen, geht nicht auf. Seine Majestät und die Regierung in Rabat müssen im Gegenteil zur Kenntnis nehmen, dass die spanischen Staatsführer die Aktion nicht als Einladung zu einvernehmlicheren „Lösungen der anstehenden Probleme“ verstehen, sondern als „Okkupation spanischen Territoriums“ definieren und dementsprechend als Gewaltfrage behandeln, die mit kriegerischen Mitteln „gelöst“ gehört.
3. Für Spanien Anlass genug, seine überlegene Macht in Stellung zu bringen
Natürlich übersieht die spanische Regierung nicht die symbolisch-diplomatische Bedeutung, auf die das Hissen der marokkanischen Fahne auf der „Isla Perejil“ berechnet ist. Das hindert sie aber überhaupt nicht daran, in dieser ‚Methode‘ Marokkos, eine Änderung der spanischen Politik anzumahnen, vor allem ein Symbol des Auflehnungswillens und damit eine einzige Souveränitäts-Anmaßung zu sehen, die diesem Land beim besten Willen nicht zusteht. Von ihm ist „Freundschaft“ verlangt, d.h. bedingungslose Unterordnung. Der Verstoß gegen dieses Gebot erfüllt deshalb für Spanien den Tatbestand einer „Aggression“. Das ist der Maßstab, dem die Antwort Madrids genügen soll und muss. Und dieser Maßstab hat seinen Grund nicht in einer ehrpusseligen Überempfindlichkeit und einem daraus gespeisten Missverständnis der von Marokko – gar nicht – ausgehenden „Bedrohung“, wie es die hiesigen Spanienkenner vermuten. Sondern darin, dass der spanische Staat sich – gerade kraft seiner Überlegenheit – als empor strebendes EU-Mitglied, als Mittelmeer-Anrainer und als Ex-Kolonialmacht befugt und berufen sieht, das „Entwicklungsland“ Marokko wie die anderen Staaten der afrikanischen Gegenküste auf den Status stabiler und nützlicher Ressourcen- und Armutsverwalter festzulegen. Und in dieser Hinsicht ist Spanien – spiegelbildlich zum Königshaus in Rabat – zunehmend ungehalten über die in seinen Augen mangelhafte Aufgabenerfüllung Marokkos.
Insofern kommt die „Aggression“ Marokkos der spanischen Regierung gerade recht, um diesem Staat eine Lektion zu erteilen. Erklärter Zweck ist es, klar zu machen, das jeder Versuch, Spanien vor „vollendete Tatsachen“ zu stellen, von vornherein zur Aussichtslosigkeit verurteilt ist; dass also eigenmächtige Korrekturen am „Status quo“, also am Kräfteverhältnis, keine Chance auf Bestand haben. Dieses Beweisziel verlangt die umgehende Revision jener „Tatsachen“ und damit die Klarstellung, dass Spanien es ist, das die maßgeblichen Fakten setzt – und seine Interessen durchsetzt. Folglich geht es darum, die Ohnmacht Marokkos vorzuführen und die Überlegenheit der eigenen Macht in der Region zu etablieren.
- Eine diplomatische Bereinigung der Affäre, also das Aushandeln eines freiwilligen Rückzugs der Marokkaner von der Petersilien-Insel samt Eröffnung von Verhandlungen über die vorhandenen Interessensgegensätze, kommt von daher nicht in Frage. Damit würde der Schein eines Verhältnisses von Gleich zu Gleich erzeugt und das „provokative“ Vorgehen Rabats auch noch belohnt – wo doch alles vermieden werden muss, was „als ein Zeichen der Schwäche Spaniens ausgelegt werden kann und Marokko zu durchaus vorhersehbaren weiteren Provokationen ermuntern könnte“. (El País, 20.7.)
- Die Inselbesetzung muss einseitig, also gewaltsam erledigt werden. Trotz der laut marokkanischem Außenminister „in der Nacht bereits fertigen, von US-Außenminister Powell vermittelten Einigung“ beider Seiten auf das Fortbestehen der faktischen Neutralität der Petersilien-Insel schlägt die Eliteeinheit der Spanier im Morgengrauen zu.
- Die Demonstration der eigenen Macht muss, im Unterschied zur marokkanischen Veranstaltung, in einer wirklichen militärischen Demonstration bestehen, die dem verfolgten Ideal einer mediterranen Ordnungsmacht die nötige Glaubwürdigkeit verleiht. Deshalb der „Aufmarsch der Armada“, der insofern, nämlich im Verhältnis zum politischen Zweck, keineswegs „unverhältnismäßig“ ist. Anders gesagt, die Unverhältnismäßigkeit der spanischen „Reaktion“ ist gerade die Botschaft, auf die es ankommt!
- Die glanzvolle Repatriierung des besetzten Eilands allein genügt nicht. Im Sinne bleibender Abschreckung muss militärische Präsenz gewährleistet sein. „Zum Schutz von Ceuta und Melilla“ wird die Anzahl der Kriegsschiffe vor der marokkanischen Küste aufgestockt, und die Garnisonen in den beiden Enklaven werden verstärkt.
Auf Basis des neu etablierten Kräfteverhältnisses bietet Spanien dem renitenten Partner Verhandlungen zur „Verbesserung der Beziehungen“ an. Entsprechend der Prämisse, dass es Spanien ist, dessen Verbesserungswünsche befriedigt gehören, wird das „Einwanderungs- und Drogenproblem“ auf die Tagesordnung gesetzt und kategorisch ausgeschlossen, dass „undiskutierte und undiskutierbare Fragen“ auf den Tisch kommen, also alle Gebietsansprüche Marokkos:
„Über die Städte Ceuta und Melilla wird nicht gesprochen, denn sie sind so spanisch wie Sevilla und Cadiz.“ (Verteidigungsminister Trillo, 18.7.)
Ein Vergleich mit Gibraltar, der sich allgemein aufdrängt – zumal gerade die spanisch-britischen Verhandlungen über den künftigen Status des bislang von England gehaltenen Felsens laufen – und der von Marokko kräftig bemüht wird, wird nach allen Regeln der historisch-völkerrechtlichen Kunst zurückgewiesen. Das einzig schlagende Argument ist und bleibt: Wir geben die Städte nicht her!
4. (K)ein Fall für die ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik‘ Europas
Schuldig ist sich Spanien die „harte und feste Haltung“ auch, um seine wachsenden Ambitionen innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus (die Erweiterung der G8 ist beantragt!) zu rechtfertigen. Deshalb will man die renitenten Nordafrikaner einerseits autonom, also in nationaler Regie zur Räson bringen; andererseits fordert man Rückendeckung durch die EU – und damit die Ermächtigung, dem widerspenstigen EU-Assoziierten zugleich im Namen und mit der erpresserischen Wucht der gesamten Union entgegenzutreten. Die beansprucht die Mittelmeer-Region bekanntlich als ihre – mit vielen „Sicherheitsrisiken“ behaftete – Einfluss-Sphäre. Mit diesem Antrag laufen die Spanier freilich Gefahr, dass die lieben Partner und Konkurrenten ihnen die Bedingungen ihrer Solidarität vorbuchstabieren. Was auch prompt geschieht, so dass die Petersilien-Affäre ganz nebenbei schon wieder zu einem kleinen Lehrstück in Sachen ‚Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik‘ gerät:
- Die dänische Rats-Präsidentschaft stellt sich zunächst entschlossen hinter die Spanier.
- Da sie sich nur bei Gibraltars Herrn, dem Briten Tony Blair, das Plazet eingeholt hat, wird sie von anderen, übergangenen Mitgliedstaaten gerügt und hält sich von da an zurück.
- Frankreich „sabotiert“ eine gemeinsame Solidaritätsadresse an Spanien. Seine neue Regierung hat sich gerade die „Revitalisierung“ seiner nationalen Afrika-Politik vorgenommen, nutzt die Querelen Spaniens mit Marokko zugunsten eigener Interessen weidlich aus (mit Erfolg: Ölbohrkonzession für marokkanische Küstengewässer und Ölprospektionslizenz für die Westsahara) und will seine „kooperativen europäischen Afrikabeziehungen“ nicht durch überflüssige spanische Manöver „gestört“ sehen.
- Kommissionspräsident Prodi übermittelt dem marokkanischen Außenminister die drohende Erinnerung an die „wirtschaftliche Abhängigkeit“ seines Landes von der EU und verlangt den sofortigen „Rückzug vom europäischen Territorium“, sprich: von der Petersilien-Insel.
- Berlin und London sowie andere Hauptstädte sind einerseits solidarisch mit Madrid, wünschen andererseits eine schnelle Bereinigung der lästigen Affäre und bestreiten Spanien in jedem Fall die Rolle eines autorisierten Vollstreckers europäischer Mittelmeerpolitik. Die deutsche Öffentlichkeit, Abziehbild des politischen Standpunkts der Nation, vermisst folglich jeden Sinn darin, eine Lappalie zum „Muskelspiel“ aufzublasen.
- Das Hin und Her bleibt nicht ganz ohne Wirkung: Spanien fürchtet, auf der bevorstehenden EU-Außenministerkonferenz zu einer „friedlichen Lösung“ gedrängt und auf die Weise gemaßregelt zu werden; es bringt deshalb den Rückzug seiner Helden von der befreiten Insel rechtzeitig vor der Sitzung über die Bühne und definiert seinen Auftrag als erfüllt.
Die europapolitische Bilanz: Der Insel-Konflikt zwischen einem EU-Mitglied und einem der EU assoziierten Staat wird in den Hauptstädten je nach nationaler Interessenlage beurteilt und im Namen Europas zensiert. Das spanische Erziehungsprogramm gegenüber Marokko wird teils unterstützt, teils mit Vorbehalten konfrontiert, teils demonstrativ als bilaterale Querele ignoriert. Eine Anerkennung der „natürlichen“ spanischen Vorreiter-Rolle in Sachen mediterraner Ordnungspolitik findet nicht statt. Ebenso wenig stellt sich die EU selbst ein Mandat aus, um die Zuständigkeit für das „Krisenmanagement“ zu übernehmen. Was eben daran liegt, dass es kein einheitliches europäisches Interesse gibt, kein politisches Subjekt, das sich über die Mitglieds-Nationen stellen, deren Streit schlichten und sie auf einen gültigen Standpunkt festlegen könnte und wollte.
5. Die USA ordnen den Konflikt als unerwünscht ein und ihren weltpolitischen Bedürfnissen unter
Also dürfen sich „hohe Diplomaten in Brüssel“ wieder einmal darüber beklagen, dass sie den USA die Rolle der entscheidenden Kontrollmacht überlassen müssen – und das, „obwohl“ es sich um einen schweren Konflikt zwischen einem EU-Mitglied und einem „strategischen Assoziierten der EU“ handelt. (El País, 27.7.) Amerika wartet erst gar nicht darauf, ob es gefragt wird. Sein Standpunkt ist nicht vieldeutig, sondern unmissverständlich. Und am Willen zu seiner praktischen Durchsetzung gibt es keinen Zweifel.
Die Amerikaner können diesen Konflikt nicht leiden. „Es gefällt uns nicht, was die da machen.“ (Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums) Ihnen gefallen nur die Konflikte, die sie selber beschließen; also die nötigen und wichtigen, die der Durchsetzung ihrer Weltmachtinteressen dienen. Und da haben die USA zurzeit „im östlichen Mittelmeer“ ihren vorrangigen Bedarf fixiert: mit dem Programm des „Antiterrorkrieges“, das die Unterwerfung der Palästinenser sowie Machtwechsel im Irak und Iran erfordert. Sie brauchen also Frieden im westlichen Mittelmeer
– für die laufenden und geplanten Kriege rund um das östliche.
Dass es ein Unding ist, „dass sich unsere Freunde streiten“, reicht als Leitfaden der amerikanischen Einmischung vollständig aus. Wenn zwei amerikanische Bündnispartner, die Amerika beide braucht, einen kleinlichen Streit, womöglich gar Krieg wegen ihrer unbefriedigten Interessen führen, dann ist das für Washington ein Verstoß gegen ihre Pflichten. Sie haben sich zu vertragen und als Stützpunkte und Helfershelfer im amerikanischen Kampf für die Freiheit und gegen das Böse zu fungieren. Ihnen gehört also gesagt, was verlangt ist. Das erledigt Außenminister Powell, telefonisch. Er verlangt die Rückkehr zum „bisherigen Status“ der Insel, und dass beide Staaten „mit gutem Willen“ die „friedliche Lösung ihrer Probleme“ angehen. So bewährt sich Amerika als oberste, überparteiliche Ordnungsmacht, die das unmittelbare Kräfteverhältnis zwischen den Konfliktparteien relativiert, indem sie jede auf sich verpflichtet. Die aktuelle Botschaft ist ebenso grundsätzlich wie unmissverständlich: Die Souveränität der amerikanischen Alliierten hat ihren Inhalt und Zweck – und deshalb auch ihre selbstverständliche Grenze – in der Funktion für den von Amerika angesagten Weltordnungskrieg.
- Marokko wird gebraucht. Das Magreb-Königreich ist zwar auch kein demokratischer Staat in dem Sinn, wohl aber „ein gemäßigter Islam-Staat“, der vom CIA ermittelte Al Kaida-Kämpfer verhaftet und der „inzwischen zum treuesten Verbündeten in Nordafrika“ gegen den terrorträchtigen islamischen Fundamentalismus geworden ist. Also darf Spanien ihn nicht als Unrechtsregime behandeln. Das freut die schwächere Partei, also die Marokkaner.
- Das ärgert die stärkere Seite, den „bewährten NATO-Verbündeten Spanien“. Der „braucht keinen Schiedsrichter“ und „keinen Vermittler“, denn er will ja gerade die verlangte Willfährigkeit von Marokkos Regierung erzwingen, also seine regionale Vormachtstellung beweisen. Andererseits legt die Regierung Aznar besonderen Wert darauf, von Amerika als herausragend loyaler und deshalb zu fördernder Bündnispartner in Europa gewürdigt zu werden. Folglich wird Powell „als Zeuge“ begrüßt,
der – auf Wunsch Marokkos – zur Regelung im Sinne Spaniens hinzugezogen wurde
. (El País, 25.7.)
Vorläufiges amtliches Ergebnis: Marokko und Spanien genügen dem Willen der Führungsmacht und unterschreiben die von Powell vermittelte Vereinbarung. Gleichwohl lassen es sich die USA nicht nehmen, den beiden – keineswegs zufrieden gestellten – Konfliktparteien noch einen Offenen Brief hinterher zu schreiben. Darin beglückwünscht Herr Powell die beiden Freunde Amerikas gleichermaßen zu der gefundenen Lösung – und erläutert, wie er das Ende der Petersilien-Affäre verstanden hat, also gefälligst in Madrid und Rabat verstanden wissen will: Es gilt, was die USA wünschen, und das liegt im wohl verstandenen Interesse beider Seiten! Dann und insofern sind und bleiben beide Länder gute Alliierte und die Pax americana im Mittelmeer erhalten.