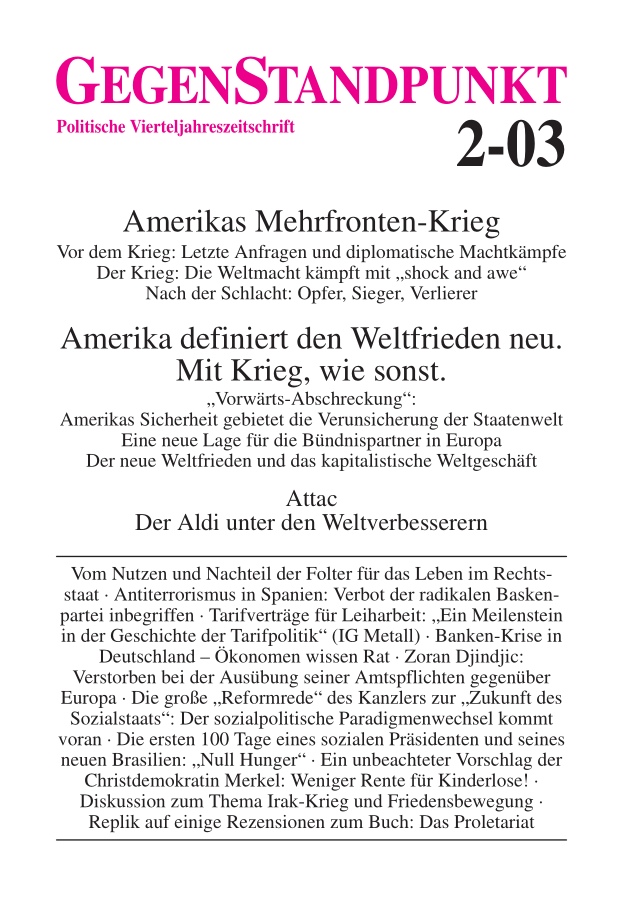Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Bloß eine „Arbeitsrede“? „Keine Glanznummer“? Wieder nur ein paar völlig unzureichende „Schritte in die richtige Richtung“?
Die große „Reformrede“ des Kanzlers zur „Zukunft des Sozialstaats“: Der sozialpolitische Paradigmenwechsel kommt voran
Jetzt ist sie also endlich gehalten worden, die „Ruck-“, „Blut-, Schweiß- und Tränen-“ oder auch „Reformrede“ des Kanzlers, auf die die Nation so lange gewartet hat und mit der es in Deutschland „wieder aufwärts“ gehen soll. Das Ganze hat aber ganz nebenbei auch einen Inhalt. Der kritische Führerkult dreht sich um nichts Geringeres als einen entschiedenen Fortschritt in der Sozialstaatsräson der Republik.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Bloß eine Arbeitsrede
?
Keine Glanznummer
? Wieder nur ein paar völlig
unzureichende Schritte in die richtige
Richtung
?
Die große „Reformrede“ des Kanzlers
zur „Zukunft des Sozialstaats“: Der sozialpolitische
Paradigmenwechsel kommt voran
1.
Jetzt ist sie also endlich gehalten worden, die „Ruck-“,
„Blut-, Schweiß- und Tränen-“ oder auch „Reformrede“ des
Kanzlers, auf die die Nation so lange gewartet hat und
mit der es in Deutschland „wieder aufwärts“ gehen soll.
Die Opposition hat lange genug glaubwürdig demonstriert,
dass sie die „Politik für Deutschland“ besser
machen würde; die Öffentlichkeit hat die dazu passenden
Maßstäbe für die Kritik an der Regierung mitentwickelt
und vorbuchstabiert. Und der Souverän selbst, das Volk,
hat der Regierungspartei SPD einen Denkzettel für
falsches Regieren in Gestalt dreier schwerer
Wahlniederlagen beschert, so dass Schröder endlich
‚verstanden hat‘ – nämlich: dass er Deutschland
nur dann weiterhin regieren kann, wenn er seinem Volk
Tatkraft und Führungswillen demonstriert und vor
keinen Opfern zurückscheut, die er die einfacheren Teile
seines Volkes erbringen lässt, damit die
Wirtschaft
wieder wächst und den Leuten Arbeit gibt.
Weil es darum geht, geht es freilich um mehr als eine
Rede. Die wird natürlich sorgfältig inszeniert
und zum öffentlichen Großereignis hochgejubelt – Eine
Rede macht Berlin verrückt. Politiker, Verbände,
Journalisten, alle rätseln im ‚Bild‘-Jargon: ‚Was kommt
da auf uns zu?‘
(Die Welt, 5.3.); streicht der
Kanzler mehr am Kündigungsschutz oder mehr im
Gesundheitswesen; darf die Wirtschaft auf einen
Befreiungsschlag
hoffen; und vor allem: Wie
wird die Melodie klingen?
(Die Welt, 7.3.); vermag
der Kanzler die Menschen zu beeindrucken; Schafft der
Kanzler diese Woche die Wende?
(Bild, 10.3.) und
rettet seine Regierung?
Und natürlich liefern
parlamentarische wie außerparlamentarische Opposition das
passende Echo – War das alles?
fragt ‚Bild‘; und
die Christlich-Liberalen geben, pflichtschuldigst
enttäuscht
, die Antwort: zu wenig, zu
kompromisslerisch; Westerwelle sieht keinen „Ruck“
durch Deutschland gehen, sondern allenfalls ein
Rucklein
, Angela Merkel nicht den großen
Wurf
; auch wohlmeinende Rhetorik-Analysten haben nur
eine Arbeitsrede
gehört und keine rhetorische
Glanznummer, die uns mitreißt
. Demokratische
Freiheitshelden wollen von ihren Regierenden eben
Führung, nichts als Führung: An dem
Leitfaden entlang wird inszeniert und kritisiert, und die
intellektuelle Elite der Nation ergeht sich
hingebungsvoll in politischen Geschmacksurteilen darüber,
ob und inwieweit eine wohltuende „harte Hand“ in der
Kanzlerrede zu spüren war und Schröder sich als der
„starke Mann“ erwiesen hat, nach dem eben überhaupt nicht
bloß Faschisten, sondern in „schwieriger Lage“ alle
mündigen Bürger samt ihren demokratischen
Meinungsbildnern seufzen.
Das Ganze hat aber ganz nebenbei auch einen Inhalt. Der kritische Führerkult dreht sich um nichts Geringeres als einen entschiedenen Fortschritt in der Sozialstaatsräson der Republik.
2.
Der fängt damit an, dass der sozialdemokratische Kanzler
knapp zwei Wochen vor seiner Regierungserklärung die
anberaumte Sitzung des „Bündnisses für Arbeit“, zur nicht
geringen Überraschung der beteiligten Spitzenvertreter
aus Wirtschaft und Gewerkschaft, beendet und das
„Bündnis“ für „endgültig gescheitert“ erklärt.
Begründung: Es sei keine gemeinsame Linie zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften erkennbar gewesen
–
bislang immer der Auftakt, um sich als
konsensorientierter Moderator und Schiedsrichter zwischen
den gegensätzlichen Standpunkten in Szene zu setzen. Das
Bemühen um Konsens wird jetzt ostentativ aufgekündigt;
und alle verstehen sofort, gegen wen das geht: Schröder
sucht die Machtprobe
mit den
Gewerkschaften; er geht auf
Konfrontationskurs
zu den
Arbeitnehmer-Organisationen. Denen tritt er
entgegen wie der amerikanische Präsident der UNO: Er
erklärt sein Konzept
, das er Punkt für
Punkt
durchsetzen werde, für nicht mehr
verhandelbar
, verlangt Zustimmung zu seinen Ansagen
und lässt die Gewerkschaften wissen, dass nicht er ein
Problem hat, wenn sie ihm die Zustimmung verweigern,
sondern sie – sie diskreditieren damit sich als
ernstzunehmende Gesprächspartner und brauchen sich nicht
zu wundern, wenn sie als Bremser
behandelt werden,
auf die man keine Rücksicht nehmen kann:
„Mir kommt es darauf an, dass es nicht wieder zerredet wird von allen Seiten. Dass durch dieses Zerreden jeder Reformansatz kaputtgemacht wird. Es muss endlich auch einmal möglich sein, in Deutschland so etwas anzufangen, durchzusetzen und dann auch die Wirkungen sich anzuschauen, bevor dann wieder nächste Diskussionen geführt werden. Es geht jetzt darum, das, was ich vorgeschlagen habe, was in sich vernünftig ist für unser Land, umzusetzen.“ (Schröder in: Berlin direkt, 16.3.)
Und noch direkter:
„Wenn die Gewerkschaften die Vorschläge pauschal ablehnen, dürfe darauf keine Rücksicht genommen werden, sagte der Kanzler.“ (SZ, 2.4.)
Angesichts dessen, was er sich durchzusetzen vorgenommen
hat, erscheinen dem Kanzler die überkommenen und von ihm
bisher gepflegten Umgangsformen mit den Gewerkschaften
nicht mehr passend. Von dem bisherigen Verfahren, deren
Interesse an mehr Beschäftigung und an konstruktiver
Mitbestimmung über die dazu – „leider“ – nötigen Schritte
auszunutzen, um ihnen die Zustimmung zu einer
schrittweisen Verschlechterung der staatlich geregelten
Arbeitsbedingungen abzuringen, verspricht er sich nichts
für die „Veränderungen“, die er jetzt auf den Weg bringen
will; im Gegenteil. Rücksichtnahme auf einen sozialen
Frieden
, zu dem die Arbeitnehmer-Organisationen
deutscher Nation noch allemal bereit sind, wenn man sie
nur „einbezieht“ und am Ende triumphierend verkünden
lässt, sie hätten, wie immer das Ergebnis aussieht, „das
Schlimmste verhindert“, wäre absolut
kontraproduktiv für den „Wandel“, den der
regierende Sozialdemokrat seiner Republik verordnet.
Er will den Unvereinbarkeitsbeschluss, nicht die
Arbeiterinteressen-Vertreter, die lieber beleidigt über
eine Absage an unsere Bereitschaft mitzuarbeiten
lamentieren. Schröders „Agenda“ verträgt keine
gewerkschaftsfreundlichen Beschönigungen. Sie
ist nicht bloß Klassenkampf von oben – nämlich
von Staats wegen –; der anberaumte Klassenkampf von oben
will ausdrücklich gewonnen sein. Damit der
Sieg so ausfällt wie geplant, braucht es einen
eindeutigen Verlierer. Sonst wird nämlich am
Ende doch nicht der Paradigmenwechsel
in der
Sozialpolitik daraus, auf den die Regierung es ganz
offensichtlich abgesehen hat.
3.
Gleich eingangs seiner Regierungserklärung stellt Kanzler
Schröder klar, dass ihm nichts ferner liegt, als sich auf
Ausflüchte einzulassen. Er jedenfalls hat nicht vor, sich
auf die durch die Krise um den Irak
zusätzlich
belastete, ohnehin labile Konjunktur
der
Weltwirtschaft heraus- und um den heißen Brei
herumzureden: Die Wachstumsschwäche
, mit der
Deutschland kämpfe, habe auch strukturelle
Ursachen
. Nämlich die folgenden:
„Die Struktur unserer Sozialsysteme ist seit 50 Jahren praktisch unverändert geblieben. An manchen Stellen, etwa (!) bei der Belastung der Arbeitskosten, führen Instrumente der sozialen Sicherheit heute sogar zu Ungerechtigkeiten. Zwischen 1982 und 1998 sind die Lohnnebenkosten von 34 auf fast 42 Prozent gestiegen. Daraus ergibt sich nur eine Konsequenz: Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei geht es nicht darum, ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozialstaates zu erhalten. Deshalb brauchen wir durchgreifende Veränderungen… Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen… Wir müssen aufhören – das ist der Kern dessen, was wir vorschlagen –, die Kosten von Sozialleistungen, die der Gesellschaft insgesamt zugute kommen, immer nur und immer wieder dem Faktor Arbeit aufzubürden.“
Um diese Ansage einmal Punkt für Punkt gerecht zu
würdigen: Was ist los, wenn die Lohnnebenkosten von 34
auf 42 Prozent
steigen? Jeder weiß es, und wer es
nicht weiß, dem sagt es die Opposition bei jeder
Gelegenheit: Immer mehr Lohnabhängige sind
arbeitslos, zahlen nichts mehr in die
Sozialkassen ein, sondern müssen aus denen alimentiert
werden. Genauer gesagt – auch das ist allgemein bekannt,
von der Opposition freilich schon nicht mehr zu hören –:
Immer mehr „Unselbständige“ werden von ihren
„selbständigen“ Arbeitgebern überflüssig
gemacht; mit marktwirtschaftlicher Notwendigkeit im
Interesse und infolge des Konkurrenzkampfs, den die
Unternehmen führen, und im Zuge des allgemeinen
kapitalistischen Wachstums, das bis zu recht ansehnlichen
Prozentsätzen mit gleichbleibenden oder sogar
verminderten Belegschaften zu erwirtschaften geht. Die
immer noch verdiente Gesamt-Lohnsumme wird folglich immer
knapper für den Lebensunterhalt derer, die auf Lohn als
Lebensmittel angewiesen sind, darauf auch dann angewiesen
bleiben, wenn sie keinen mehr verdienen, und deswegen
sozialgesetzlich – in Abhängigkeit von ihrem persönlichen
Lohnempfänger-Schicksal – zu einer gewissen Teilhabe am
verdienten Gesamtlohn berechtigt sind. Wenn der dafür
umverteilte Teil der Gesamt-Lohnsumme steigt, dann zeigt
das: Die Kosten eines kompletten Arbeiterlebens
oder, was sozialkassenmäßig auf dasselbe hinausläuft, des
Lebensunterhalts der Gesamtheit der Lohnabhängigen und
der Preis, den die Arbeitgeber für die Arbeit
zahlen, die sie für die Erwirtschaftung „schwarzer
Zahlen“ brauchen, laufen auseinander; das
sozialstaatliche Kunststück, dem Gesamtpreis für
Arbeit in der Nation einen Lebensunterhalt für
die Gesamtheit der Arbeiter abzuringen, wird immer
nötiger und das Resultat immer elender.
Anders gesagt: Es steigt die systembedingte
Armut der Gesamtheit der Lohnabhängigen; also genau
das Elend, für dessen systemkonforme Bewältigung
der Sozialstaat einst erfunden worden ist.
Was ist los, wenn die Finanzierung dieser
systemerhaltenden Veranstaltung für die Arbeitnehmer
zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist
?
Dann hat man es mit dem zynischen Konstruktionsprinzip
des marktwirtschaftsgemäßen Sozialstaats zu tun. Der
zieht nämlich das, was er den nicht benutzten
Lohnabhängigen zuschustert, systematisch denen vom Lohn
ab, die überhaupt noch einen kriegen; denen, die mit
ihrer Arbeit und ihrem Lohn „der Wirtschaft“ ihr Wachstum
erarbeiten, legt er den Lebensunterhalt auch aller
anderen zur Last, für die keine andere Überlebenschance
vorgesehen ist als die Lohnarbeit, die sie nicht haben.
Nicht nur die sind zu progressiver Armut verurteilt; auch
die, die noch das elende Glück haben, dass ein
Arbeitgeber sie rentabel ausnutzt, werden um so mehr
geschoren, je weniger von ihnen „die Wirtschaft“ für ihr
Wachstum braucht.
Was ist los, wenn die Lohnnebenkosten
die
Arbeitgeberseite
daran hindern, mehr
Beschäftigung zu schaffen
? Dann hat man es,
theoretisch gesehen, mit einer glatten
Lüge zu tun: Kapitalistische Unternehmer
produzieren alles Mögliche, aber überhaupt keine
„Beschäftigung“. Für ihr Geschäft kaufen sie so
viel Arbeit, wie sie lohnend anwenden können. Sie leiden
nicht darunter, dass das, was sich an Lohn für sie lohnt,
vom Sozialstaat zu Lasten des Einkommens ihrer
Dienstkräfte umverteilt wird. Moralisch gesehen
liegt ein Fall von Frechheit vor: Erst erzeugt
das kapitalistische Geschäftsleben den großen Haufen
Bedürftigkeit, für die die Lohnarbeiter mit ihrem
Verdienst mit aufkommen dürfen; dann rechnen die
Ideologen und Lobbyisten dieses Geschäftslebens das Geld,
das der Sozialstaat zwecks Unterhalt der bedürftigen
Gesamt-Mannschaft aus den Einkommen der Lohnabhängigen
herausquetscht, aus dem Preis, den die Arbeitgeber für
Arbeit zahlen, einfach heraus und beschweren sich
darüber, dass diese Summe ja offensichtlich gar nicht für
den Zweck verausgabt wird, für den sie doch bloß gezahlt
wird, nämlich für rentable Arbeit. Damit ist auch schon,
praktisch gesehen, der Zweck des
Schwindels klar: Es geht um nichts als pure
Lohnsenkung. Die Arbeitgeber wollen
sich das sparen, was ihren
Arbeitnehmern sozialstaatlich weggenommen wird;
was nämlich der Sozialstaat an sich nimmt, um aus einem
Entgelt, das für ein ganzes Leben respektive für die
Gesamtheit der Lohnabhängigen nicht reicht, trotzdem
einen Lebensunterhalt für alle respektive für ein ganzes
Leben zu verfertigen.
Das alles gilt in zugespitzter Form, wenn in Bezug auf diese Unterhaltskosten von „Kosten“ die Rede ist, die „dem Faktor Arbeit“ ‚aufgebürdet‘ würden – zugespitzt insofern, als da die Belastung der Leute, denen ihr Einkommen gekürzt wird, direkt ineins gesetzt wird mit den Kosten, über die die Arbeitgeber seufzen, weil ihr Gewinn und ihr Unternehmenswachstum sie glatt einen Preis für Arbeit kostet. Die Lohnarbeiter selber sollen für ihre eigene Verbilligung Partei ergreifen; nämlich für ihre Verbilligung um den Geldbetrag, den sie selber bzw. ihresgleichen notwendig brauchen, weil sie nicht bloß von einem Arbeitstag auf den andern, sondern ihr ganzes Leben lang, auch wenn kein Arbeitgeber für sie mehr etwas übrig hat, vom verdienten Arbeitsentgelt leben müssen.
Die Zuspitzung liegt aber vor allem darin, dass hier
nicht ein freischaffender Vernebelungskünstler einen
seiner standardisierten Textbausteine von sich gibt. Der
souveräne Blick auf die Lohnkosten, der den kleinen
Unterschied zwischen denen, die sie zahlen, und denen,
die davon leben müssen, gar nicht zur Kenntnis nimmt,
kennzeichnet den Standpunkt einer nationalen
Kapitalstandort-Verwaltung, die in den Lohnabhängigen der
Nation sowieso in erster und letzter Linie den Faktor
Arbeit
sieht, der gar nicht billig genug sein kann.
Es geht um die hochoffizielle, regierungsamtliche Ansage
eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers, wie und in
welchem Sinn er den Sozialstaat durchgreifend
zu
verändern gedenkt, um dessen Substanz zu erhalten
.
Was ist also los, wenn die politischen Herren
des Sozialstaats praktisch ernst machen mit dem
Standpunkt der Arbeitgeber, wonach alle Teile
des Lohns, die sozialstaatlich umverteilt werden, eine
Kostenlast sind, die ihnen nicht mehr zuzumuten
ist?
Dann stellen die Retter des Sozialstaats dessen elende „Logik“ auf den Kopf. Sie ziehen aus dem wachsenden Elend in ihrem Laden, dem mit der verdienten Lohnsumme immer schlechter beizukommen ist, den radikalen Schluss, dass die Armut nicht etwa zu groß, sondern zu teuer ist. Sie beschließen, dass ihr großartiges Gemeinwesen sich die wachsende Armut sehr wohl, deren Finanzierung aber nicht mehr leisten kann. Wenn die Finanzen der Sozialkassen den Folgen des kapitalistischen Fortschritts, der Zunahme der systemnotwendigen Bedürftigkeit, nicht mehr gewachsen sind, dann muss nicht an dieser Konsequenz, geschweige denn an der „Logik“ des kapitalistischen Fortschritts selber etwas geändert werden; dann muss man sich vielmehr „ehrlicherweise“ eingestehen, dass der sozialstaatliche Versuch, mit der zunehmenden Bedürftigkeit systemkonform fertig zu werden, gescheitert ist; und man muss sich zu dem Entschluss durchringen, diesen Versuch nicht mehr fortzusetzen, jedenfalls nicht mehr wie bisher – damit es mit dem Grund des ganzen Elends weitergehen kann. Es braucht nicht einmal viel, um diesen Entschluss wie einen logisch fälligen Schluss aussehen zu lassen; einem Kommentator der ‚Süddeutschen Zeitung‘ fließt der kleine Schwindel wie von selbst aus der Feder:
„Der deutsche Sozialstaat hat trotz seiner jährlichen Milliardenausgaben nicht verhindern können, dass weit mehr als viereinhalb Millionen Menschen ohne Arbeit sind – und rund die Hälfte von ihnen dauerhaft.“ (SZ, 1.4.)
Dafür ist der Sozialstaat wirklich nicht
erfunden worden, und dafür sind die vielen Milliarden
auch nicht umverteilt worden: um die Wirkungen der
kapitalistischen Bewirtschaftung des „Faktors Arbeit“ zu
verhindern; dafür müsste man schon den
Kapitalismus selbst „verhindern“. Dies jedoch – im Sinne
alter frommer Lügen über die Segnungen
bürgerlich-sozialdemokratischer Sozialpolitik, die würde
das Elend quasi ungeschehen machen – einfach mal
unterstellt, ist das „Scheitern“ des Sozialstaats
offenkundig: Das Elend gibt es trotzdem
– und das
spricht eben nicht gegen dessen wirkliche Ursache, den
Umgang des Kapitals mit seiner menschlichen Quelle, und
auch nicht gegen den Zynismus der Sozialpolitik, die
dieses Elend mit all ihren Umverteilungskunststücken nur
fortschreibt, sondern gegen die Milliarden, die dafür
herumgeschoben werden – und dafür, sie der
Wirtschaft
zu ersparen. Wer die Substanz des
Sozialstaats erhalten
will, muss ihn daher von der
ohnehin unerfüllbaren Aufgabe entlasten, dem tatsächlich
gezahlten Preis für Arbeit noch wie bisher den
Lebensunterhalt für alle davon Abhängigen abzuringen.
4.
Ein Versprechen ist mit diesem Rettungsprogramm
immerhin verbunden: Damit wäre ein „Hindernis“ für die
Arbeitgeber aus der Welt, mehr Beschäftigung zu
schaffen
. Dieses Versprechen enthält ein ehrliches
Element: Daran, dass alle Lohnabhängigen vom national
gezahlten Lohn leben müssen und dass der auf alle Fälle
sinkt, führt auch weiterhin kein Weg vorbei; die
Regierung jedenfalls ist entschlossen, diese Summe um
Teile dessen, woraus sie bislang das Überleben ihres
lohnabhängigen Fußvolks hat bestreiten lassen,
abzusenken – als hätte sie bisher die
Überlebenshilfe für überflüssige und ausrangierte
Arbeitskräfte den Arbeitgebern in Rechnung
gestellt. Dass die Arbeitgeber ihrerseits mit dem
gesparten Geld nichts Besseres anzufangen wüssten, als
einfach mehr Arbeiter einzustellen, gehört allerdings ins
Reich der politökonomischen Albernheiten. Kapitalistische
Unternehmer investieren im Interesse ihres
Konkurrenzerfolgs allemal vor allem in die
effektivere Ausbeutung der Leute, die sie
notgedrungen bezahlen müssen, womit sie sich gleich die
gesamten Ausgaben für den Teil ihres Personals ersparen,
den sie dadurch überflüssig machen und entlassen. Was sie
sich einen spitzenmäßig „rentablen Arbeitsplatz“ kosten
lassen, ist mit ein paar eingesparten
„Lohnnebenkosten“-Prozenten sowieso gar nicht zu
bezahlen. Mit denen verdienen sie einfach mehr, verfügen
über mehr Manövriermasse für ihren Konkurrenzkampf, der
dann mit tödlicher Sicherheit wieder ein paar Kräfte
überflüssig macht.
Entscheidend ist aber ohnehin nicht die verlogene
Verheißung, aus einer um ein paar eingesparte Lohnkosten
verbesserten Unternehmensbilanz würde unweigerlich ein
vermehrter Bedarf „der Wirtschaft“ an „Beschäftigung“
ersprießen. Entscheidend ist der amtliche Beschluss, dem
überkommenen Umverteilungs-Elend den sozialpolitischen
Grundsatz entgegenzusetzen: Sozial ist, was Arbeit
schafft
– dass die Christsozialen diesen Spruch
aufgebracht haben, zeigt nur, wie einvernehmlich da eine
neue soziale Staatsräson eingeführt wird. An das
elementare kapitalistische Faktum, dass niemand anders
als „die Wirtschaft“ „Arbeit schafft“, und zwar genau so
viel, wie das angewandte Kapital für sein Wachstum
braucht, rührt diese Maxime nicht; sie umkleidet alle
Härten der Abhängigkeit des Lohns vom Wachstum vielmehr
mit dem schönen Schein, der der Vokabel „sozial“ noch
anhaftet. Wenn bisher aber die Folgeschäden dieses
elementaren Faktums noch als – natürlich unveränderliche,
quasi gottgegebene – Tatbestände zur Kenntnis genommen
wurden, um deren „Bewältigung“ eine Politik des
„Sozialen“ sich zu kümmern hätte, dann gilt heute und
regierungsamtlich ab sofort der umgekehrte Zusammenhang:
Das Kapital mit seinem Wachstum ist das einzige
Heilmittel für alle „sozialen“ Schäden, mit denen der
überkommene Sozialstaat angesichts der schrumpfenden
Lohnsumme nicht mehr gut fertig wird; seine
Umverteilungskunststücke, genauer: die Unkosten, die
dadurch entstehen und aus der knappen Lohnsumme gar nicht
mehr zu decken sind, gehören im Gegenteil selber zu den
sozialen Schäden, ja sind überhaupt der
soziale Schaden, gegen den nichts als kapitalistisches
Wachstum hilft. Der Aufwand für die systemgemäße
Regulierung der Folgeschäden kapitalistischer Ausbeutung
ist nicht bloß sinnlos und der Sozialstaat insofern
gescheitert; er ist selber, dies die „Räson“ der neuen
deutschen Sozialpolitik, Ursache der Übel, für
deren Bekämpfung er einmal vorgesehen war.
Wenn diese Umdrehung des überkommenen Sozialstaats-Zynismus, die vom Kapital Geschädigten für ihren eigenen Schaden zahlen zu lassen, einmal feststeht, dann ergibt sich die Antwort auf die rhetorische Kanzler-Frage ganz von selbst:
„Wir müssen auch über das System unserer Hilfen nachdenken und uns fragen: Sind die sozialen Hilfen wirklich Hilfen für die, die sie brauchen?“ (S.8)
Klar sind es welche: Der Bedürftige bekommt immerhin Geld, das er zum Überleben braucht, aber nicht hat. Und selbstverständlich sind es keine wirklichen Hilfen: Aus dem Elend der Lohnabhängigkeit, also der Abhängigkeit davon, dass man mit Lohn und Leistung einem Kapitalisten lohnende Dienst leisten muss und noch nicht einmal dafür eine Gewähr hat, hilft das „System unserer Hilfen“ überhaupt nicht heraus – soll es ja auch gar nicht; im Gegenteil. Aber das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Schröder spricht den zunehmend erbärmlichen Unterstützungszahlungen des Sozialstaats den Charakter von Hilfen ab, um deren Streichung zur eigentlichen „sozialen“ Hilfe zu erklären und die künftige Sozialpolitik auf diesen Standpunkt festzulegen. Der Grundsatz lässt sich dann natürlich an jeder Unterabteilung von Sozialfällen durchexerzieren, die die bisherige christlich-sozialdemokratische Sozialpolitik geschaffen hat. Zum Beispiel so:
„Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen“.
Müssen überflüssig gemachte Arbeitswillige in Zukunft
etwa nicht mehr zum Sozialamt gehen
, wenn ihre
definitiv ausrangierten und auch willensmäßig unbrauchbar
gewordenen Kollegen vom Arbeitsamt kein Geld mehr
kriegen? Natürlich müssen sie auch dann noch dort hin, um
sich das Lebensnotwendige abzuholen. Aber das wird auf
alle Fälle dann schon viel ‚akzeptabler‘, wenn der
Sozialstaat sich zu der sozialen Tat durchringt und
den andern die reguläre Hilfe wegnimmt.
Denn die bekommen auf alle Fälle zuviel
Geld für das, was sie im Kapitalismus noch wert sind; und
damit hat der Kanzler ‚Akzeptanzprobleme‘. Ebenso mit
folgendem Skandal:
„Ich akzeptiere auch nicht, dass Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen.“ Und was folgt daraus? „Wir brauchen deshalb Zuständigkeiten und Leistungen aus einer Hand. Damit steigern wir die Chancen derer, die arbeiten können und wollen“ – wie auch immer das gehen soll. „Das ist der Grund, warum wir die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zusammenlegen werden, und zwar einheitlich auf einer Höhe, … die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird.“
Womit schon wieder bewiesen wäre, dass den
hilfsbedürftigen Arbeitslosen nur dadurch wirklich
zu helfen ist, dass man Hilfen, in dem Fall auch die für
sie selber, zusammenstreicht.Und so weiter.
An jeder überkommenen Unterstützungsmaßnahme setzt Schröders „Agenda 2010“ an, um daran die zynische Gleichung von mehr Armut und Existenzunsicherheit auf der einen Seite, größerer Erwerbschance auf der anderen Seite durchzusetzen. Und wenn diese Gleichung nur nach der einen Seite hin aufgeht; wenn weder die Reform der Bundesanstalt für Arbeit noch die Umsetzung des Hartz-Modells oder die „Deregulierungen“ auf dem Arbeitsmarkt mit befristeten Arbeitsverhältnissen und einem „Niedriglohnsektor“ auch nur die geringsten „Beschäftigungseffekte“ zeitigen; wenn sich an den sozialdemokratisch verwalteten proletarischen Arbeits- und Lebensverhältnissen also wieder einmal nur die durch sozialdemokratische Sozialreformen angeblich längst überwundene Marx’schen „Verelendungstheorie“ bewahrheitet: dann spricht das überhaupt nicht gegen Schröders neues sozialdemokratisches „Konzept“, geschweige denn für den naheliegenden Schluss, dass „die Wirtschaft“ längst über mehr als genügend Billigarbeitskräfte für ihre Wachstumsbedürfnisse verfügt. Wenn alle Maßnahmen nicht „greifen“, dann spricht das vielmehr für eine einzige Konsequenz: Weiter so!
„Wir haben feststellen müssen, dass diese Schritte nicht ausreichen. Vor allem reicht auch die Geschwindigkeit, mit der wir unsere Strukturen den veränderten Bedingungen anpassen, nicht aus. Das ist der Grund, warum wir bei den Veränderungen weitergehen müssen.“
5.
Der „Umbau“ des Sozialstaats muss sein, weil er anders gar nicht mehr funktioniert. Das Elend der Sozialkassen ist der unwiderlegliche Beweis, dass, Sozialpolitik hin oder her, der Lebensunterhalt der lohnabhängigen „Klasse“ aus dem im Dienste kapitalistischer Wachstumserfolge verdienten Lohn einfach nicht zu bestreiten ist; also soll man das auch gar nicht mehr probieren; denn dann schmälert man nur den Profit, den das Kapital doch für sein erfolgreiches Wachstum braucht. Der Sozialstaat wird damit keineswegs überflüssig. Dessen Gewalt ist im Gegenteil unverzichtbar: Wer sonst sollte die Rückkehr zu den schlichten Grundprinzipien des Kapitalismus durchsetzen in unserer komplizierten Welt?
„Es liegt doch auf der Hand, dass eine Gesellschaft wie die unsere eine wirklich gute Zukunft nur als Sozialstaat haben kann. Anders als in einem Sozialstaat lässt sich Zusammenarbeit in komplexen Ordnungen, in einer Gesellschaft, in der sich der Altersaufbau, die Art und Dauer der Arbeitsverhältnisses, aber auch die kulturellen Gegebenheiten dramatisch verändern, gar nicht organisieren.“
Soziologisch einigermaßen verquast, aber letztlich dann
auch wieder ganz verständlich bringt der Kanzler den
Sozialstaat als unverzichtbares Herrschaftsinstrument in
Erinnerung: Wo es so viel zu „organisieren“ gibt in der
Welt der Arbeit, wäre es völlig abwegig, wollte der Staat
sich ausgerechnet des Stücks Macht entledigen, das er
sich als Hüter der Sozialkassen mit Verfügungsgewalt über
einen beträchtlichen Anteil des nationalen Lohns
verschafft hat. Es gilt diese Verfügungsgewalt
richtig zu gebrauchen – so eben, dass der
Lebensunterhalt der lohnabhängigen Massen auf das Maß der
Geldsumme zurückgeschraubt wird, die das Kapital sich
seinen Zugriff auf die Zusammenarbeit in komplexen
Ordnungen
allenfalls kosten lassen will.
Es sind aber nicht bloß die uralten Imperative der
‚dramatisch veränderten‘ kapitalistischen
Klassengesellschaft, die diesen Fortschritt gebieten.
Schröder hat ein noch viel höherrangiges Ziel vor Augen,
von dem seine Regierung eine wirklich gute Zukunft
der Nation nicht bloß abhängig weiß, sondern mit aller
Tatkraft abhängig macht. In einem
imperialismus-theoretischen Exkurs, den er sich und
seiner Nation nicht nur aus aktuellem Anlass – einige
deutliche Worte zur Krise in und um den Irak…
–
schuldig zu sein meint, erläutert er, was die Rolle
Deutschlands in Europa und Europas in der Welt
mit
dem Lebensunterhalt der arbeitenden Klasse daheim zu tun
hat. Bindeglied ist die Wirtschaftskraft
, mit der
Deutschland in und mit Europa imperialistisch vorankommen
will, von der aber auch unsere sozialen
Möglichkeiten
abhängen:
„Wir werden sowohl unsere Verantwortung als auch unsere mitgestaltende Rolle in einer multipolaren Weltordnung des Friedens und des Rechts nur dann umfassend wahrnehmen können, wenn wir das auf der Basis eines starken und geeinten Europas tun. Es geht um die Rolle Europas in der internationalen Politik. Aber es geht auch um die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen in der Welt von morgen. Beides – auch das ist Gegenstand dieser Debatte – werden wir nur erhalten können, wenn wir wirtschafts- und sozialpolitisch beweglicher und solidarischer werden, und zwar in Deutschland als dem größten Land in Europa, was die Wirtschaftskraft angeht, und damit natürlich auch in Europa. Diesen Zusammenhang zwischen unseren wirtschaftlichen und damit auch sozialen Möglichkeiten einerseits und unserer eigenen Rolle in Europa und Europas in der Welt andererseits, darf man nicht aus den Augen verlieren; denn er ist für uns und unsere Gesellschaft genauso wichtig wie für unsere Partner in Europa.“
Insgesamt sehr übersichtlich, was die Hierarchie der
Gesichtspunkte anbelangt. Ganz oben in der Liste der
Prioritäten steht für den Kanzler die Unabhängigkeit
unserer Entscheidungen in der Welt von morgen
. Er
nennt ja keine Namen, wer die eigentlich gefährdet. Klar
aber ist auch so, dass die nur in einer multipolaren
Welt
gegeben ist, in der nicht nur Amerika über Krieg
und Frieden auf dem Globus entscheidet und Recht und
Unrecht in der Staatenwelt definiert. Also gilt es, sich
entsprechend aufzustellen und als Macht zu etablieren,
die das auch kann. Dem Kanzler ist völlig klar,
dass diese Macht nur Europa heißen kann; nur auf der
Basis
kommen wir
weiter. Dem Kanzler ist
aber auch klar, dass dieses ehrgeizige Projekt nicht
zuletzt eine Frage der ökonomischen Potenzen, der
nationalen Wirtschaftskraft
ist, und in dem
Zusammenhang fällt das Stichwort ‚sozial‘ das erste Mal.
Es ist nämlich so, dass diese Wirtschaftskraft, die für
mehr imperialistische Größe eingespannt werden soll, also
freigesetzt werden muss, ein gewisses
solidarisches
Verhalten auf Seiten derer
voraussetzt, die maßgeblich am Zustandekommen derselben
beteiligt sind – indem sie sie nämlich
erarbeiten. Es ist eigentlich ganz einfach, und
der Kanzler erläutert diesen Zusammenhang in seiner Rede
rund ein halbes Dutzend Mal: Es muss mehr gearbeitet
werden, damit mehr in die nationalen Kassen Deutschlands
und seiner europäischen Partner kommt; und damit mehr
gearbeitet wird, müssen die sozialen Standards gekippt
werden, mit deren Aufrechterhaltung der Sozialstaat nur
den Kostenfaktor Arbeit unnötig verteuert – und zwar
in Deutschland als dem größten Land in Europa und damit
natürlich auch in Europa
. Erst recht gilt dieser
Zusammenhang natürlich
, wenn die nationale
Wirtschaftskraft an einer Wachstumsschwäche
leidet
– den Zustand kann eine Nation mit solchen Ambitionen
schon gleich nicht hinnehmen; was umgekehrt aber
keineswegs heißt, dass der Kanzler nur ein
krisenbedingtes Notprogramm auf den Weg bringen will. Er
will neue soziale Standards etablieren – für die gute
Sache, in deren Dienst er seine Politik stellt: für ein
starkes Deutschland in einem geeinten Europa mit
souveränen Weltordnungskompetenzen. Aus all dem ergibt
sich dann zwanglos – gerechterweise an letzter Stelle
seiner nationalen Prioritätenliste –, wie es um unsere
sozialen Möglichkeiten
bestellt ist. Damit hat man
die gültige Positionsbestimmung dessen vor sich, was
Sozialpolitik heute ist: Wahrhaft soziale Politik
betrachtet und behandelt den sozialstaatlich
organisierten Lebensstandard der lohnabhängigen Massen
konsequent als Mittel für den gesamtwirtschaftlichen
Konkurrenzerfolg der Nation. Und warum der sein
muss, steht sowieso außer Frage – siehe oben. Oder wie
schon einmal ein deutscher Kanzler gewusst hat:
Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht
sein.
6.
Und die Nation?
Dass die mit Schröders „Agenda“ zufrieden wäre, lässt sich nicht behaupten. Das Programm geht nicht weit genug; es geht zu weit; es nimmt immer noch zu viel Rücksicht auf die Gewerkschaften; es ist sozial unausgewogen…
Aber es geht über die Bühne. Und zwar aus einem einzigen schlichten Grund: Der soziale Frieden, den der Kanzler den Gewerkschaften aufkündigt, hält. Die Betroffenen kündigen ihn nicht. Die sind längst daran gewöhnt, ihre Unzufriedenheit von der ‚Bild‘-Zeitung erledigen, ihre Interessen von national verantwortlichen Gewerkschaften vertreten und sich von den politisch Zuständigen ihre Belange samt den dazu passenden Deutungen vordiktieren zu lassen – und sich ansonsten nach jeder Decke zu strecken. Und diese schlechte Gewohnheit geben sie auch jetzt nicht auf.
Das nutzt der Kanzler aus. Er ist sich sicher: Dieses Volk nimmt es hin, wenn er ihm die Unvereinbarkeit seines bisherigen sozialstaatlich arrangierten Lebensunterhalts mit einem funktionierenden Kapitalismus und einem ehrgeizigen Imperialismus deutscher Nation vorbuchstabiert und ihm eine kleine ‚Revolution von oben‘ zumutet: den gründlichen Verzicht – nicht auf Kapitalismus und deutsche Größe, nicht auf die Opfer, die das kostet, sondern auf seinen sozialstaatlich arrangierten Lebensunterhalt.
Das einzige, was fehlt – und was vor allem dem Kanzler fehlt, woran nämlich das geehrte Volk es fehlen lässt: das ist die rechte Begeisterung. Und nicht einmal die unterbleibt deswegen, weil das Programm der modernen deutschen Sozialdemokratie so unverschämt und zynisch ist, wie es eben ist. Zur rechten Stimmung fehlt, bis auf Weiteres jedenfalls, nichts weiter als der durchschlagende Erfolg – der Nation und für die Nation. Damit ist das demokratische Publikum unzufrieden – weil das an ihm nämlich nicht liegt. In ihrer Eigenschaft als Schröders Manövriermasse lassen die Deutschen es wirklich an nichts fehlen.
Als solche werden sie dann allerdings reichlich bedient. Im Verein mit der Öffentlichkeit, die diese Unzufriedenheit bespricht und pflegt, darf das Volk sich den Fragen des Gelingens widmen: Ob die Gewerkschaften sich über den Streit, wie viel Einspruch gegen und wie viel Zustimmung zum Regierungsprogramm sie sich schuldig sind und leisten können, endgültig zerstreiten; wie die SPD-‚Rebellen‘ vom Kanzler zur Räson gebracht werden und wie viel Ergänzungen zur und Retuschen an der ‚Agenda 2010‘ dafür nötig bzw. verträglich sind – wie gut es also dem Kanzler gelingt, die neuen staatlichen Regelungen der Lohnarbeiterarmut und das dazu passende ‚Umdenken‘ – insbesondere in seiner eigenen Partei – über die politische Bühne zu bringen. Das ist doch allemal wichtiger und interessanter als der materielle Gehalt des beschlossenen nationalen Vorhabens, das da demokratisch umgesetzt wird. Für weitere Aufregung ist also gesorgt…