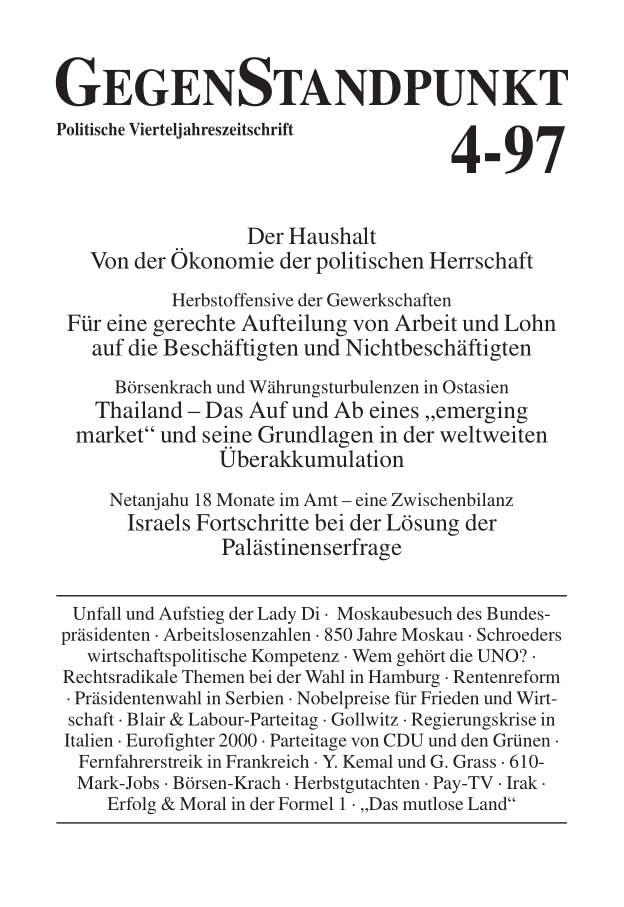Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Wahl in Hamburg
Rechtsradikale Alternativangebote
Der demokratische Pluralismus hat ein Wahlargument: Innere Sicherheit. Alle Parteien werben mit ihrer rechtsradikalen Kompetenz um Glaubwürdigkeit.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Wahl in Hamburg
Rechtsradikale Alternativangebote
Hamburg wählt sich eine neue Bürgerschaft. Und wieder einmal kriegt es der Wähler hin, sich ganz geheim und in aller Freiheit so zu entscheiden, daß die beiden großen Parteien die mit Abstand größten bleiben; daß die Partei der sozial denkenden und ökologisch empfindenden Besserverdienenden ihre Stellung als dritte Kraft hält; daß der öffentliche Unmut über „zunehmende soziale Ungerechtigkeit“ sich durch eine erneute Abfuhr für die Yuppie-Liberalen von der FDP bestens bedient sieht; vor allem aber: Seine Zustimmung zu den rechtsextremen Protestparteien teilt sich der Wähler so raffiniert ein, daß die DVU mit einem Defizit von ca. 200 Stimmen gerade soeben doch nicht ins Stadtparlament einzieht und dort den guten Ruf der Freien Hansestadt bekleckert. Dann nämlich wäre ein großes Erschrecken über rechtsextreme Tendenzen in der Politik losgegangen. So aber wollte niemandem auffallen, daß die beiden großen wie die zwei kleinen rechtsradikalen Parteien, in der Sache ununterscheidbar, ein und denselben Gesichtspunkt anbieten, unter dem die Wahl unbedingt auf sie fallen muß. Ihnen allen geht es darum, daß nicht nur die Ursachen, sondern auch die Erscheinungsformen von Kriminalität bekämpft werden müssen
, um Sauberkeit und Sicherheit auf unseren Straßen
und um einen härteren Umgang mit ausländischen Straftätern
; sie alle sind in Sorge wegen Asylanten, die die Sozialkassen leeren
, sowie wegen einer offenen und sich ausbreitenden Drogenszene
; sie alle kümmern sich um einen ständig tiefer werdenden Abgrund zwischen Arm und Reich und die wachsende Kriminalität
und um Brennpunkte der Gewalttätigkeit, besonders unter Jugendlichen
; sie stören sich alle gleichermaßen an laschen Gesetzen und umständlichen Verfahren bei der Verbrechensbekämpfung
, an Ausländern, die unsere Knäste verstopfen
, sowie an den viel zu vielen Richtern, die einem schon zu den Ohren herauskommen
… – mit einem Wort: Sie engagieren sich für mehr und härteres staatliches Durchgreifen gegen alle, die es nicht besser verdienen. Der demokratische Pluralismus gibt wieder einmal das gewohnte Bild ab: 4 und mehr Parteien zehren in ihren Kontroversen von 1 und demselben Wahlargument.
Selbstverständlich „entsprechen“ alle Parteien bloß einem ebenso dringlichen wie berechtigten Bedürfnis des Wählers, wenn sie das „Thema: Innere Sicherheit“ in den Mittelpunkt ihrer Wahlwerbung rücken bzw. grün-alternativ ihr „Verständnis für die Ängste der Bürger“ bekanntgeben. Ebenso selbstverständlich aber verlassen sie sich mitnichten auf dieses übereinstimmend diagnostizierte Massenanliegen. Keine Partei verzichtet darauf, dem Bürger seinen elementaren politischen Rechtsanspruch auf „innere Sicherheit“ beschwörend nahezubringen und immer wieder einzuhämmern, daß seine „berechtigte Unzufriedenheit“, sein Interesse an wohnlicheren Lebensverhältnissen, überhaupt seine sämtlichen Wünsche an die Politik letztlich auf nichts anderes hinauslaufen als auf genau die Forderung nach einer zupackenden öffentlichen Gewalt, die die Parteien unbedingt erfüllen, also auch „von unten“ vernehmen wollen. Sie blenden deswegen die „sozialen Ursachen“ der heftig propagierten allgemeinen „Unsicherheit“ keineswegs aus, sondern erinnern fortwährend daran, daß eine kapitalistische Metropole vom Schlage Hamburgs neben allem Geschäftsreichtum und Repräsentationsprotz auch jede Menge verkommener Viertel beherbergt, in denen sich die vom globalen Fortschritt überflüssig gemachten „Elemente“ sammeln; Leute, vor allem auch junge, ohne Lebensperspektive, denen gar keine andere Karriere als eine kriminelle offensteht und die wirklich keinen Grund haben, zur Verschönerung des Stadtbilds beizutragen. Aus wachsendem Elend und entsprechender Verwahrlosung folgt nämlich umgekehrt – nach der Logik der demokratischen Wahlkämpfer –, daß die Staatsgewalt in der Stadt viel zu tun hat, um den Laden trotzdem sauber und ansehnlich zu halten. Wenn wachsende Armut die Stadt verkommen läßt, dann tut stadtstaatliche Mobilmachung gegen die verkommenen Elemente not; effektives Durchgreifen ist die Bewährungsprobe der Obrigkeit. Mit dieser klaren Botschaft gehen die Parteien sogar mitten hinein in die „sozialen Brennpunkte“ der Stadt: Wer unter Obdachlosen, zwischen Asylanten-Containern, neben arbeitslosen Nachbarn und kaputten Familien, mitten in einer elendigen „Szene“ lebt, weil das eigene Einkommen zu mehr nicht reicht, der wird von den rechtsradikalen Protestparteien wie von seinen ehrenwerten Bürgerschaftskandidaten ganz genauso wie die gehobene städtische Szene als ehrenwerter Bürger angesprochen, der doch wohl kein dringlicheres Anliegen hat als das eine: daß die Behörden ihm den menschlichen Schmutz seiner Umgebung vom Hals halten; und zwar mit einem „eisernen Besen“, dessen Härte der Härte der elenden Verhältnisse entspricht. Denn die Stadt gehört exklusiv dem sauberen, anständigen Bürger. Wer sie sozial verunreinigt, gehört schon deswegen nicht „dazu“ – ein moralisches Verdikt in praktischer Absicht, das sich überhaupt nicht auf den dingfest gemachten stadtstaatseigenen kriminellen, drogensüchtigen und graffiti-sprühenden „Abschaum“ beschränkt, sondern gleich auch den gesamten Bevölkerungsteil – vorbehaltlich gewisser Ausnahmen – großzügig mit einschließt, der nicht zu den hanseatischen Eingeborenen gehört und mit seinen (Un-)Sitten das saubere norddeutsche Straßenbild stört. Der wahl-kämpferisch propagierte Säuberungswahn verträgt sich nicht mit umständlichen Differenzierungen zwischen „Kriminellen“ und „Ausländern“; er unterscheidet höchstens so: Die einen gehören „rein“, nämlich in ihren deutschen Knast, die andern bei der geringsten Verfehlung „raus und zwar schnell“. In diesem Sinne gerät die stadtstaatliche Obrigkeit in die Kritik, und zwar durchaus auch in ihre eigene: Ganz offenkundig, man sieht es ja, hat sie in der Vergangenheit den alles entscheidenden politischen Fehler gemacht und es versäumt, Verwahrloste, Kriminelle und andere verdächtige Elemente, denen jeder Hamburger ihre Ortsfremdheit gleich ansieht, erst gar nicht hereinzulassen. Das meint sogar Stadtchef Voscherau, dessen SPD in dieser Vergangenheit ununterbrochen regiert hat. Dagegen gehört jetzt durchgegriffen und jeder gewaltsam abserviert, der das Recht der Hamburger auf einen Stadtstaat nach ihrem eigenen Bilde verletzt: Das vor allem ist die Obrigkeit dem Bürger schuldig, dem die Stadt doch recht eigentlich gehört…
Daß das eine vernünftige Ableitung wäre, läßt sich schwerlich behaupten. Auf eine rationale Schlußfolgerung kommt es aber auch zuallerletzt an, wenn die wahlkämpfenden Parteien von zunehmender Verwahrlosung einen „Schluß“ auf die Notwendigkeit härterer Repression ziehen und als einzig passende Antwort auf vermehrte Armut mehr Gewalt gelten lassen. Entscheidend ist: Sie erklären sich dem Bürger verpflichtet und sagen gleich dazu inwiefern. Zutiefst verpflichtet sind sie dem mit großem Aufwand herbeigeführten sozialen Urbedürfnis nach einem gewaltsam vollstreckten Abstandsgebot zwischen der Welt des bürgerlichen Anstands und dem aus der ganzen restlichen Welt dorthin exportierten Sittenverfall. Diese politische Selbstverpflichtung der Parteien ist überhaupt aus keinen „Fakten“, die „innere Sicherheit“ der Stadt und ihre Kriminalitätsrate betreffend, abgeleitet, so daß sich Kriminalexperten darüber „wundern“, daß trotz gleichbleibender Kriminalitätsrate die Furcht vor Verbrechen in der Hamburger Bevölkerung rasant gestiegen ist. Auf Ungemütlichkeiten aller Art wird von den Wahlkämpfern vielmehr verwiesen, um eine ganz grundsätzliche Klarstellung zum politischen Auftrag der öffentlichen Gewalt plausibel zu machen. Sie betrifft die widersprüchliche Verheißung aller bürgerlichen Staatsgewalt, ihren Untertanen mit Gewalt von Nutzen zu sein: Diese paradoxe Gleichung wird dahingehend erläutert, daß aller Nutzen, den der Bürger sich von seinem Staat erwarten darf, aber auch verlangen kann, in dessen Gewalt besteht. Alle öffentlichen Sozialleistungen fassen sich in dem einen Dienst zusammen: mit Gewalt wirksam zu scheiden zwischen den guten Untertanen, die, gleichviel ob arm oder reich, in ihrer „Szene“ Ordnung halten, und dem unanständigen Rest, dessen bloße Anwesenheit schon einige Pflichtvergessenheit der Regierenden bezeugt – darin eingeschlossen all jene, die als Ortsfremde in dem nicht zu widerlegenden Verdacht stehen, mit ihren abweichenden Sitten gegen die ortsübliche Sittlichkeit zu verstoßen. Die „Lageanalyse“, die den Bürger von lauter Verkommenheit umzingelt sieht, im Elend nichts als die drohende oder bereits hereingebrochene Kriminalität erblickt, die anständige Gesellschaft als Opfer der zuwenig bekämpften Unanständigen wahrnimmt und deren sittlich-kulturelle Unterwanderung durch „die Ausländer“ befürchtet, begründet diesen Standpunkt nicht; sie malt umgekehrt den Anspruch an die Staatsgewalt, sich zu beweisen und „Ordnung zu schaffen“, zu einem ganzen Weltbild aus. Diese Art, Sinn und Zweck staatlicher Gewalt zu definieren, macht den politischen Standpunkt aus, der in der Demokratie ‚rechts‘ heißt und ‚rechtsradikal‘ wird, wenn er sich nicht mehr an anderen Aufgaben und Vorhaben des bürgerlichen Staates relativiert, sondern diese umgekehrt unter den Gesichtspunkt der Säuberung
des Gemeinwesens subsumiert und entsprechend umsortiert. Er steht polemisch gegen die – genauso verkehrte und erst recht widersprüchliche – ‚linke‘ Lesart der Gleichung von Nutzen und Gewalt, wonach die Staatsmacht den sozialen Auftrag hätte, den „Unterprivilegierten“ machtvoll Gutes zu tun und ausgleichende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen – ausgerechnet den Opfern jener Eigentumsverhältnisse also, die der bürgerliche Staat mit seinem Gewaltmonopol durchsetzt und mit seinem lückenlosen Rechtssystem so konsequent wirken läßt, daß Reichtum und Verelendung in der bekannten Weise nebeneinander aufblühen.
Im Hamburger Wahlkampf ziehen nun große und kleine Vereine mit ein und demselben rechtsradikalen Standpunkt ins politische Gefecht – und treffen dort auf so gut wie gar keinen linken Gegner. Von der Sache her, die ihnen allen so sehr am Herzen liegt, könnten sie sich glatt zusammentun und als unwiderstehliche Putzkolonne über sämtliche „sozialen Brennpunkte“ der Stadt herfallen. Doch darum geht es ihnen nun auch wieder nicht, vielmehr um ein Bürgervotum, das den jeweils eigenen Kandidaten den Oberbefehl über die Gewalt im Stadtstaat überträgt und nicht der gleichgesinnten Konkurrenz. Für die demokratischen Parteien ist die Ausmalung eines allgemeinen Sittenverfalls, der nach Gewalt gegen Personen schreit, Mittel zum Zweck, nämlich, sich als die einzig erfolgversprechenden Sachwalter dieses Gewaltbedarfs anzupreisen. Damit erwecken sie natürlich den Verdacht, ihr Engagement für staatliches Durchgreifen und Aufräumen wäre womöglich doch nicht ganz ernst gemeint, sondern nur zu Werbezwecken vorgetäuscht; genauer gesagt: sie tun alles, um gegen ihre Konkurrenten genau diesen Verdacht zu wecken – und sorgen genau auf diese Weise dafür, daß sich endgültig keiner mehr dem rechtsradikalen Konsens über die politischen Prioritäten entzieht. Das Engagement für „saubere Verhältnisse“ wird nicht relativiert, sondern verabsolutiert, wenn alle ernsthaften Wahlbewerber es in eigennütziger Berechnung zu dem Kriterium machen, unter dem der Wähler sie prüfen, ihre jeweilige Glaubwürdigkeit vergleichen und schließlich die Wahl entscheiden soll.
Der Wähler, wie man sieht, läßt sich nicht lumpen. Kompetent und differenziert nimmt er die ihm angetragene Musterung der Bewerber nach ihrer rechtsradikalen Kompetenz und Glaubwürdigkeit vor und entscheidet so, daß die SPD zwar immer noch die stärkste Fraktion bleibt, im Vergleich zum letzten Mal aber erheblich verliert.
Damit beleidigt er zum einen den bisherigen Bürgermeister, der den Wahlkampf eigens auf das „Thema innere Sicherheit“ – also auf die radikale Subsumtion aller sonstigen stadtstaatlichen Anliegen unter die rechte Gewaltfrage – zugespitzt hat, um – ganz offen gesagt – glanzvoll wiedergewählt zu werden
. Obwohl er vorher sogar noch gedroht hat, er werde glatt seinen Dienst quittieren, sollte das Wahlergebnis seine private politische „Schmerzgrenze“ überschreiten, lassen die hansestädtischen Wähler ihren bewährten Chef mit vier Prozentpunkten Verlust im Regen stehen. Ein so undankbares Volk hat Voscheraus Führerqualitäten nicht länger verdient: Er tritt nicht bloß, er zieht sich zurück – Hamburg wird schon merken, was es davon hat…
Irritiert ist darüber hinaus die ganze sozialdemokratische Partei. Sie hat nämlich auch viel dafür getan, um ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Law & Order vom Hamburger Wähler anerkannt zu kriegen; in der offen ausgesprochenen Berechnung, dadurch die Weichen für eine erfolgreiche Wahlkampfstrategie im kommenden großen Wahljahr richtig zu stellen. Im Bundesrat durfte Voscherau eigens die Initiative zu einem Verbrechensbekämpfungsbeschluß ergreifen, der eindringlich vor Augen führt, wie wenig es beim „Thema innere Sicherheit“ um Erfordernisse des Polizeialltags geht – die werden sowieso erfüllt, und die neuesten gesetzlichen Handhaben sind gerade erst in Kraft getreten, also noch gar nicht ausgeschöpft –, wie sehr vielmehr um die grundsätzliche politische Orientierung der Nation und den entsprechenden Kompetenzstreit der Parteien. Mit einer gleichlautenden, vom gleichen Interesse diktierten Initiative Bayerns wurde Voscheraus Beschlußvorlage extra nicht zusammengefaßt, um die unverwechselbare Handschrift der regierenden norddeutschen Sozialdemokratie sichtbar werden zu lassen. Da gibt der Rückschlag in Hamburg natürlich zu denken. Dem Bundesgeschäftsführer der Partei z.B. folgendes:
„Die Hamburger Sozialdemokraten hätten bei der Behandlung des Themas zu sehr auf den polizeilichen Aspekt gesetzt. Darüber hätten sie soziale Gesichtspunkte der inneren Sicherheit, die Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise, vernachlässigt.“
Nicht als ob die Bonner SPD-Spitze grundsätzlich etwas dagegen hätte, gegen die anderen Parteien die Konkurrenz um die größte Glaubwürdigkeit beim Einsatz der Staatsgewalt zur Säuberung der Gesellschaft aufzunehmen und gewinnen zu wollen. Der Mißerfolg lehrt die Partei aber, daß sie da noch viel zu tun hat. Gerade bei diesem „Thema“ darf gerade sie wohl nicht auf den „Aspekt“ verzichten, sich als Patron der Zukurzgekommenen darzustellen. Ein Rückfall in linke Positionen muß das gar nicht sein: „Jugendarbeitslosigkeit“ als Gesichtspunkt der inneren Sicherheit
ist wirklich nicht dasselbe wie der Beschluß, Jugendlichen eine Lebenschance, geschweige denn eine einträgliche Berufskarriere zu verschaffen. So wird vielmehr die nachwachsende Generation in ihrer kapitalistisch hergestellten ökonomischen Überflüssigkeit völlig vom staatlichen Ordnungsbedürfnis her als Problem begutachtet. Vorbeugung gegen sittengefährdende Verwahrlosung wird versprochen und den Betroffenen ein Recht zuerkannt, von Staats wegen von einer kriminellen Karriere ferngehalten zu werden, am besten durch einen Ausbildungsplatz mit seinen bekannten und allseits beliebten disziplinierenden Wirkungen – selbstverständlich ohne daß sich daraus irgendwer ein Recht auf Ausbildung oder Arbeit ableiten darf… Soviel soziales Engagement in der Tradition der Sozialdemokratie steht wirklich in keinerlei Gegensatz zum „polizeilichen Aspekt“ der „inneren Sicherheit“; es bildet die logische und notwendige Ergänzung dazu, ist ein unerläßliches Zusatzinstrument zur Sicherung von Recht und Ordnung und hat daher auch seit jeher im Arsenal rechtsradikaler Politik seinen festen Platz.
Aber man kennt ja die Sozialdemokratie: Kaum läßt der Wahlerfolg zu wünschen übrig, schon wird die Parteidisziplin brüchig und die ganze Parteilinie wieder unklar. Altlinke rühren sich mit der Behauptung, es sei wohl doch nicht so geschickt gewesen, den alten Rechtsparteien ausgerechnet das „Thema innere Sicherheit“ streitig machen zu wollen, zumal die Kritik staatlicher Versäumnisse beim Säubern unweigerlich auf die immerwährende Hamburger Regierungspartei zurückfallen mußte; vielleicht sollte man sich doch wieder mehr als Anwalt der „Schwächsten in der Gesellschaft“ profilieren… So gerät das Profil in Gefahr, das vor allem der niedersächsische Bewerber um die sozialdemokratische Kanzlerkandidatur seiner Partei aufdrücken will. Der will ganz entschieden weg vom „Unterprivilegierten“-Image und allen Erinnerungen an Lesarten des Sozialen, die dem Bild einer bedingungslos kapitalfreundlichen Partei der „ökonomischen Kompetenz“ widersprechen; er will ebenso entschieden hin zu einer parteieigenen „sozialen Kompetenz“, die sich pur vom staatlichen Ordnungsstandpunkt aus um die zunehmende Verelendung kümmert und darin von keiner anderen Partei übertreffen läßt. Also gibt Schröder die Parole aus: Wir dürfen jetzt nicht wackeln
– sonst kann der Wähler den Sozialdemokraten ihren zeitgemäßen Willen zum pur repressiven Gebrauch der Staatsgewalt nicht abnehmen; alle müssen sich dazu bekennen, daß innere Sicherheit und Kriminalität auch sozialdemokratische Themen sind
– wobei das „auch“ für das Programm steht, andere „sozialdemokratische Themen“, wie Jugendarbeitslosigkeit und soziale Gerechtigkeit, mit der richtigen rechten Stoßrichtung zu behandeln. Denn:
„Das Signal für den Machtwechsel in Bonn muß nun in Niedersachsen nachgeholt werden.“
So entpuppt sich noch der entschiedenste Rechtsradikalismus des Sozialdemokraten Schröder als Element seiner politischen Karriereplanung und seiner diesbezüglichen wahlstrategischen und -taktischen Berechnungen. Das heißt freilich alles andere, als daß dieser Standpunkt bloßes Werbematerial wäre. Methode und Sache gehen da zusammen: Wenn den Politkarrieristen und Wahltaktikern nichts Besseres einfällt, um ihre Herrschaftskompetenz zu beweisen, als die Beschwörung des Staatsauftrags, die sittlich unschönen Konsequenzen des globalen und nationalen kapitalistischen Fortschritts gewaltsam zu unterdrücken und zu eliminieren, dann ist für sie die politische Herrschaft, die sie anstreben, eben durch diesen Auftrag definiert. Denn sie bringen dem Wähler allemal bloß die Kriterien zur Beurteilung der Politik bei, denen sie zu genügen gedenken.