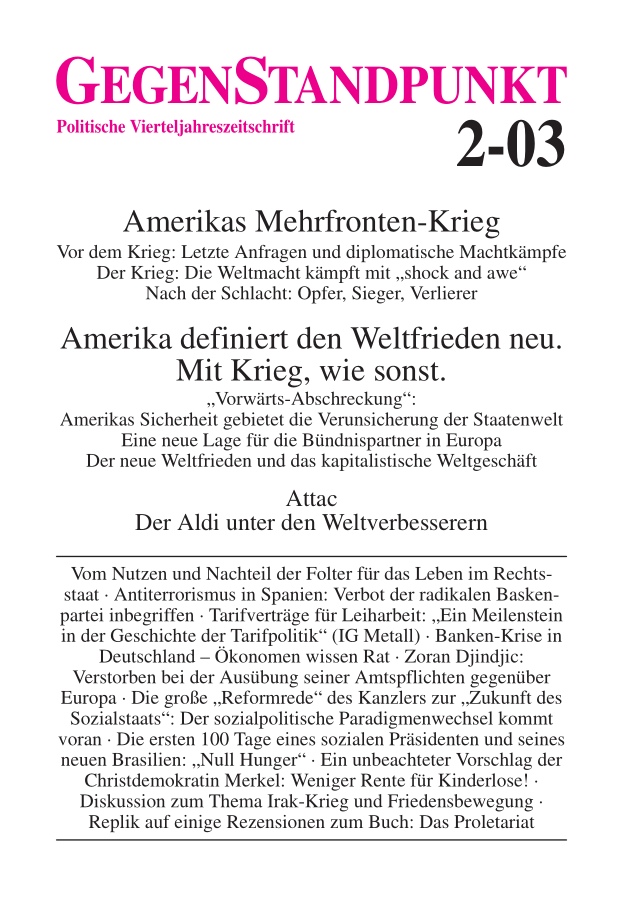Das Buch des GegenStandpunkt-Verlags
Peter Decker, Konrad Hecker
Das Proletariat …
Thomas Kuczynski (Klassen haben keine Wahl), Sebastian Gerhardt (Gut gemeint – schlecht gemacht), Jörg Roesler (Rahmenbedingungen verunmöglichen Klassenkampf) und Robert Steigerwald (die Zyniker) sind sich nur in ihrer Ablehnung des Buches einig.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Die Rezensionen
- Thomas Kuczynski, Eine Ent-Täuschung (Junge Welt vom 17.1.2003)
- Sebastian Gerhardt, Das Ende der Arbeiterbewegung und die Fortexistenz des Proletariats – Gut gemeint, schlecht gemacht. (Neues Deutschland vom 17.1.2003)
- Jörg Roesler, Besser als sein Ruf (Junge Welt vom 5.2.2003)
- Zuschrift von Robert Steigerwald (Junge Welt vom 5.2.2003)
- Replik auf einige Rezensionen: Theorethische und praktische Notwendigkeit gegen geschichtsphilosophische Zwangsläufigkeit
Das Buch des GegenStandpunkt-VerlagsPeter Decker, Konrad Hecker
Das Proletariat …
hat einige linke Rezensenten zu fundamentalen Einwendungen herausgefordert. Wir dokumentieren die wichtigsten und liefern eine nicht minder grundsätzliche Kritik der Kritik.
Die Rezensionen
Thomas Kuczynski, Eine Ent-Täuschung (Junge Welt vom 17.1.2003)
Das Buch von Decker und Hecker enthält eine streckenweise exzellente Beschreibung der Verhältnisse und des Verhaltens jener lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten, die einst als Arbeiter und Angestellte unter dem Begriff Arbeiterklasse oder Proletariat zusammengefasst wurden. Wer wenig über die konkrete Lebensweise des westeuropäischen, insbesondere des deutschen Proletariats weiß, wenig über dessen Gedanken- und Gefühlswelt, kann das Buch mit Nutzen lesen, ebenso jene, die sich an der einen oder anderen Stelle der Richtigkeit eigener Beobachtung vergewissern wollen. Vielleicht öffnet es sogar bei der einen oder dem andern den Blick auf eine Klasse, die über viele Jahrzehnte angehimmelt worden ist, weil sie, wie im Kommunistischen Manifest verkündet, „die Zukunft in ihren Händen (trage)“; vielleicht, denn die meisten, denen die Augen geöffnet werden könnten oder sollten, werden sie wahrscheinlich sofort wieder zuklappen, die Augen und auch das Buch, weniger wegen des Inhalts der Beschreibungen, sondern wegen der ungemein selbstgerechten und geradezu moralisierenden Diktion, der sich die Verfasser bedienen.
Wer die als Untertitel firmierende Inhaltsangabe zu seinem Buch mit dem Satz abschließt „Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende“, der glaubt wohl tatsächlich, die Gerechtigkeit für sich gepachtet zu haben – die Wahrheit sowieso, denn im ganzen Buch findet sich, außer bei Marx-Engels-Zitaten, keinerlei Quellenbeleg, so dass den Verfassern ihre Aussagen allenfalls geglaubt werden können. Allein politische Hygiene wird sie davon abgehalten haben, den geschichtsnotorischen Untertitel „Eine Abrechnung“ zu verwenden. Denn eine Abrechnung mit dem Proletariat und dessen Glorifizierung ist das Buch in jedem Fall, unausgesprochen vielleicht auch eine mit sich selbst, mit früheren Irrtümern, denn die Verve, mit der sie geschrieben haben, scheint auch aus dem Ärger gespeist, damals, als man noch Mitglied der „Marxistischen Gruppe“ war, einem Irrglauben aufgesessen zu sein.
Fehlprognose von Marx
Wenden wir uns daher zunächst diesem Irrglauben zu. Marx und Engels hatten ihn im Kommunistischen Manifest sehr überzeugend vorgetragen, insbesondere am Schluss des ersten Abschnitts, wo sie meinten, die Bourgeoisie produziere ihren eigenen Totengräber, das Proletariat, und daher seien ihr Untergang und sein Sieg gleich unvermeidlich. Wenn sie ihre eigene Kenntnis der vorausgegangenen Geschichte etwas stärker berücksichtigt hätten, wären sie vielleicht zu einem anderen Resultat gelangt und hätten diese welthistorisch so bedeutsame Fehlprognose nicht abgegeben. Eingangs des Abschnitts bemerkten sie nämlich nicht nur, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, sie konstatierten auch, dass er, der Klassenkampf, „jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen“. Rückblickend müssen wir dies „oder“ in Frage stellen: Keine einzige der zuvor sich bekämpfenden Hauptklassen war an der nachfolgenden Umgestaltung der Gesellschaft in dem Sinne beteiligt, dass sie in der neuen Gesellschaft noch vorhanden war. Als Klasse haben weder Sklave und Sklavenhalter den Untergang der antiken Produktionsweise überlebt noch Leibeigner und Feudalherr den der feudalen. Warum also sollte es Proletariat und Bourgeoisie in den neuen Klassenkämpfen so viel anders ergehen?
Marx und Engels sahen das offenbar nicht so, denn im Manifest lesen wir dazu: „Der Leibeigne hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer … herab.“ Diese Prognose hat „der moderne Arbeiter“ in schweren Klassenkämpfen selbst widerlegt und sich zum Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft „herangearbeitet“, und zwar „ohne dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt“ wurde. Dieser historische Sachverhalt kann und muss ganz nüchtern konstatiert werden, ohne dass das Verhalten des Proletariats in der Weise denunziert wird, es habe „Karriere gemacht“.
Klassen haben keine Wahl
Dass die Mitglieder der Klasse des Proletariats sich zu Mitgliedern der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft „herangearbeitet“ haben, dies verhindert den weiteren Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat ebenso wenig, wie das „Heranarbeiten“ von Leibeignen und Kleinbürgern das Ausbrechen von Bauernaufständen und Bürgerunruhen verhindert hat. Es ist allerdings Ausdruck dafür, dass der Kampf allein innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise stattfindet und demzufolge nicht auf die Überwindung der kapitalistischen Klassengesellschaft gerichtet ist. Eben deshalb werden wohl auch Bourgeoisie und Proletariat gemeinsam untergehen, also als Klasse nicht an der „revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft“ teilnehmen.
Diese Sichtweise würden die Verfasser sicherlich als objektivistisch verurteilen, denn sie meinen: „Das Proletariat hatte und hat eine Wahl, und es hat eine andere getroffen: Statt einer Revolution gegen das System der Ausbeutung hat es in ihm Karriere gemacht…“ (S.30). Das klingt natürlich unerhört rrrevolutionär, ist aber nichts als voluntaristische Kritik, der Ärger darüber, dass das Proletariat sich anders verhalten hat und verhält, als es Wille und Vorstellung der Verfasser verfügt haben. Klassen haben keine Wahl, sondern eine historische Funktion, die wissenschaftlich und ohne moralisierendes Beiwerk zu analysieren ist (wobei derartige Analysen auch schlicht falsch sein können). Allenfalls haben einzelne Mitglieder einer Klasse die Möglichkeit, die eine oder andre Wahl zu treffen – so wie Friedrich Engels politisch einen proletarischen Standpunkt gewählt hat und sozial Kapitalist bzw. Rentier geblieben ist.
Der Mythos vom Vaterland
„Nationalistisch verdorben“ sei das Proletariat. Gewiß, die Behauptung, die Arbeiter hätten „kein Vaterland“, hat sich als falsch erwiesen. Zugespitzt formuliert, sind Arbeiter heute (und seit hundert Jahren) wohl die einzigen, die glauben, ein Vaterland zu haben; ihre Kontrahenten, die Bourgeois, glauben es jedenfalls nicht und nutzen zugleich die „vaterländischen“ Gefühle der Arbeiter gern für ihre eigenen Zwecke aus. Auch das ist ohne moralisierende Schuldzuweisung analysierbar: All das, was das Proletariat an Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen erkämpft hat, das Arbeits- und Tarifrecht, die Sozial-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen, Urlaubsansprüche usw., macht das aus, was heutzutage Sozialstaat genannt wird und in der Tat juristischer Kodifizierung im nationalstaatlichen Rahmen bedurfte. Es ist also kein Wunder, wenn Arbeiter diesen Sozialstaat genannten Klassenkompromiß mit Klauen und Zähnen gegen äußere Bedrohungen verteidigen und ihnen – angesichts der „ihren“ (nationalen) Sozialstaat in Frage stellenden Europäischen Union, der fortschreitenden Internationalisierung und Globalisierung des Wirtschaftslebens – Verhaltensweisen internationalistischer Solidarität weitgehend abhanden gekommen sind. Das entschuldigt weder Nationalismus noch Fremdenfeindlichkeit, erklärt aber ein Stück weit ihr gerade in jüngster Zeit verstärktes Auftreten, erklärt, warum Arbeiter glauben können, ein Vaterland zu haben.
Der Abschied von der im Manifest formulierten Utopie fällt schwer, um so schwerer, als „Ersatz“ für das abhanden gekommene – vielleicht nie dagewesene? – revolutionäre Subjekt nicht in Sicht zu sein scheint, die Enttäuschung also um so größer ist. Enttäuschung ist aber zumeist ein schlechter Ratgeber, dann nämlich, wenn man sie, wie allgemein üblich, rein negativ faßt und sich enttäuscht von der einst geliebten Person oder auch Personengruppe (Klasse, Organisation, Partei usw.) abwendet. Richtig verstanden, kann Ent-Täuschung auch positiv gefaßt werden, nämlich als Befreiung von einer Täuschung – einer Selbsttäuschung, denn nicht andere haben mich getäuscht, ich selber habe mich getäuscht oder zumindest mich täuschen lassen. Diese positive Sicht ist allerdings ohne eine gehörige Portion Selbstkritik nicht zu haben.
Die Selbstkritik hätte weiter an dem Glauben anzusetzen, irgendeiner Klasse könne es überhaupt vergönnt sein, zunächst durch eine Revolution die Herrschaft zu erobern, dann aber als herrschende Klasse die Bedingungen ihrer eigenen Existenz und damit ihrer eigenen Herrschaft aufzuheben. Diese geschichtsphilosophische Konstruktion der Selbstaufhebung des Proletariats, wie sie sich ungeheuer gedrängt am Schluß des zweiten Abschnitts des Manifests findet, hatte Marx zwar in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie entwickelt (siehe MEW EB 1, S.390/91 bzw. MEGA I.2, S.181-83), sie ist aber wohl selber noch völlig „verhegelt“ und erinnert gar sehr an die Legende des Barons von Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen habe.
Fern aller Selbstkritik
Der Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft, jener „Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“, kann schon von der Sache her nicht unter der Herrschaft einer einzelnen Klasse beginnen, sie kann nur von einer sozialen Bewegung errichtet werden, die nicht bloß die jahrtausendealte Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit umzukehren sucht und damit über kurz oder lang wieder bei einer Herrschaft einer (anderen) Minderheit landet. Ob und unter welchen Bedingungen der Aufbau einer derartigen Assoziation möglich ist, bleibt zu diskutieren. Ebenso die Frage, ob eine soziale Bewegung, in der sich über kurz oder lang wieder eine „naturwüchsige“ Hackordnung von Führung und Geführten herausbildet, überhaupt in der Lage ist, eine herrschaftsfreie Assoziation zu begründen, ob für das Beschreiten eines solchen Weges eine Partei im landläufigen Sinne von Nutzen oder Schaden ist usw. All diese und viele weitere Fragen müßten Gegenstand ernsthafter Diskussion sein, die zugleich eine hochspannende Debatte sein könnte, kritische Selbstreflexion vorausgesetzt.
Die Verfasser jedoch sind weit entfernt von aller Selbstkritik und allein enttäuscht. Ihre „Methodische Nachbemerkung zum ‚notwendig falschen Bewußtsein‘ des Proletariats“ belegt das in aller Deutlichkeit. Sie fragen: „Warum machen Lohnarbeiter mit in einem Gemeinwesen, das sie systematisch zur Manövriermasse des kapitalistischen Eigentums und des dazugehörigen allgegenwärtigen staatlichen Gewaltapparats degradiert?“, und stellen fest: „Die Antwort ist bereits gegeben. Es gibt dafür keine anderen ‚Ursachen‘ als die schlechten Gründe, die die Leute haben. Aber vielleicht muß man gerade manchen übriggebliebenen Linken darauf noch mal extra aufmerksam machen.“ (S.272/73) Tja, wenn die (von den Verfassern in Anführungsstriche gesetzten) Ursachen nichts anderes als die schlechten Gründe der Leute sind – wie klug war da doch Fritz Reuters Onkel Bräsig, als er meinte, die Armut käme von der Powertee…
Analytisch gibt das Buch also nichts her. Politisch wird alles denunziert, was nicht „auf Linie“ ist, insbesondere „übriggebliebene Linke“, die im übrigen häufig als Popanz und Genosse Pappkamerad fungieren müssen, um mancher Verbalattacke die „richtige“ Stoßrichtung geben und ihr wenigstens einen scheinbaren Sinn verleihen zu können. Aber auch diese Kritik wird die Verfasser nicht sonderlich stören, denn wenn ihrer Meinung nach allein „die Leute“ Schuld sind, dann manifestiert diese Zuweisung nur die sich selbst gewisse Sicht jenes kleinbürgerlichen Demokraten, von dem Marx (im Achtzehnten Brumaire) meinte, er gehe „ebenso makellos aus der schmählichsten Niederlage heraus, wie er unschuldig in sie hineingegangen ist, mit der neugewonnenen Überzeugung, dass er siegen muss, nicht dass er selbst und seine Partei den alten Standpunkt aufzugeben, sondern umgekehrt, dass die Verhältnisse ihm entgegenzureifen haben.“
Sebastian Gerhardt, Das Ende der Arbeiterbewegung und die Fortexistenz des Proletariats – Gut gemeint, schlecht gemacht. (Neues Deutschland vom 17.1.2003)
Es gibt es noch: das Proletariat. Es ist nicht verschwunden. Das meinen Peter Decker und Konrad Hecker. In ihrer Untersuchung über den Aufstieg und Niedergang der lohnarbeitenden Klasse sezieren sie das ökonomische System, das eine solche besondere Klasse hervorgebracht hat und über alle Veränderungen hinweg stets aufs neue reproduzierte. Auch wenn die heutigen Lohnabhängigen im Gegensatz zu ihren Kollegen des 19. Jahrhunderts reichlich über Gebrauchsgüter aller Art verfügen und sich einer höheren durchschnittlichen Lebenserwartung erfreuen, so hat sich doch nichts an ihrer ökonomischen Stellung verändert. Auch heute sind sie vom Lohn abhängig und verfügen über kein Eigentum, das ihnen ein selbständiges Einkommen verschaffen, ihre Abhängigkeit vom Gang der Geschäfte anderer Leute beenden könnte.
Das Proletariat gibt es also noch. Aber die „soziale Frage“ ist nach Ansicht der beiden Autoren gelöst: „Der moderne Arbeitnehmer ist die Antwort.“ Zugleich jedoch konstatieren sie ein „Ende der Arbeiterbewegung in Deutschland“. 150 Jahre erfolgreicher Arbeiterbewegung hätten der bürgerlichen Staatsmacht all die Reformen aufgezwungen, die erst eine nachhaltige Ausbeutung ermöglichen: So gibt es kollektive Regelungen über Arbeitsbedingungen und Löhne in Tarifverträgen und ein besonderes Arbeitsrecht im Unterschied zu bloß privaten Verträgen. Eine staatliche Zwangsbewirtschaftung des Bruttolohnes mit allerlei Abzügen verwandelt Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit aus existenziellen Bedrohungen in irgendwie erträgliche Bedrückungen der Einzelnen. Als gleichberechtigte Staatsbürger auch politisch emanzipiert, suchten die abhängig Beschäftigten in Beruf und Freizeit die Chancen zu realisieren, die ihnen die Gesellschaft bietet. Sie bleiben dennoch so arm, dass sie für andere arbeiten gehen müssen.
Der ultimative Erfolg der Arbeiterbewegung besteht also nur darin, die Lohnarbeit erträglich gemacht zu haben. Und selbst dieser Erfolg wird im Zeitalter der Globalisierung wieder in Frage gestellt. Ob daher die Verteidigung der alltäglichen Sorgen der Beschäftigten den Gewerkschaften eine dauerhafte Aufgabe sichern wird, lassen die Verfasser offen. Ihnen geht es um die weitergehenden Versuche, den Kapitalismus zu verändern. Und die Gründe für die Niederlagen dabei finden sie im unzureichenden Veränderungswillen der Revolutionäre oder in ihrer falschen „Kritik an der politischen Ökonomie des Kapitalismus und am dazugehörigen demokratischen Herrschaftssystem“. Das negative Pathos der Autoren entspringt einer eigenwilligen Geschichtsphilosophie: der Überzeugung, das alles anders ginge, wenn man nur wollte. Abgesehen von der politischen Gewalt des bürgerlichen Staates lassen sie kein objektives Hindernis für die baldige Umsetzung des Vorhabens gelten, „die Welt planwirtschaftlich zu revolutionieren“. Selbst die Macht des Staates reduzieren sie auf den Unterwerfungswillen seiner Bürger. Als Ursache für die bisher ausgebliebene Revolutionierung können sie denn auch nur eine moralische Unterscheidung anbieten: Die Leute ließen sich von allerlei „schlechten Gründen“ leiten. Die „guten Gründe“ für den Kommunismus seien noch gegeben, finden aber keine ausreichende Berücksichtigung.
Deshalb zweifeln die Autoren nicht an ihrem Ziel. Unbeirrt machen sie dieses zum Maßstab für jede Kritik am und jeden Widerstand im real existierenden Kapitalismus. Unter verschiedenen Titeln („vernünftig geplante gesellschaftliche Arbeitsteilung“ / „vernünftig geplante Produktionsverhältnisse“) werden jene ganz anderen Zustände angedeutet, welche die Arbeiterbewegung zu realisieren versäumte. Die erläuternden Bemerkungen lassen allerdings den Schluss zu, dass die Autoren dabei von der moralischen Ökonomie der traditionellen Arbeiterbewegung gar nicht so weit entfernt sind. Hier wie dort sollte die kommunistische Produktion das Mittel für einen ihr vorausgesetzten Zweck, „die Befriedigung der Bedürfnisse“, sein. Aber es reicht nicht aus, die gute Absicht zum ökonomischen Grundgesetz zu erklären. Produktionsverhältnisse resultieren aus dem wechselseitigen Verhalten der Menschen, dessen Ergebnis nicht auf subjektive Setzung zu reduzieren ist. Auch eine planende Gestaltung hebt die Objektivität der Verhältnisse nicht auf, sondern setzt sie voraus. Davon wollen die Autoren aber nichts wissen.
Irgendwo bei Lessing heißt es, dass man auch schlechte Stücke gesehen haben muss. Dieses Buch ist noch nicht einmal schlecht, wenn man vom ermüdenden Zweck-Mittel-Klapparatismus der Argumentationen absieht. Die Publikumsbeschimpfung ist zu ertragen, da der aufgeklärte Leser sich nicht mit den kritisierten Charaktermasken bürgerlicher Gesellschaften verwechselt. Nur als Erklärung der Niederlagen der Arbeiterbewegung taugt es nichts, die Frage der Bildung eines kapitalismuskritischen Willens wirft es gar nicht erst auf.
Jörg Roesler, Besser als sein Ruf (Junge Welt vom 5.2.2003)
Auf den ersten Blick scheint es so: Da sprechen zwei, Peter Decker und Konrad Hecker, in ihrem Buch „Das Proletariat“ einmal offen aus, was dem geschulten Marxisten schon lange durch den Kopf geht und was er offen bzw. öffentlich zu formulieren eine gewisse Scheu hatte: Das Proletariat der kapitalistischen Hauptländer hat sich im 20. Jahrhundert, sozialer und sonstiger materieller Vorteile wegen, mit dem Kapital arrangiert und ist seiner „historischen Mission“, den Kapitalismus zu stürzen, untreu geworden. Wenn es jetzt, im Zeitalter des Neoliberalismus, auch in den entwickeltsten Ländern die unangenehmen Konsequenzen dieser solange eingenommenen Haltung erleiden muss, ist es daran mehr oder minder selbst schuld.
Bei näherem Hinsehen ist das eine einseitige und vereinfachende Sicht. Decker und Hecker tun – ich beziehe mich hier auf die in der jungen Welt vorgestellten zentralen Thesen – dem Proletariat in mancherlei Hinsicht gewaltig Unrecht. Sie sind der Meinung, die Arbeiter hätten sich dadurch, dass sie auf den Sturz des Kapitals verzichteten und sich darauf beschränkten, für Verbesserungen ihrer sozialen Lage zu streiten, gegenüber den Arbeitgebern wehrlos gemacht. Beim jüngst vollzogenen Übergang von der „pfleglichen Behandlung des lebenden Instrumentariums der Kapitalakkumulation“ zur „zweckmäßig schlechten Behandlung“ sei die sich selbst entwaffnet habende Arbeiterschaft der Willkür des Kapitals ausgeliefert. In den Worten der Autoren: „Das lohnabhängige Volk hat sich daran gewöhnt, genau den Lebensstandard zu brauchen, der ihm zugemessen wird, um allen Anforderungen an seine Arbeitskraft zu entsprechen; seine Lebensbedürfnisse sind nach Art und Umfang funktionsgerecht hergerichtet. Interessen, die dem System der Lohnarbeit zuwiderlaufen und erst recht alle umstürzlerischen Absichten hat es sich abgewöhnt; einen ‚proletarischen Klassenstandpunkt‘ gibt es nicht mehr, die Arbeiterbewegung hat ihren Betrieb eingestellt. Kapital und Staatsmacht verfügen in ihren Lohnarbeitern über eine gesellschaftliche Produktivkraft, die sie uneingeschränkt nach Bedarf und Ermessen einsetzen können.“ Das ist gewiß ein vernichtendes Urteil, aber es ist bei näherer Betrachtung so nicht aufrecht zu halten.
Generalstreik 1948
Die Politik der „pfleglichen Behandlung“ entsprang nicht allein dem Kalkül des Kapitals bzw. der von ihm beherrschten Staatsmacht, „ihre“ Arbeiter von Sympathien mit der „Arbeiterherrschaft“ im Osten abzuhalten, solange diese noch bedrohlich schien. Die Wohlstandsgewinne sind vielmehr in der Regel von den Arbeitern und den sie im ökonomischen Klassenkampf führenden Gewerkschaften erstritten worden, auch wenn die Art und Weise der Austragung dieser Kämpfe nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in der Bundesrepublik weniger militant war als während der Weimarer Republik oder während der Zeit der Massenstreiks im Kaiserreich.
Sich vergleichsweise moderat zu verhalten, die Auseinandersetzungen nicht auf die Spitze zu treiben, war in der Phase des Aufstiegs des Realsozialismus ratsam. Jedoch darf das Bereicherungsstreben des Kapitals und der ihm dienenden Staatsmacht auch in dieser Zeit nicht unterschätzt werden. Die Wiedereinführung der „freien Marktwirtschaft“ im Westen Deutschlands im Sommer 1948 wurde durch Ludwig Erhard mit der Freigabe eines Großteils der Preise bei gleichzeitigem Lohnstopp eingeleitet. Diese für die Verwertungsbedingungen des Kapitals ideale Konstellation stieß rasch auf den Protest der Arbeiter, die wiederum die Gewerkschaften auf Trab brachten. Obwohl diese zunächst den Lohnstopp mitgetragen hatten, entschlossen sie sich zum Generalstreik gegen Erhards Wirtschaftspolitik, der dann am 13. November 1948 auch stattfand. Es handelte sich immerhin um die größte Streikaktion des deutschen Proletariats seit dem Kapp-Putsch.
Schon im Vorfeld des Ausstandes war die damalige „Wirtschaftsregierung“ der Westzonen zu der Erkenntnis gekommen, dass die für das Kapital ideale Konstellation – staatlich fixierte Löhne und steigende freie Preise – sich wohl doch nicht für eine längere Zeit durchhalten ließe. Die Entscheidung zur Freigabe der Löhne hat dem Generalstreik damals natürlich einiges von seiner Vehemenz genommen, nichtsdestotrotz aber bewirkt, dass die freie Marktwirtschaft ab 1949 sozialer wurde – in jenem Jahr vor allem durch Einführung des „sozialen Wohnungsbaus“ und das Wirksamwerden des „Gesetzes zur Milderung dringender sozialer Notstände“.
Etwa so brav und angepaßt, wie Decker und Hecker das moderne Proletariat sehen, haben sich die westdeutschen Gewerkschaften mit stillschweigendem Einverständnis oder unter Duldung ihrer Mitglieder nur in den Jahren nach der ersten Wirtschaftskrise verhalten, die die Bundesrepublik heimsuchte. Zwischen 1967 und 1969 akzeptierten die Gewerkschaftsvertreter in der „Konzertierten Aktion“ die von Wirtschaftsminister Schiller entsprechend seinem Konzept eines „Aufschwungs nach Maß“ geforderte Zurückhaltung bei Lohnforderungen in Tarifverhandlungen. Als man dann viel schneller als gedacht aus der Wirtschaftskrise herauskam, der immerhin die Kanzlerschaft Ludwig Erhards und mit ihr anderthalb Jahrzehnte CDU-Dominanz in der Bundespolitik zum Opfer gefallen waren, ergab sich für das Kapital über drei Jahre hinweg fast eine so günstige Verwertungssituation wie im Spätsommer und Frühherbst 1948.
Brandt das Fürchten gelehrt
Natürlich hätten die „Arbeitgeber“organisationen gern gesehen, dass die „Konzertierte Aktion“ so auf ewig funktionieren würde. Doch Ende 1969 war es dann mit dem „Abnicken“ von Schillers Vorgaben Schluß. Die Gewerkschaften forderten, „die soziale Marktwirtschaft sozialer zu gestalten“, und realisierten in den folgenden Jahren – zunächst mit und dann gegen die Vorstellungen der ersten sozialliberalen Koalition – die höchsten Tarifabschlüsse in der Geschichte der Bundesrepublik. Als sich Schiller mit seinen Auffassungen nicht durchsetzen konnte, trat er 1972 zurück, ohne damit ein Ende der Politik hoher Tarifabschlüsse und erweiterter Sozialausgaben bewirken zu können. 1974 stritt sich Brandt mit den Gewerkschaften, deren militantester Repräsentant damals der ÖTV-Vorsitzende Kluncker war. Dem Vernehmen nach soll Brandt, der im Sommer des gleichen Jahren zurücktrat, nach einer Fraktionssitzung der SPD angesichts der Lohnforderungen der Gewerkschaften lautstark die Frage gestellt haben, „ob er, Brandt, oder Kluncker … eigentlich Bundeskanzler sei.“
Solche Szenen haben sich in der Geschichte der Bundesrepublik nicht wiederholt. Aus der Offensive der Gewerkschaften und ihrer Basis wurde für die folgenden zweieinhalb Jahrzehnte die Defensive. Doch war das kaum darauf zurückzuführen, dass sich Arbeiter und Gewerkschaftsführer in der Bundesrepublik ab Mitte der 70er Jahre darauf beschränkt hätten, „alles auszuhalten und mitzumachen, was ihre Firmen und Staatschef auf die demokratisch-marktwirtschaftliche Tagesordnung setzen“, wie das Decker und Hecker meinen. Vielmehr änderten sich die Bedingungen der Auseinandersetzung um das erwirtschaftete Mehrprodukt bald dauerhaft – bis auf den heutigen Tag.
Mitte der 70er Jahre kam es nicht nur zum Erdölpreisschock und in dessen Gefolge innerhalb eines knappen Jahrzehnts zu zwei Wirtschaftskrisen in der Bundesrepublik, die zu einem seit langem nicht mehr gekannten Anstieg der Arbeitslosigkeit führten. Auf die Dauer gesehen von größerer Bedeutung war, dass Mitte der 70er Jahre mit der Mikroelektronisierung die dritte industrielle Revolution in den Industriestaaten Einzug hielt und damit die für die fordistische Periode in der Wirtschaft der Bundesrepublik charakteristische Konstellation, dass die durch Rationalisierung freigesetzten Arbeitskräfte durch die Ausdehnung der Produktion bzw. des Dienstleistungssektors anderweitig wieder Beschäftigung finden konnten, ein Ende hatte. Permanente Massenarbeitslosigkeit, beschönigend „Sockelarbeitslosigkeit“ genannt, wurde seit Mitte der 70er Jahre zum ständigen Merkmal der Sozialentwicklung der Bundesrepublik. Die Arbeiter sind für das Kapital in einem weit größeren Maße überflüssig geworden als jemals zuvor. Das hat die Realisierungsbedingungen eines „Materialismus von unten, der auf einem anständigen Leben besteht“, natürlich ungemein erschwert.
Derartige objektive Veränderungen in den Kampfbedingungen zwischen Kapital und Arbeit existieren in der Argumentation von Decker und Hecker freilich nicht. Die Klassen und Schichten handeln in ihrem Buch nur entsprechend ihrem Willen und gemäß ihrer Bereitschaft zu Auseinandersetzung bzw. Anpassung. Als wenn es auf der einen Seite, der des Proletariats, an Widerstandsgeist gemangelt habe und die andere Seite, die Vertreter des Kapitals, Entschlossenheit im Übermaß besäßen.
Wenn diese Entschlossenheit sich heute bei den Unternehmern lautstark in Forderungen nach einem rigorosen Sozialabbau manifestiert und auf der Seite von Gewerkschaften bzw. Arbeitern darauf nur defensiv geantwortet wird, dann nicht in erster Linie, weil sich auf der einen Seite des Kapitalverhältnisses die Anpasser und auf der anderen die Kämpfer durchgesetzt haben, sondern weil sich die Rahmenbedingungen für den ökonomischen Klassenkampf für die Arbeiterseite deutlich verschlechtert haben. Das Kapital ist eben auf einen beträchtlichen Teil der Arbeiter und Angestellten nicht mehr angewiesen.
Ausbeutungsbasis schrumpft
Die sich daraus ergebende, auch vom Standpunkt eines „Materialismus von unten“ denkbare Überlegung, das „sozialstaatlich anerkannte und durchorganisierte Monopol der kapitalistischen Arbeitgeber auf ‚Beschäftigung‘“ zu zerschlagen, d.h. den Kapitalismus zu beseitigen, konnte aber schon deshalb nicht ernsthaft verfolgt werden, weil der Realsozialismus als Gegenmodell gerade seit den 70er Jahren deutlich an Attraktivität verlor und bald darauf zusammenbrach. Angesichts dieser Fakten konnte niemandem verübelt werden, dass der bis dahin begangene Weg der Befreiung des Proletariats vom Kapitalverhältnis nicht wieder beschritten wurde.
Decker und Hecker scheinen auch nicht zu sehen, dass faktischer Lohnabbau und die Demontage des Sozialstaates nicht nur das Proletariat in klassischen Arbeitsverhältnissen schrumpfen lassen, sondern auch die quantitative Basis für das Ausbeutungsverhältnis schmälern. Eine Ausbeutergesellschaft, die aus systemischen, konkret aus betriebswirtschaftlichen Verwertungsgründen immer weniger in der Lage ist, im volkswirtschaftlichen Maßstab auszubeuten, der „das lebende Instrumentarium der Kapitalakkumulation“ allmählich abhanden kommt, scheint mir, auch bei Verzicht auf jegliche Umsturzpläne des Proletariats, nicht der Garant für die Stabilität des kapitalistischen Systems in alle Zukunft zu sein.
Auf die Frage, wie es weitergehen soll, findet sich bei Decker und Hecker indirekt nur die Antwort, dass die Arbeiterschaft aufhören soll, immerfort im Kapitalinteresse zu agieren, sich vielmehr gegen dieses wenden sollte, falls sie nach so vielen Jahrzehnten Anpassung dazu überhaupt noch in der Lage ist. Mir scheint bezüglich der Frage nach der Zukunft die von Thomas Kuczynskis in dieser Diskussion geäußerte These sehr bedenkenswert, dass beide, Arbeiter und Kapitalisten, wie die typischen Ausbeuter- und Ausgebeutetenklassen vorkapitalistischer Gesellschaftsformen nicht werden überleben können.
Der Kern des Vorwurfs, den Decker und Hecker dem Proletariat machen, besteht doch wohl darin, dass sie ihre „historische Mission“, ihre Rolle als „Totengräber“ des Kapitals nicht wahrgenommen haben, eine Rolle, die Marx und Engels ihnen zwar zuschreiben, die in der Geschichte aber ohne Parallele und damit zu bezweifeln ist. Dieser Teil der „Arbeiterschelte“ der Autoren würde, so gesehen, dann gegenstandslos. Der andere, dass das Proletariat und seine Organisationen schon seit Jahrzehnten nicht (mehr) gekämpft haben, man sich vielmehr arrangiert hat, stimmt so – nicht nur für die Geschichte der Bundesrepublik – nicht. Kampfbereitschaft und -erfolg hingen in der jüngsten Geschichte wesentlich auch von den Rahmenbedingungen ab, unter denen die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit ausgetragen wurde. Und die haben sich im letzten Vierteljahrhundert für die Arbeiterschaft deutlich verschlechtert.
Was nun nach dem Kapitalismus kommen wird, ist damit noch nicht beantwortet und wohl gegenwärtig auch schwer zu sagen. Ob es eine weltweit auf genossenschaftlichem Eigentum beruhende Ordnung nach dem Vorbild der vor zwei, drei Jahrzehnten noch in Blüte stehenden Kibbuzim in Israel sein wird, wie das Robert Kurz in seiner jüngsten Publikation „Weltordnungskrieg“ sieht, sei dahingestellt. Aber es ist immerhin ein Angebot.
Zuschrift von Robert Steigerwald (Junge Welt vom 5.2.2003)
Das „Prinzip Ohnmacht“ hieß der Titel eines kleinen Taschenbuchs, das vor gut eineinhalb Jahrzehnten im „Weltkreis-Verlag“ erschien. Darin hatte ein gutes Dutzend Autoren sich mit der „Marxistischen Gruppe“ auseinandergesetzt und mittels Analysen von „MG“-Materialien nachgewiesen, dass diese Leute nur ein einziges Credo hatten, man könnte es für abgeschrieben aus Dantes „Göttlicher Komödie“ halten. Über dem Eingang zur Hölle stand geschrieben: „Ihr, die Ihr eintretet, lasset alle Hoffnung schwinden!“ (…)
Was die Beschreibung des Zustands der Arbeiterklasse in den höchstentwickelten kapitalistischen Ländern angeht, so ist gar manches in dem Buch der Zyniker (Peter Decker, Konrad Hecker: „Das Proletariat. Politisch emanzipiert – sozial diszipliniert – global ausgenutzt – nationalistisch verdorben. Die große Karriere der lohnarbeitenden Klasse kommt an ihr gerechtes Ende“) richtig gesehen. Was die Frage angeht, warum das so ist, kriegen wir keine Antwort, wir haben es mit einem typischen Positivismus zu tun, der sich hinter einer gewaltigen „kritischen“ Kulisse versteckt.
Dass die Frage, welche Rolle bei der „Stillstellung“ der Arbeiterklasse (dass es derzeit wieder eine Belebung der Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital gibt, darf ja nicht gesehen werden!) die Arbeiterbewegung, ihre Kämpfe und ihre Niederlage gespielt haben und spielen, wird dem Wesen nach nicht beantwortet und damit die Arbeiterbewegung (ich meine jetzt nicht nur die Sozialdemokratie, auch Kommunisten, zu denen ich gehöre, haben ihren „Anteil“ an dieser Situation) von der Kritik ausgenommen. Es war schon immer das Geschäft des Opportunismus, die Massen verantwortlich zu machen für die Fehler ihrer „Führer“. Ich erinnere an einen Liedtext: „Der Feind, den wir am meisten hassen, der uns umlagert schwarz und dicht. Das ist der Unverstand der Massen, den nur des Geistes Schwert durchbricht.“ Nun ja, da ist nicht alles falsch beschrieben, nicht erklärt, und bei Beschreibungen sollte sich nicht aufhalten, wer verändern will.
Es kommt aber eine letzte Frage: Wie ist es eigentlich zu erklären, dass sich alle relevanten bürgerlichen politischen Kräfte stets dem Ziel verschrieben, der Arbeiterklasse möglichst viel blauen Dunst vorzumachen? Deutet das nicht darauf hin, dass da ein Riese existiert, den man möglichst einlullen muß, damit die bourgeoisen Schätze nicht verlustig gehen? Der Schluß, was zu tun ist, liegt auf der Hand – obwohl, das wissen alle, die auf diesem Gebiet wirken, die Aufgabe elend schwer ist.
Aber gibt es denn eine andere Möglichkeit? Verwiesen wird auf andere soziale Schichten und Kräfte. Man soll sie nicht unterschätzen. Zusammen mit der Arbeiterklasse wären sie die Kraft, den gesamten kapitalistischen Bau umzuwerfen. Nur, was lehrt uns die jüngere Geschichte? Was wurde aus all den Bewegungen des nicht-proletarisch dominierten Protests angesichts der Schwäche der hiesigen Arbeiterbewegung und der historischen Niederlage des europäischen Sozialismus? Wären die „Grünen“ nicht so verrottet, lägen die Dinge auf diesem Gebiet günstiger? Wären „unsere“ Studenten nicht so relativ zahm wie gegenwärtig, gäbe es noch eine stärkere Arbeiterbewegung? Und nehmen wir nicht wahr, wie bereits wieder von führenden Gewerkschaftern versucht wird, die so hoffnungsvolle Bewegung „ATTAC“ zu „zivilisieren“?
Schwierigkeiten und Probleme mögen noch so groß sein, sie können uns die Arbeit nicht abnehmen, das von den Autoren des Buches abgeschriebene Proletariat in Bewegung zu bringen.
Replik auf einige Rezensionen zum Buch: Das Proletariat
Theoretische und praktische Notwendigkeit gegen geschichtsphilosophische Zwangsläufigkeit
Unser Buch hat ein paar Rezensenten gefunden. Das ist schön; weniger schön ist, dass sie zu einem, bis in den Ausdruck hinein gleichlautenden, negativen Urteil kommen. Es setzt sich zusammen aus einem fragwürdigen Lob: eine streckenweise exzellente Beschreibung der Verhältnisse und des Verhaltens jener lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten, die einst unter dem Begriff Proletariat zusammengefasst wurden
(Thomas Kuczynski, „Eine Ent-Täuschung“, JW 17.1.03), Was die Beschreibung des Zustands der Arbeiterklasse in den höchstentwickelten kapitalistischen Ländern angeht, so ist gar manches in dem Buch der Zyniker richtig gesehen.
(Robert Steigerwald JW 5.2.03.) – und einer vernichtenden Absage: Analytisch gibt das Buch also nichts her
(Kuczynski), Was die Frage angeht, warum das so ist, kriegen wir keine Antwort, wir haben es mit einem typischen Positivismus zu tun, der sich hinter einer gewaltigen ‚kritischen‘ Kulisse versteckt
(Steigerwald), Dieses Buch ist noch nicht einmal schlecht, wenn man vom ermüdenden Zweck-Mittel-Klapparatismus der Argumentationen absieht … Nur als Erklärung der Niederlagen der Arbeiterbewegung taugt es nichts.
(Sebastian Gerhardt, „Gut gemeint, schlecht gemacht“, im Neuen Deutschland 17.1.03.) Lob wie Tadel offenbaren Verständigungsprobleme zwischen Autoren und Rezensenten. Wo wir meinen, etwas zu erklären, können sie nur Beschreibungen entdecken; und was sie als Erklärungen gelten lassen würden, finden sie auf unseren 280 Seiten gleich überhaupt nicht. Das hat Ursachen, die nicht an diesem Buch liegen.
Kein Interesse an Notwendigkeit, wo sie vorliegt: Die systembedingte Lage der Lohnarbeiter
Das Buch ist keineswegs eine mehr oder weniger gelungene Schilderung der sozialen Verhältnisse. Wir haben schon Gründe für die Rolle aufgeschrieben, die der moderne Arbeiter in der Welt des Privateigentums spielt, und die Notwendigkeit entwickelt, warum seine Lage genau so unschön gerät, wie die Rezensenten sie beschrieben finden: Lohnarbeiter dürfen die für ihren Lebensunterhalt notwendige Arbeit nur unter der Voraussetzung verrichten, dass sie nicht nur ihre Lebensmittel erwirtschaften, sondern darüber hinaus das Vermögen derer vergrößern, denen die Produktionsmittel gehören. Entsprechend mickrig sieht ihre Entlohnung aus, entsprechend unsicher ist und bleibt das Einkommen, das sie durch die Produktion des Reichtums in fremder Hand erzielen. Der größere Teil des Buches befasst sich mit den durch 150 Jahre Klassenkampf und staatliche Reformen herbeigeführten „sozialen Errungenschaften“, mit denen dem Kapital gegen seine ökonomische Tendenz Rücksicht auf das Überleben der Arbeiterklasse aufgezwungen wurde. Dieselben Errungenschaften zwingen den Arbeitern Versicherungen auf, die einen großen Teil ihres Lohns verstaatlichen und in den Reihen der Arbeiterschaft umverteilen, damit dieser Lohn überhaupt zum Lebens- und Überlebensmittel der Klasse taugt. Sowohl die Schutzgesetze, die zugunsten dieser prekären Erwerbsquelle erlassen wurden, wie die Sozialversicherungen zeugen davon, dass ohne staatlich erzwungene Korrektur der freien Konkurrenz das Kapital seine menschliche Reichtumsquelle vernichten und seine eigene Grundlage zerstören würde; sie verraten aber auch, dass der Sozialstaat diese Rücksichten auf die Überlebensfähigkeit der Arbeiterschaft nur verordnet, um sie dauerhaft auf ihre Rolle als dienstbare Quelle des privaten Reichtums festzulegen. Das Buch tut einiges für den Beweis, dass die Einrichtungen des Sozialstaats keine Wohltaten für Lohnarbeiter sind, sondern notwendige Ergänzungen des kapitalistischen Ausbeutungssystems, um es auf Dauer zu stellen und erst dadurch zur Lebensgrundlage der Nation zu machen. Das alles lassen die Rezensenten als argumentfreie, wenn auch irgendwie korrekte Beschreibung durchgehen, bei deren Lektüre sie sich eher langweilen. Sebastian Gerhardt beklagt einen ermüdenden Zweck-Mittel-Klapparatismus
; so als ob die eintönige Reduktion aller Elemente der proletarischen Existenz auf ihre Funktionalität für den Profit phantasieloser Schriftstellerei und nicht der sozialen Wirklichkeit geschuldet wäre. Vermutlich finden die Rezensenten, die allesamt von irgendeinem Marxismus herkommen, das „beschriebene“ Schlechte selbst unschön, vielleicht sogar kritikabel; sie äußern sich dazu nicht.
Wenn wir aus dem Kritikablen aber eine Kritik an denen machen, die sich diesen Verhältnissen fügen, werden sie böse. Dann fühlen sie sich herausgefordert, die Arbeiter, die das alles mitmachen, vor Einsichten in Schutz zu nehmen, die als Kritik an ihrer Praxis verstanden werden können. Niemand darf ihnen sagen, dass sie sich zu ihrem Schaden auf eine ökonomische Rolle verpflichten lassen, die ihnen nicht gut tut, und dass sie diese schäbige Rolle in einer Weise für notwendig halten, wie sie es nicht ist. – Notwendig ist die Rolle des kostengünstigen Lohnarbeiters mit all ihren Folgen nämlich nur als Konsequenz der Eigentumsordnung. Die selbst ist gar nicht notwendig! – Wer leibhaftige Arbeiter kritisiert, darin stimmen die Rezensenten überein, ist ein schlechter Mensch: Er betreibt Publikumsbeschimpfung, ist selbstgerecht und zynisch. Die braven Arbeiter können unmöglich etwas verkehrt machen, wenn sie ihre Pflichten erledigen!
Notwendigkeit postulieren, wo es keine gibt: Arbeiter können das Kapital nicht bekämpfen, denn sie hängen von ihm ab!
Der Berliner Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler, „Besser als sein Ruf“ (JW 5.2.03), widmet seine Wortmeldung direkt der Ehrenrettung der Arbeiterschaft, die er von unserer Schrift beleidigt sieht. Er versteht sie nämlich so: Da sprechen zwei … einmal offen aus, was dem geschulten Marxisten schon lange durch den Kopf geht und was er offen bzw. öffentlich zu formulieren eine gewisse Scheu hatte: Das Proletariat der kapitalistischen Hauptländer hat sich im 20. Jahrhundert, sozialer und sonstiger Vorteile wegen, mit dem Kapital arrangiert und ist seiner ‚historischen Mission‘, den Kapitalismus zu stürzen, untreu geworden.
– findet bei näherem Hinsehen
aber, dass das gewiss vernichtende Urteil so nicht aufrecht zu halten
ist. Er verteidigt die Arbeiter gegen einen Vorwurf, den er sich gut vorstellen kann, den wir aber gar nicht erheben. Wir hätten nämlich zu ihrem Erfolg gratuliert, wenn es ihnen gelungen wäre, „soziale und sonstige Vorteile“ durch ein Arrangement mit dem Kapital herauszuhandeln. Wir können von diesen Vorteilen nur nichts sehen. Wenn es zum Besten ihres Materialismus wäre, sich aufs Kapital als Lebensgrundlage einzulassen, dann wären Arbeiter tatsächlich schön blöd, ihr Leben dem Idealismus einer „historischen Mission“ zu opfern. Nicht wir werfen dem Proletariat das vor, sondern Roesler selbst teilt den Standpunkt, dass Untreue gegenüber irgendeiner vorgestellten höheren ‚Mission‘, wenn es denn so wäre, dem Proletariat zur Schande gereichte. Deshalb bemüht er sich um den Nachweis, dass es so mitmacherisch, wie behauptet, nicht unterwegs, das „vernichtende Urteil“ also „so“ nicht zu halten sei. Für seine Korrektur geht er die Geschichte der BRD nach 1945 durch, besteht darauf, dass es gewerkschaftliche Kämpfe und Erfolge gegeben hat, freilich im Lauf der Jahrzehnte immer weniger. Doch war das kaum darauf zurückzuführen, dass sich Arbeiter und Gewerkschaftsführer ab Mitte der 70er Jahre darauf beschränkt hätten, ‚alles auszuhalten und mitzumachen, was ihre Firmen- und Staatschefs auf die demokratisch-marktwirtschaftliche Tageordnung setzen‘, wie das Decker und Hecker meinen. Vielmehr änderten sich die Bedingungen der Auseinandersetzung dauerhaft.
Er führt die mikroelektronische Revolution an, steigende Arbeitsproduktivität und das kapitalistische Ergebnis dieses Segens: wachsende Massenarbeitslosigkeit. Der Wirtschaftshistoriker sagt gerade heraus, dass der gewerkschaftliche Kampf, der das Interesse der Kapitalisten an profitbringender Arbeit als Hebel des Lohninteresses benutzen will, tatsächlich sich zur abhängigen Variablen der Akkumulation des Kapitals macht und dass es diese Abhängigkeit ist, die „die Despotie des Kapitals über die Arbeit vollendet“, wie Marx sagt. Je mehr Überbevölkerung das Kapital mit seinem Produktivitätsfortschritt schafft, desto kraftloser die gewerkschaftliche Gegenwehr gegen sinkende Löhne. Diese Wahrheit halten wir für das Argument für die praktische Notwendigkeit der Revolution, Roesler führt sie als Grund dafür an, dass die Arbeiter sich nicht wehren können , also, so sein Schluss, recht getan haben mit ihrer beschränkten gewerkschaftlichen Vertretung – und rechtfertigt damit gleich noch die Praxis der deutschen Gewerkschaften, die es noch nicht einmal auf den Versuch einer Gegenwehr ankommen lassen, sondern die Überlegenheit des Kapitals antizipieren und schon vorweg als ökonomische Sachlage in Forderungen und Verhandlungspositionen einarbeiten.
Damit nicht genug. Prof. Roesler kennt einen weiteren Grund, warum die „denkbare“ Abschaffung des Kapitalismus nicht wirklich werden kann: Die denkbare Überlegung, … den Kapitalismus zu beseitigen, konnte schon deshalb nicht ernsthaft verfolgt werden, weil der Realsozialismus als Gegenmodell gerade seit den 70er Jahren deutlich an Attraktivität verlor und bald darauf zusammenbrach. Angesichts dieser Fakten konnte niemandem verübelt werden, dass der bis dahin begangene Weg der Befreiung des Proletariats vom Kapitalverhältnis nicht wieder beschritten wurde.
Ja wenn das einzig existente Gegenmodell in Gestalt des realsozialistischen Staatenblocks nichts taugt, dann wundert sich jedenfalls Roesler nicht darüber, dass die Arbeiter trotz radikal verschlechterter Rahmenbedingungen des ökonomischen Klassenkampfs
mit dem System vorlieb nehmen, in dem sie um aushaltbare Arbeit und ausreichende Entlohnung immerzu und mit schwindendem Erfolg kämpfen müssen. Er lässt sich da eine sehr grundsätzliche, allerdings auch sehr konstruierte Absage an Kritik und Gegenwehr einleuchten: Die ehrliche Überprüfung von Vor- und Nachteilen der realsozialistischen Wirtschaft fürs Arbeiterinteresses hat es nämlich nie gegeben. Wäre da nicht der unbegründete Stolz auf die eigene Lebensweise, die man zwar nicht herausgesucht, dafür aber um so entschlossener „angenommen“ hat, hätte es dazu nicht noch den nationalistischen Hass auf die „Spalter-Republik“ und die „Fremdherrschaft der Sowjets“ gegeben, dann hätte ein ost-westlicher Systemvergleich weder vor noch nach den 1970 so eindeutig ausfallen können, wie er ausgefallen ist. Zweitens ist es weder realistisch noch vernünftig sich vorzustellen, Lohnarbeiter, die ihr Ausgebeutet-Werden satt haben, würden an gar nichts anderes denken als eine andere Herrschaft und sich erst einmal im Warenhaus der politischen Systeme umschauen, ob Besseres im Angebot ist, – und von ihrer Kritik wieder Abstand nehmen, wenn sich niemand meldet, der verspricht, es ihnen besser zu richten; d.h. sie arbeiterfreundlicher zu regieren. Da wird deutlich, was für führungsbedürftige Untertanen Roesler sich mit abgrundtiefem Verständnis als die verhinderten Revolutionäre vorstellt, die sich durchs schlechte Staatsvorbild von ihrem Vorhaben abbringen lassen. Ein bisschen hat Revolution schon mit der Einsicht zu tun, dass die eigene schlechte Lage nicht an und für sich, sondern nur zum Nutz und Frommen eines fremden und feindlichen Interesses nötig ist. Die Frage, ob „es“ auch anders gehen kann, kommt da gar nicht auf! Zweitens entsteht eine revolutionäre Bewegung nicht aus dem Wunsch nach einer gerechteren Obrigkeit, sondern aus dem Willen, eine schädliche Abhängigkeit abzuschütteln und die eigenen Angelegenheiten zusammen mit Gleichgesinnten in die eigenen Hände zu nehmen. Wie war das eigentlich mit den ersten Sozialisten im 19. Jahrhundert, später mit Lenin und Zeitgenossen? Wie konnten die das Kapital ablehnen und bekämpfen, ohne dass ein funktionierendes Gegenmodell etabliert gewesen wäre, das ihnen ein Angebot alternativer Gefolgschaft gemacht hätte? Aber solche Gedanken sind der DDR-Intelligenz wahrscheinlich nicht erst heute fremd; sie wollte auch in besseren Zeiten die wahrhaft volksfreundlichen und sozialen Staatenlenker stellen, die im Gegensatz zu verlogenen bürgerlichen Politikern das Vertrauen und den tätigen Gehorsam der braven Arbeiter echt verdienen. Solche Arbeiter mögen sie; für deren Ehre werfen sie sich gegen Kritik wie die unsere in die Bresche: Niemand, so Roesler, dürfe es Arbeitern verübeln, wenn sie sich angesichts eines unattraktiven Gegenmodells von ihrem „Modell“ in Gestalt kapitalistischer Unternehmer und eines dem kapitalistischen Konkurrenzerfolg seiner Wirtschaft verpflichteten Staats alles bieten lassen. Wir aber haben es nicht mit der Ehre des werten Arbeitsvolks und verwechseln deshalb Kritik auch nicht mit der Bestreitung der Ehrenhaftigkeit des kritisierten Standes. Wir erlauben uns nur darauf hinzuweisen, dass die Arbeiter sich mit der Roeslerschen Klugheit – nur dann um Lohn etc. zu kämpfen, wenn die Rahmenbedingungen bestens sind, wenn Arbeit fürs Kapital also so lohnend und so knapp ist, dass die Kapitalisten schon fast von selbst Konzessionen machen – nur schaden.
Während Roesler Gründe wüsste, warum Arbeiter sich wehren sollten, aber noch stärkere Gründe dafür weiß, dass sie das nicht können, ist Thomas Kuczynski weiter. Er „konstatiert“ die in unserem Buch behandelte Eingemeindung des Proletariats in den Kapitalismus „ganz nüchtern“ als „historischen Sachverhalt“ und tut so, als folgte aus dem Verschwinden der systemkritischen Arbeiterparteien und Bewegungen ganz zwanglos, dass es für so etwas auch keine Gründe mehr gibt. Weil die modernen Arbeiter die Verelendungsprognose des kommunistischen Manifests in schweren Klassenkämpfen selbst widerlegt
haben – Arbeiter in Europa also tatsächlich Essen, Wohnung, Autos und Fernseher ihr eigen nennen –, haben sie sich, Kuczynski zufolge, auch schon zu Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft ‚herangearbeitet‘. Dieser historische Sachverhalt kann und muss ganz nüchtern konstatiert werden, ohne dass das Verhalten des Proletariats in der Weise denunziert wird, es ‚habe Karriere gemacht‘
. Es ist eben die Frage, ob „sich zum Mitglied heranarbeiten“ heißt, dass die Besitzlosen ihre miese Lage als Eigentümer der Ware Arbeitskraft akzeptiert, oder sich tatsächlich in Hinblick auf Einkommen und materielle Sicherheit an den Stand der besitzenden Bürger herangearbeitet haben. Kuczynski ersäuft den Unterschied in seinem uneindeutigen „Heranarbeiten“, zieht aber ganz eindeutige Folgerungen daraus: Dass die Mitglieder der Klasse des Proletariats sich zu Mitgliedern der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ‚herangearbeitet‘ haben, dies verhindert den weiteren Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat … (nicht). Es ist allerdings Ausdruck dafür, dass der Kampf allein innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise stattfindet und demzufolge nicht auf die Überwindung der kapitalistischen Klassengesellschaft zielt.
Mit dem Gestus des strengen Wissenschaftlers unterschiebt Kuczynski den Fakten seine gar nicht selbstverständliche Bewertung. Die logische Schwindelkategorie „Ausdruck“ tut da gute Dienste: Dass sich die Arbeiter ‚herangearbeitet‘ haben, gilt ihm als Ausdruck dafür, dass sie innerhalb der Produktionsweise – wo sonst? – kämpfen und – wieso eigentlich – „demzufolge“ nicht auf die Überwindung des Systems zielen. Mit dem Ausdruck „Ausdruck“ vermeidet er die Entscheidung darüber, ob nun Wohlstand und Saturiertheit der Proletarier Grund dafür sind, dass sie die – überwundene – Ausbeutungsordnung nicht mehr bekämpfen müssen, oder ob das Faktum, dass sie es nicht mehr tun, für ihn der wahre Beweis ihres Wohlstands ist. Worauf er hinaus will, ist schon klar. Denn, wenn er auch nicht direkt sagen will, dass die Arbeiter allen Grund haben, für ihr Vaterland einzutreten, weil sie mit ihm viel zu verlieren hätten, kann er den heutigen Arbeiternationalismus doch ganz gut als eine Form rationaler Interessenverfolgung „verstehen“. „All das, was das Proletariat an Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen erkämpft hat, das Arbeits- und Tarifrecht, die Sozial-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, Urlaubsansprüche etc., macht das aus, was heutzutage Sozialstaat genannt wird und in der Tat juristischer Kodifizierung im nationalstaatlichen Rahmen bedurfte. Es ist also kein Wunder, wenn Arbeiter diesen Sozialstaat genannten Klassenkompromiss mit Klauen und Zähnen gegen äußere Bedrohungen verteidigen und ihnen – angesichts der ihren
(nationalen) Sozialstaat in Frage stellenden Europäischen Union, der fortschreitenden Internationalisierung und Globalisierung des Wirtschaftslebens – Verhaltensweisen internationalistischer Solidarität weitgehend abhanden gekommen sind. Das entschuldigt weder Nationalismus noch Fremdenfeindlichkeit, erklärt aber ein Stück weit ihr gerade in jüngster Zeit verstärktes Auftreten, erklärt, warum Arbeiter glauben können, ein Vaterland zu haben.“
Auch wenn Kuczynski es nicht verstehen wird, muss an ein paar Unterscheidungen erinnert werden: Erstens zeigen Arbeiter, die sich nichts wegnehmen lassen und im nationalstaatlichen Rahmen – wo sonst? – für Lohn, Rente usw. kämpfen, weder Glauben ans Vaterland noch Verantwortung für es – und sie werden von diesem auch durchaus nicht so verstanden. Wenn umgekehrt Arbeiter sich dafür hergeben, die deutsche Konkurrenzfähigkeit, den Wirtschaftsstandort und das Gewicht ihrer Nation in Europa und der Welt zu verteidigen, dann tun sie dies zweitens mit Opfern an Lohn und Lebensstandard und „verteidigen“ auf diese Weise keineswegs irgendwelche erkämpften Errungenschaften. Wenn sie ausländische Kollegen für Arbeitslosigkeit und schlechte Löhne verantwortlich machen, dann werden sie drittens sehr eindeutig als Deutsche und nicht als Lohnarbeiter giftig und wollen ihrem Staat die Last von unnützen Fressern ersparen, die ökonomisch gesehen ihresgleichen sind. Das alles wird nichts nützen, denn Kuczynski will nun einmal den proletarischen Nationalismus nicht erklären und – das schließt das Erklären eines Fehlers allemal ein – kritisieren, sondern eben „verstehen“. Dafür kommt ihm der Minderheitsnationalismus der Globalisierungskritiker gerade recht, der den Fehler explizit macht und allen Ernstes die Instrumente der (inter-)nationalen Wirtschaftskonkurrenz (Zölle, Subventionen und andere Handelshemmnisse) zu Lebensmitteln der Massen umwertet. Übrigens entschuldigt Kuczynski den Arbeiter-Nationalismus damit schon – denn wenn der tatsächlich ein logisches, der materiellen Lage angemessenes Interesse deutscher Proletarier ist; wenn sie in seiner Verfolgung nichts falsch machen, dann wären „Verhaltensweisen internationalistischer Solidarität“ ja wohl ein realitätsfremder moralischer Luxus, den sich nur Spinner materielle Nachteile kosten lassen.
Wie schön die Geschichtsphilosophie des „Histo-Mat“ zur Trost- und Versöhnungslehre taugt!
Genau so aber scheinen sich die Rezensenten das „revolutionäre Subjekt“ vorgestellt zu haben: Ein edles Kollektiv von Idealisten, die zwar von ihren materiellen Interessen her allen Grund hätten, ihre Lohnarbeiter-Rolle zu spielen, aber wegen ihrer hohen Motivation die Vorteile dieser feinen Gesellschaft ausschlagen und sich einer Mission widmen, die ihnen die Weltgeschichte höchst persönlich durch ihren Propheten Marx angetragen hat. Seien unsere Rezensenten selbst Anhänger der marxistisch-leninistischen Religion gewesen oder als Nachgeborene mit deren abstrakter Negation ins Politisieren eingestiegen, heute sind sie jedenfalls geheilt und wundern sich kein bisschen mehr darüber, dass der Arbeiter so blöd idealistisch, wie ihn frühere Sozialisten sehen wollten, nicht ist. Wenn der Arbeiter aber Materialist ist, das ist ihnen völlig klar, beugt er sich „realistisch“ der Macht fremden Eigentums und streckt sich nach der kapitalistischen Decke, soweit das überhaupt geht. Wundern müssen sich die geläuterten Realsozialisten daher einzig über uns; wir erscheinen ihnen als Geistesverwandte ihres abgelegten Glaubens und handeln uns den Vorwurf ein, von alten Illusionen nicht ebenso gefasst Abschied zu nehmen wie sie.
Roesler: „Der Kern des Vorwurfs, den Decker und Hecker dem Proletariat machen, besteht doch wohl darin, dass sie ihre ‚historische Mission‘, ihre Rolle als ‚Totengräber‘ des Kapitals nicht wahrgenommen haben, eine Rolle, die Marx und Engels ihnen zwar zuschreiben, die in der Geschichte aber ohne Parallele und damit zu bezweifeln ist.“
Kuscynski: „Denn eine Abrechnung mit dem Proletariat und dessen Glorifizierung ist das Buch in jedem Fall, unausgesprochen vielleicht auch eine mit sich selbst, mit früheren Irrtümern, denn die Verve, mit der sie geschrieben haben, scheint auch aus dem Ärger gespeist, damals, als man noch Mitglied der ‚Marxistischen Gruppe‘ war, einem Irrglauben aufgesessen zu sein. … Der Abschied von der im Manifest formulierten Utopie fällt schwer, um so schwerer, als „Ersatz“ für das abhanden gekommene – vielleicht nie dagewesene? – revolutionäre Subjekt nicht in Sicht zu sein scheint.“
Noch einmal: Wir wissen nichts von einer schönen Utopie und nichts von einer historischen Mission. Nicht wir haben die Arbeiter mit der antimaterialistischen Phrase hofiert, sie seien das von der Weltgeschichte auserwählte Kollektiv, beauftragt, die Menschheit ins diesseitige Paradies zu führen. Wir haben uns von diesem Unsinn auch nicht zu verabschieden. Ein revolutionäres Subjekt war nie in dem Sinn „da gewesen“, dass hoffnungsschwangere Zukunftsjünger sich an es hätten anhängen, an es appellieren und sich um seine Führung hätten streiten können. Arbeiter müssen sich selbst dazu bereit finden und organisieren, die kapitalistischen Verhältnisse und den bürgerlichen Staat umstürzen, wenn sie es vorteilhaft finden, ihre Rolle als Kostenfaktor Arbeit zu kündigen und sich eine nützlichere Organisation der Arbeit und ihrer Teilung zu schaffen. Wenn nicht, dann lassen sie die Revolution eben bleiben und spielen weiterhin ihre schäbige kapitalistische Rolle. Geschulte Marxisten haben für diese Entscheidung lediglich ein paar „Bildungselemente“ und Unterstützung beizusteuern.
Historische Materialisten, die bei Honecker und Breschnew in die Schule gegangen sind, haben die Sache immer anders gesehen: Ihr geschichtsphilosophischer Optimismus hat ein Jahrhundert lang den Sturz des Ausbeutungssystems als unvermeidliches, quasi mechanisches Produkt des Geschichtsgangs beschworen, die Arbeiterschaft als dessen auserwählten Exekutor vorstellig gemacht und die Menschen damit geködert, sie sollten sich dem unaufhaltsamen historischen Trend besser rechtzeitig anschließen. Ausgerechnet den Umsturz der sozialen Welt, den die Arbeiter machen sollten, empfahlen sie ihnen als Anpassungsleistung, sozusagen als klugen Opportunismus gegenüber dem unvermeidlichen Gang der Geschichte; und sie warben dafür mit ihrer Gewissheit, dass die Arbeiter diesen Realismus auch zweifellos aufbringen würden, sobald die Zeit dafür reif wäre. Wenn die Rezensenten in unserem Buch Gründe für die Niederlagen der Arbeiterbewegung vermissen, dann müssen wir uns im 2. Kapitel (S.29-89 – Eine Geschichte von Klassenkämpfen) wohl zu höflich ausgedrückt haben: An ihrem eigenen Denken und der Tradition aus der sie stammen, haben sie nicht den unwichtigsten dieser Gründe. Die Wissenschaft der einst realen Sozialisten besteht seit über 100 Jahre nicht in der Erklärung der Funktionsweisen des Kapitalismus und seiner notwendigen Folgen, sondern in Einschätzungen der Reife der objektiven Widersprüche
und der Entwickeltheit
des revolutionären Klassenbewusstseins. Auch die Vorväter unserer Rezensenten haben Kritik an Arbeitern, Gewerkschaften und Parteien nicht nur nicht betrieben, sondern verboten, wo sie nur konnten. Man hatte die jeweilige Politisierung, die Bereitschaft oder Nicht-Bereitschaft zu Streiks etc. als Ausdruck der Entwicklung der Klassengegensätze zu akzeptieren und die Damen und Herren Arbeiter bei ihrer Entwicklung nicht durch Argumente zu stören oder gar zu verschrecken. Arbeiterführer von SPD, KPD, DKP etc. warteten geduldig auf die revolutionäre Situation; zur Vorbereitung darauf suchten sie sich bei den Objekten ihrer Verehrung beliebt zu machen, indem sie das, was an Unzufriedenheit mit den Zuständen unterwegs war, begrüßten, in ihrem Sinne interpretierten, und als angemessenen Ausdruck des revolutionären Entwicklungsstadiums gut hießen, an dem sich sozialistische Politik zu orientieren hätte. Dafür kämpften sie erbittert gegen Leute, die sich damit nicht zufrieden gaben. Wer einen Kurs nicht mitmachen wollte, der nie durch Beweise seiner Zweckmäßigkeit begründet, sondern mit der Versicherung, er entspreche exakt der gerade angesagten Etappe des Klassenkampfs, der Beurteilung entzogen wurde, fing sich, wenn nicht Schlimmeres, eine Verdammung als Linksabweichler und Spalter ein, der die Einheit der Arbeiterbewegung bewusst schwächt – also im Sold der Reaktion steht. Eine Mehrheit hat sich schließlich mit Berufung auf den Willen und Bewusstseinsstand der Arbeiter vom Kritiker und politischen Gegner der Verhältnisse zu ihrem engagierten Mitgestalter vorangearbeitet, hat an der Arbeiterschaft das ‚deutsche‘, also ihre Staats-Zugehörigkeit hochgehalten und schließlich im Namen des ganzen guten Volkes als ‚Reform‘-Politiker Verantwortung für den kapitalistischen Staat übernommen…
Wenn kritische Erben und Verehrer dieser ‚Traditionen der Arbeiterbewegung‘ auch heute wieder Kritik an Arbeitern und ihren Organisationen als Unverschämtheit zurückweisen, dann ohne den hoffnungsvollen Zusatz, diese befänden sich schon von selbst auf dem richtigen revolutionären Weg. Geblieben ist nur noch die Parteinahme für die Anpassung der Proletarier an ihre unerquicklichen Lebensbedingungen und das strikte Beharren darauf, dass diese Anpassung unvermeidlich ist. Dafür genügen unseren Rezensenten noch nicht einmal die Gründe, die sie oben selber anführen; sie werden philosophisch und fordern eine ebenso unwidersprechliche, absolute Notwendigkeit für die Nicht-Revolution wie sie ihre Altvorderen für den Sturz des Kapitalismus verkündet hatten. Weil das in unserem Buch nicht zu finden ist, ist es „analytisch wertlos“, und fehlt es seinen Autoren an der Selbstkritik, die realsozialistische Konvertiten seit der „Wende“ so gut beherrschen.
Kuczynski: „Die Verfasser sind jedoch weit entfernt von aller Selbstkritik . … Ihre ‚methodische Nachbemerkung zum notwendig falschen Bewusstsein des Proletariats‘ belegt das in aller Deutlichkeit. Sie fragen: ‚Warum machen die Lohnarbeiter mit in einem Gemeinwesen, das sie systematisch zur Manövriermasse des kapitalistischen Eigentums und des dazugehörigen allgegenwärtigen staatlichen Gewaltapparats degradiert?‘ und stellen fest: ‚Die Antwort ist bereits gegeben. Es gibt dafür keine anderen ‚Ursachen‘ als die schlechten Gründe, die die Leute haben. …‘ Tja, wenn die Ursachen nichts anderes als die schlechten Gründe der Leute sind – wie klug war da doch Fritz Reuters Onkel Bräsig, als er meinte, die Armut käme von der Powertee …“
Verkehrte Auffassungen über die Rolle, die Lohnarbeiter zu spielen haben, und über die Mittel, die ihnen für ihre Interesse zur Verfügung stehen, lässt Kuczynski nicht als Erklärung dafür gelten, dass Arbeiter sich in diese Rolle schicken. Das wären ja Irrtümer, die – das sagt schon das Wort – korrigiert werden können, und nicht die unentrinnbar objektiven Ursachen, die er fordert. Weil die nicht geboten werden, sieht er gleich gar kein Argument, sondern ein leeres Spiel mit Worten. Als ob wir bestreiten würden, dass die Lohnabhängigen vom Staat unter die Gesetze des Eigentums gezwungen und dadurch abhängig gemacht werden von Unternehmern, die sie gemäß ihren Profitkalkulationen arbeiten und einen Lohn verdienen lassen oder nicht. Das ist ein Faktum, ein Produkt von Gewalt, selbstverständlich kein Fehler, sondern ein Zwang, der auch nicht gleich aus der Welt wäre, wenn er nicht die Billigung derer genießen würde, denen er gilt. Wenn die Lohnarbeiter den aufgezwungenen Dienst am Kapital als Lebensgrundlage zu nutzen versuchen, werden sie zu Kalkulationen von Aufwand und Ertrag, Qualifikationserwerb und Beschäftigungssicherheit genötigt, die verkehrt sind, weil sie mit ihren Leistungen und Vorleistungen tatsächlich nichts in der Hand haben, in Wahrheit gar nicht kalkulieren können, kein Mittel ihres Interesses haben, sondern Mittel fremden Interesses sind. Die praktische Nötigung muss die Betroffenen allerdings nicht daran hindern, sich ein nüchternes Bild von der ökonomischen Rolle zu machen, die sie behandeln müssen, als wäre sie ein für sie eingerichtetes Erwerbs- und Lebensmittel. Wenn sie aber, bloß weil sie kein besseres haben, Lohnarbeit als ihr Lebensmittel wert schätzen, auf seine Tauglichkeit hoffen und sich für die Bedingungen seines Funktionierens stark machen, dann hegen sie unerfüllbare Hoffnungen, machen sich falsche Vorstellungen vom Geben und Nehmen, sowie von Rechten und Pflichten zwischen ihnen und den Unternehmern. Mit solchen Vorstellungen legt sich der Mensch seinen Dienst am feindlichen Interesse als Verwirklichung seiner Freiheit zurecht und macht seinen Frieden mit der ihm aufgezwungenen Praxis. Diesen Selbstbetrug nennen wir „schlechte Gründe“. Ausgerechnet für Fehler, gegen die wir den lesenden Arbeiter einnehmen wollen, fordert Kuczynski eine so unbedingte Kausalität, dass von einem falschen Gedanken, den man auch lassen könnte, gar nicht mehr gesprochen werden kann. Seine Forderung erfüllt er sich selbst und liefert die ganze „Analyse“ nach, die er bei uns vermisst.
„Das klingt natürlich alles unerhört revolutionär, ist aber nichts als voluntaristische Kritik, der Ärger darüber, dass das Proletariat sich anders verhalten hat und verhält, als Wille und Vorstellung der Verfasser verfügt haben. Klassen haben keine Wahl, sondern eine historische Funktion, die wissenschaftlich und ohne moralisierendes Beiwerk zu analysieren ist. Allenfalls haben einzelne Mitglieder einer Klasse die Möglichkeit, die eine oder andere Wahl zu treffen.“
Auf diese Entgegensetzung – keine Wahl, sondern eine Funktion – muss man erst einmal kommen! Da hat Kuczynski ein Buch vor sich, das vorwärts und rückwärts die beschissene historische Funktion der Arbeiterklasse als eine aufgezwungene Lage erläutert, die man sich nicht bieten zu lassen braucht – und dann „schließt“ er aus „Funktion“, dass ihre Opfer ihr nicht entrinnen können; allenfalls einzelnen erlaubt er, sich aus ihrem angestammten Kollektiv davonzustehlen wie dereinst Engels aus den Reihen der Kapitalisten. Für die Masse ist die historische Funktion Schicksal! Solche Predigten zum gottergebenen Hinnehmen der Realität, „weil sie nun einmal so ist“, sind wir eigentlich von anderen, von den „am meisten reaktionären Kreisen der Bourgeoisie“ gewöhnt.
Sebastian Gerhardt stößt ins gleiche Horn und liefert seinerseits höchst absolute „Gründe für die Niederlagen der Arbeiterbewegung“, wie er sie bei uns vergeblich sucht: „Den Verfassern geht es um die weitergehenden Versuche, den Kapitalismus zu verändern. Und die Gründe für die Niederlagen dabei finden sie im unzureichenden Veränderungswillen der Revolutionäre oder in ihrer falschen ‚Kritik der politischen Ökonomie und am dazugehörigen demokratischen Herrschaftssystem‘. Das negative Pathos der Autoren entspringt einer eigenwilligen Geschichtsphilosophie: der Überzeugung, dass alles anders ginge, wenn man nur wollte. Abgesehen von der politischen Gewalt des bürgerlichen Staates lassen sie kein objektives Hindernis für die baldige Umsetzung des Vorhabens gelten, ‚die Welt planwirtschaftlich zu revolutionieren‘. Als Ursache für die bisher ausgebliebene Revolutionierung können sie denn auch nur eine moralische Unterscheidung anbieten: Die Leute ließen sich von allerlei ‚schlechten Gründen‘ leiten.“
Wie dem Pfaffen alles Religion ist dem Geschichtsphilosophen eben alles Geschichtsphilosophie – auch die glatte Abwesenheit jeder Spekulation über höhere, subjektlose Gesetze des Geschichtsverlaufs. Ist es wirklich so schwer, einzusehen, dass jeder, der das Wort erhebt und anderen Leuten seine Gedanken mitteilt – auch ein Rezensent, der vor schlechten Büchern warnt – davon ausgeht, dass er seine Adressaten, wenn er ihnen einsichtige Gründe bietet, von ihrer vorgefassten Meinung und, sofern das geboten ist, von unzweckmäßigem Handeln abbringt? Wäre es nicht so, könnten sich auch Rezensenten ihre Mühe sparen und stumm dem ohnehin unabänderlichen Lauf der Geschichte zusehen. Aber nein, Sebastian Gerhardt schreibt und redet – und das um eine absolute Unfreiheit des Menschen angesichts gesellschaftlicher Objektivität zu propagieren: Nichts lässt sich anders machen, ob Leute es nun wollen oder nicht! Für diese Botschaft weiß er keinerlei sachlichen Grund, dafür aber ein Dogma der bürgerlicher Soziologie anzuführen: Er hält es nämlich für abseitig, eine kommunistische Produktion
einzurichten, die … das Mittel für einen ihr vorausgesetzten Zweck, ‚die Befriedigung der Bedürfnisse‘ (ist). Es genügt aber nicht, die gute Absicht zum ökonomischen Grundgesetz zu erklären. Produktionsverhältnisse resultieren aus dem wechselseitigen Verhalten der Menschen, dessen Ergebnis nicht auf subjektive Setzung zu reduzieren ist. Auch eine planende Gestaltung hebt die Objektivität der Verhältnisse nicht auf, sondern setzt sie voraus.
Die Produktionsverhältnisse, mit denen wir es zu tun haben, resultieren keineswegs – so die beschönigende soziologische Vorstellung – aus einer Wandlung, die auf irgend eine geheimnisvolle Weise allseitige Subjektivität zur harten, die Subjekte unterjochenden Objektivität werden lässt. Sie beruhen auf der ständig reproduzierten Trennung der Arbeit von der Verfügung über die Produktionsmittel, die als Privateigentum als Mittel der Vermehrung des Reichtums in der Hand der Geld- und Produktionsmittelbesitzer fungieren, also auf der dauerhaft präsenten staatlichen Gewalt, die diese Eigentumsverhältnisse aufrecht erhält und schützt. Der Rezensent sieht es anders: Er bedenkt Kritik an diesen Produktionsverhältnissen mit dem Vorwurf, eine „gute Absicht“ zu verfolgen und etwas „subjektiv setzen“ zu wollen – kurz: die Objektivität zu missachten. Als ob, wer den Kapitalismus kritisiert, und gar, wer ihn bekämpft, seine „Objektivität“ nicht „voraussetzen“ und sich etwa über sein Vorhandensein täuschen würde, meint Gerhart an die Objektivität der Verhältnisse erinnern zu müssen. Tatsächlich führt er gegen Kritik die kritisierte ‚Objektivität‘ als Argument ins Feld. Kritik ist demnach unwissenschaftlich – „bloß subjektiv“, „voluntaristisch“, „moralisch“ eben. Ein moralisches Argument – der Appell an geteilte, aus Eigennutz aber stets zu wenig befolgte Werte und Ideale – ist zwar so etwa das Gegenteil der Argumente, die unser Buch anbietet, – Klarstellungen darüber, wie Lohnarbeiter zum Mittel des Kapitals gemacht werden und wie dabei ihre materiellen Interessen auf der Strecke bleiben –; aber das ändert nichts: „Moralisch“ bedeutet bei Gerhard wie bei Kuczynski immer nur „willentlich“ im Gegensatz zu: „an der Objektivität orientiert“.
Ihre Entgegensetzung von wissenschaftlicher ‚Objektivität‘ und Kritik gibt Auskunft darüber, was von der verkehrten Geschichtsmetaphysik des „Historischen Materialismus“ übrig geblieben ist. Seine Anhänger haben mit theoretischer und praktischer Kritik noch nie viel anfangen können – auch wenn die Überschrift des Hauptwerks von Marx, auf das sie sich berufen, nichts als Kritik verspricht. Historische Materialisten haben weder den schlechten Realismus proletarischer Anpassung, noch die kapitalistische Produktionsweise selbst groß kritisiert; lieber haben sie ihren Untergang und den Aufstieg des Proletariats prognostiziert; sozusagen den Geschichtsverlauf die Kritik der Verhältnisse erledigen lassen. Nachdem der die erwartete Leistung schuldig geblieben ist, haben sie ihre Hoffnung auf den Untergang des Kapitalismus gestrichen; nicht aber ihren Glauben an die Unwidersprechlichkeit des Geschichtsprozesses. Wissenschaft schätzen sie als „Einsicht in die Notwendigkeit“, wobei sie den gesellschaftlichen Verhältnisse mit der Vorstellung vom ‚ehernen Gang der Geschichte‘ einen quasi naturgesetzlich unausweichlichen Charakter verleihen. Es ist ja schon dumm genug, immerzu auf dem unausweichlich vorgegebenen Charakter von Naturgesetzen wie einer großartigen Erkenntnis herumzureiten, wenn die praktische Freiheit und der Fortschritt der feinen Menschheit – ihre Beherrschung der Natur – gerade darin beruht, diese Gesetze selber zu kennen, sich ihnen anzupassen und ihre Kräfte für seine Zwecke, egal wer sie gesellschaftlich bestimmt und wie sie bestimmt sind, wirken zu lassen. Ganz verkehrt aber ist es, bei der Erklärung der Notwendigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse immerzu zu betonen, dass sie ‚notwendig‘ und keineswegs ‚willkürlich‘ sind und damit die Vorstellung einer den Naturgesetzen entsprechenden Determination allen gesellschaftlichen Treibens breitzutreten. Ausgerechnet so jemand nimmt dann andererseits die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten, also die – kritikable – Notwendigkeit hiesiger Verhältnisse überhaupt nicht ernst, sondern hat viel Verständnis für den Fehler, sich vom Kapitalismus dessen notwendige Wirkungen, Arbeitslosigkeit, Verelendung etc., wegzudenken, ohne deren Ursachen abschaffen zu wollen. Kein Wunder, meint so jemand mit ‚Einsicht in die Notwendigkeit‘ doch allemal Anpassung an die gegebenen Verhältnisse und Kräfteverhältnisse, also das Gegenteil von Einsicht in deren Notwendigkeit. Die nämlich führt unweigerlich auf die Frage, ob man sich deren Ursachen – allemal mit Gewalt geschaffene Macht- und Ohnmachtspositionen – bieten lassen oder ob man sie und damit die unerquicklichen Wirkungen bekämpfen will und sich dabei über die praktischen Konsequenzen dieses Willens nichts vormacht.
Wenn Kuczynski und Gerhard alles andere als die praktische Anerkennung der Welt, wie sie nun einmal ist, alles andere als das Sich-Einrichten in ihr als ‚subjektivistische‘ Traumtänzerei verwerfen; wenn sie Wissenschaft und „Analyse“ als Plädoyer fürs Sich-Abfinden mit der „Realität“ verstanden wissen wollen, dann fühlen wir uns mit der alt-kommunistischen Verdammungsformel „Voluntarismus“ nicht schlecht bedient. Ja, uns geht es darum, die Einsicht in die Funktionsweise und die Resultate der kapitalistischen Wirtschaft und dadurch den Willen zu ihrer Abschaffung zu befördern. Oder meinen die Rezensenten wirklich, dass der alte Marx sein Leben in der Bibliothek des British Museum verhockt hat, damit einmal einer den Arbeitern so richtig kompetent mitteilen kann, dass sie keine Wahl haben?