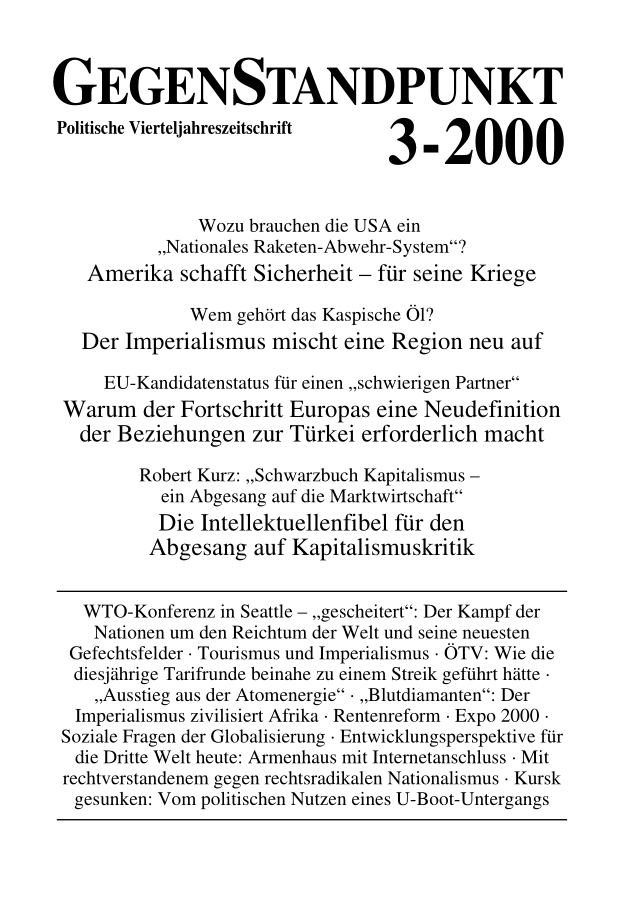Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Rentenreform kommt voran:
Der überfällige „Abschied von Lebenslügen“ oder „Das Ende der Sozialromantik“
Nicht, dass die Zwangsbewirtschaftung des Lohns der Arbeitenden fürs Überleben der Alten ganz abgeschafft werden soll. Sie sollen bloß ein Stück mehr Nettolohn in die „private Vorsorge“ stecken, damit die Sozialrenten sinken und die Arbeitgeber „Lohnnebenkosten“ sparen können. Da freut sich auch die Versicherungsindustrie, und die kleinen Leute sind hinsichtlich ihrer Altersrente deren Spekulationen ausgeliefert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Rentenreform kommt
voran:
Der überfällige „Abschied von
Lebenslügen“ oder „Das Ende der Sozialromantik“
In seiner 16-jährigen Amtszeit hat der christliche
Minister für Arbeit und Soziales mit „Kürzungen,
Streichungen und höheren Beiträgen“ den „Rentnern und
Arbeitslosen“ fortlaufend „in die Tasche gegriffen“.
(Frankfurter Rundschau) Die
„Spar-Bilanz“, die Blüm 1998 seiner Fraktion vorlegt,
beziffert er – nicht ohne Stolz – auf „98 Milliarden
Mark“. Ein Verarmungsprogramm war das natürlich nicht.
Denn der Sozialreformer aus Leidenschaft hat genau das
getan, was sein Job verlangt, und – der „ökonomischen und
demographischen Entwicklung“ Rechnung tragend – mit
Beitragserhöhungen hier und Auszahlungsminderungen dort
an dem Kunststück herumgedoktert, dass der Lohn der
aktiven Lohnarbeiter auch noch für den Lebensfeierabend
der stillgelegten reicht. So hat er die Versorgung der
Alten den Erfordernissen der Zeit „angepasst“ und die
Rente dadurch gesichert. Ein ziemlicher Irrtum,
wissen die wirklichen Kenner der Materie. Sie haben sich
nie blenden lassen und die Rede von der „sicheren Rente“
als pure „Beschwichtigungsparole“ enttarnt. Denn so viel
ist ihnen klar: Dass im Kapitalismus, in dem schon das
Lohnarbeiten eine mit lauter Risiken befrachtete Sache
ist, ausgerechnet die Rente sicher sei, das kann nur die
„Lebenslüge“ einer Nation sein, die sich einredet, der
Sozialstaat wäre auf Dauer bezahlbar. Wie es
scheint, geht dieses unselige Kapitel deutscher
Sozialpolitik allmählich, aber unübersehbar zu
Ende
. (SZ)
1.
Die Schröder-Regierung hat beschlossen, der Nation eine neue Ehrlichkeit zu verordnen und den Konstruktionsfehler, an dem das bundesdeutsche Rentensystem krankt, zu beseitigen. Nicht, dass sie etwas gegen das Prinzip hätte, das Überleben der Alten per Zwangsbewirtschaftung des Lohns der Aktiven zu organisieren. An dieser sozialen Errungenschaft will sie nicht rütteln. Nicht abfinden will sie sich allerdings mit dem Automatismus, der sich daraus ergibt: Um die rechtsgültigen Ansprüche der Rentner bezahlen zu können, müssen immerzu die Beiträge erhöht werden; das ist der ‚Handlungszwang‘, der von der geltenden Rentenformel ausgeht und eine ‚Kostenexplosion‘ bewirkt. Die Modernisierer der deutschen Industrielandschaft denken da weniger an die ‚explodierenden‘ Lohnabzüge, die den beitragszahlenden Arbeitern zu schaffen machen, und deren ‚Gegenfinanzierung‘ man sich übrigens auch so vorstellen könnte: Wenn es denn schon so viel Rentner gibt, die vom Lohn der Aktiven leben müssen, dann muss für die Beschäftigten eben mehr Lohn her, damit die Alten ein anständiges Auskommen haben und die Aktiven ihre Abzüge verkraften!
Riester & Co. sehen die Sache genau andersherum. Dass die steigenden Abgaben den Lohn für die Lohnempfänger fortlaufend senken, geht sie als politische Betreuer des nationalen Standorts nichts an. Ihre Sorge gilt dem Lohn, den die Anwender und Nutznießer der Arbeit zahlen, und der durch Renten belastet wird. Das finden sie alarmierend, weil es sich dabei um Kosten handelt, die das kapitalistische Geschäft nicht verträgt. Wie kontraproduktiv diese Kosten fürs Geschäft sind, entnehmen sie den Beschwerden der Kapitalisten über das viel zu hohe Lohnniveau in Deutschland, das den hiesigen Weltmarkteroberern unüberwindliche Konkurrenznachteile beschert. Die Geschäftemacher der Nation definieren ihre Lage als ziemlich prekär und tun alles, um den politisch Verantwortlichen klarzumachen, dass es sich bei den Löhnen, die sie hierzulande zahlen, nicht um ‚Marktpreise‘ handelt; dass sie vielmehr „neben“ den Kosten, die sie für die Arbeit aufwenden, auch noch mit Lohnnebenkosten belastet werden, die im Grunde gar keine echten Lohnkosten sind. Denn was sie zahlen, wenn sie „Arbeit“ einkaufen, das ist aus der Sicht und vom Standpunkt der Kapitalisten eben nicht bloß Lohn für geleistete Arbeit, sondern – siehe Rente – auch noch Lohn für „soziale Romantik“, nämlich für Nichtarbeit und puren Müßiggang. So besehen, bedient sich der Staat nicht am Lohn der Arbeiter, wenn er ein sattes Fünftel für die Rentenkasse kassiert; dieses Fünftel ist nach der Optik des Kapitals ja kein wirklicher Lohnbestandteil, kann also auch kein Abzug von ihm sein; es ist, so versichern sie mit allem Nachdruck, ein Lohnzusatz, den der Staat den Unternehmern aufhalst, und der die eigentlichen Arbeitskosten künstlich in die Höhe treibt. Deutschlands ‚Arbeitgeber‘ haben also allen Grund zu klagen. Sie zahlen eine komplette Systemwidrigkeit, die ihnen der Sozialstaat zumutet: einen politisch motivierten „zweiten Lohn“, der durch keinerlei Arbeit gerechtfertigt ist. So finanzieren sie, die ohnehin knapp kalkulieren müssen, die Soziallast der Gesellschaft, in diesem Fall also die ganze Masse der Ruheständler, mit denen sie gar nichts zu schaffen haben. Mit dieser Klage finden sie bei der Politik Gehör.
Die Regierung hat sich die Kritik längst zu Herzen genommen und ist dabei, die daraus fällige Selbstkritik des Sozialstaats in die Tat umzusetzen. Dass die Arbeitskosten in Deutschland entschieden zu hoch sind, leuchtet ihr ebenso ein wie die Schuldzuweisung an die Adresse des Staates, der mit seinem Übermaß an sozialer Versorgung Urheber und ständiger Preistreiber des „zweiten Lohns“ ist. Daher hat sie in der bisherigen Rentenpolitik die leibhaftige Anschauung dafür, dass ein „Systembruch unumgänglich“ ist. Das Rentenproblem, das sie auf die Tagesordnung setzt, ist also keineswegs ein Finanzierungsproblem im dem Sinn, wie Einnahmen und Ausgaben haushaltstechnisch zur Deckung zu bringen wären. Da könnte sie ebenso gut weiter machen wie bisher. Mit dem Systembruch, den sie einzuleiten gedenkt, stellt sie vielmehr den einzig vernünftigen Zusammenhang von Lohn und Rente her, der nach ihrer Auffassung für Deutschlands Zukunft in Betracht kommt. Sie hat nämlich erkannt, dass im Zeitalter der Globalisierung jedes Stück Lohn ein Beschäftigungshindernis ist, und daraus den Schluss gezogen, dass die beste Sozialpolitik eine konsequente Beschäftigungspolitik ist – Rentenpolitik also nur ein Synonym für beschäftigungsfördernde staatliche Lohnsenkungspolitik sein kann. Daraus folgt zum einen, dass der Lohn natürlich weiterhin für die Versorgung im Alter herhalten muss; zum anderen aber so, dass jeder weitere sozialstaatliche Zugriff auf ihn wirklich nur die Lohnempfänger in die Rentenverantwortung bugsiert und nicht die Verkehrten – die Lohnzahler – trifft. Das ist die Zielrichtung der Reform.
2.
Der erste Schritt dazu – der Einstieg ins ‚Reformprojekt‘ – ist der Beschluss, die Rentenbeiträge auf den derzeitigen Stand von ca. 20 Prozent einzufrieren. Nicht nur dem Arbeitsminister ist klar, dass diese konservierende Maßnahme eine ziemlich durchschlagende Wirkung auf die künftige Rente hat. Wenn die Beiträge, die als ‚Faktor‘ in die Rentenformel eingehen, eingefroren werden, dann zieht das im Zeitalter von Massenarbeitslosigkeit und hemmungslos steigender Lebenserwartung unweigerlich eine drastische Absenkung des allgemeinen Rentenniveaus nach sich, und zwar mit der eindeutigen Tendenz in Richtung Sozialhilfeniveau – oder auch darunter. Nach übereinstimmender Auffassung aller befragten wie ungefragten Experten ist mit diesem Beschluss, der „zweifellos notwendig“ ist, die „Altersarmut programmiert“. Beschönigen will man nichts. Der zuständige Minister, der zu seiner sozialen Verantwortung steht, widmet sich folglich der Aufgabe, wie sich die von ihm selbst eingeläutete „verschämte Altersarmut“ abwenden oder wenigstens in ihrem Ausmaß eindämmen lässt. Beziehungsweise anders: Wie kann er verhindern, dass der Staat demnächst immer mehr Rentner, für die er sich nicht zu schämen braucht, weil sie auf ‚eigenen Füßen stehen‘, in Sozialfälle umwandelt, die der öffentlichen Fürsorge anheimfallen und die entsprechenden Kassen sprengen? Die Idee einer staatlich garantierten „Grundsicherung“ für Alte, deren Rente die Sozialhilfe unterschreitet, und die deshalb auf das Niveau dieser menschenwürdigen Armutsgrenze angehoben werden soll, wird, kaum geboren, aus dem Verkehr gezogen. Eine solche ‚Sicherung‘ ist nicht machbar, weil sie gegen das „Versicherungsprinzip“ verstößt. Und sie macht auch politisch keinen Sinn, weil sie nicht „vermittelbar“ ist. Denn so viel ist klar: Dass diese sagenhafte Armenspeisung auch diejenigen erreicht, die keine Ansprüche erworben haben, das ist all den anderen, die dafür 30 Jahre arbeiten und Beiträge zahlen, einfach nicht „zuzumuten“. Politisches Marketing, Grundkurs 1.
Riesters ‚Lösung‘ heißt private Vorsorge, ein schon seit längerem hochgehandelter Geschäftsartikel, zu dem es keine Alternative gibt; das jedenfalls ist der parteiübergreifende Konsens von Regierung und Opposition. Denn ein zweites Standbein braucht’s. Um die „Eigenverantwortung“ zu fördern und die Defizite der GRV zu kompensieren, tut eine ‚Zusatzversorgung‘ not, eine Art „private Haftpflicht“ ergänzend zur Rente, die den praktischen Charme besitzt, dass die Beiträge, die als gesetzliche Abzüge vom Bruttolohn unerwünscht sind, vom Nettolohn genommen werden. Bis 2008 soll der freie Lohnarbeiter Stückchen für Stückchen seines Nettolohns in die ‚private Vorsorge‘ stecken – in acht Schritten und im Umfang von jeweils 0,5 Prozent, so dass er am Ende 4 Prozent abzweigt. Ein großartiger Einfall, fürwahr: Die Antwort auf die Altersarmut, die ihr Normalmaß schon im Lohn hat, mithin der passende Deckel auf den Effekt, den das Einfrieren der Beiträge erzeugt, heißt schlicht und ergreifend: ‚mehr sparen, Leute!‘ Kaum dass die Absicht der Regierung in die Zirkulation der demokratischen Meinungsfindung geworfen ist und den Status eines ‚Vorschlags‘ erhält, wird der auf Herz und Nieren überprüft. Nicht zufällig stellt sich als erstes die Frage der Verbindlichkeit. Soll die private Vorsorge eine Empfehlung sein oder ein „Obligatorium“? Niemand macht sich da Illusionen, was die Fähigkeit von Lohnarbeitern zu solcher „Eigenverantwortung“ betrifft. Dass das Rezept, Armut mit Verarmung zu bekämpfen, ohne einen gewissen Zwang nicht ‚greift‘, das wissen all die klugen Experten, die der Minister in seinem Beraterstab hat.
Wovon sie dabei reden, ist überhaupt kein Geheimnis: Vom Lohn und dessen fragwürdigem Nutzen für diejenigen, die ihn verdienen, und von seiner begrenzten Reichweite für die, die altersbedingt auf einen Lohnersatz angewiesen sind, der noch weit weniger reicht. Wie sie davon reden, spottet allerdings jeder Beschreibung, nämlich so, dass von der Not und vom Zwang, die vom Lohn selber ausgehen, nichts mehr vorkommt. Da ist die Rede von der „kollektiven Rationalität“, die einfach verlässlicher ist als die „unzureichende individuelle Rationalität“, welche „die Menschen“ zu „systematischer Minderschätzung künftiger Bedürfnisse“ verleitet, so dass sie „keine ausreichende Vorsorge für das Alter betreiben und der Allgemeinheit zu Last fallen“. (SZ, 5.6.) Diese schöne Ableitung der Vernünftigkeit des sozialstaatlichen Zwangsregimes aus der Bedürfnisstruktur der Menschen wirft die spannende Frage auf, wie man die individuelle Unvernunft dahin manipulieren kann, dass sie Vorsorge trifft, statt sich – wie zu erwarten – auf die Allgemeinheit zu verlassen. Da die neue Rentenkomponente das moderne Label ‚privat‘ trägt, berührt die Frage gleich etwas ganz Elementares, nämlich das Freiheitsverständnis der Demokratie. Und da ist man sich sehr schnell einig, dass ‚Bevormundung‘ von Übel ist: Nie und nimmer darf der Staat die Lohnarbeiter zu privatem Sparen verpflichten. Im Gegenteil: Ermunterung ist gefragt. Riester, durchaus lernfähig, lauscht dem Gemeckere der Opposition sowie dem Genörgel aus den eigenen Reihen die Stimmung im Lande ab. Und spätestens mit dem Gespenst einer „Zwangsrente“ (Bild), das der stets verlässliche Lobbyist des arbeitenden Volkes an die Wand malt, ist das „Obligatorium“ vom Tisch. Politisches Marketing, Grundkurs 2.
Ganz ohne Marxkenntnisse besinnt sich der Minister auf den „stummen Zwang der Verhältnisse“, vor allem aber darauf, dass er die Macht hat, diese Verhältnisse zu „gestalten“. Damit der Lohnarbeiter seine Bedürfnisse im Alter nicht „systematisch minder schätzt“, gibt ihm das geplante Rentengesetz ein paar Denkhilfen in Form von ‚materiellen Anreizen‘ mit auf den Lebensweg. Egal, ob der Arbeiter privat vorsorgt oder nicht, das Rentengesetz geht jedenfalls davon aus, es wäre so. Systemlogisch völlig einleuchtend, soll deshalb bis 2008 der „statistische Nettolohn“, der die Bemessungsgrundlage für die Rentenanpassung ist, um jährlich 0,5 Prozent abgesenkt werden. Ab 2011 soll es dann einen jährlichen Abzug von 0,3 Prozent von den Rentenerhöhungen geben. Ein ernst gemeintes Angebot also – und ernst zu nehmen in jedem Fall, weil dem Lohnarbeiter gar nichts anderes übrig bleibt, als all die „Faktoren“ auf seine Rechnung zu setzen. Je weiter er von seiner Rente entfernt ist, je mehr Jahre er also „Zeit“ (!) hat, privat zu sparen, umso geringer fallen seine gesetzlichen Rentenansprüche aus – und umso nachdrücklicher ist er auf einen „Ausgleich“ verwiesen, der gar nichts ausgleicht, weil er ihn selber finanzieren darf. So manövriert der Sozialstaat mit seinem phantasievollen Kampf gegen die Altersarmut die Arbeiter in jene Notlage, die das private Vorsorgen – die „zweite Säule“ der Rente – so richtig einleuchtend macht.
Fürs Erste sind damit die wesentlichen Elemente der neuen Rente beisammen. Rentensystematisch betrachtet, hat die Reform den unübersehbaren Vorteil einer ‚Risikoverlagerung‘. Statt wie bisher die sozialen Lebensrisiken der Lohnarbeiter durch die Verstaatlichung von Lohnbestandteilen in eine ‚gesellschaftliche Haftung‘ zu überführen, sprich: Klassensolidarität im besten Wortsinn zu organisieren, weist die Reform einen Weg, der dieses Prinzip eindeutig verbessert – durch die Privatisierung der Risiken der Sozialkassen. Die tragen bisher, wie man weiß, die ganze Last des kapitalistischen Fortschritts: die Humanisierung der Arbeit in Form einer immer höheren Lebenserwartung und die Effektivität der Ausbeutung in Gestalt einer wachsenden Masse überflüssiger Lohnarbeiter. Diese Risiken der „ökonomischen und demographischen Entwicklung“, d.h. die todsicher zu erwartenden Steigerungen der Rentenkosten gehen mit der Reform ganz auf das Konto der Nettolohnempfänger.
‚Privat‘ ist diese Zusatzvorsorge noch in einer zweiten Hinsicht. Das freiwillig angesparte Geld soll selbstverständlich nicht in eine zusätzliche staatlich verwaltete Kasse fließen, sondern seine segensreiche Wirkung als Kapitalfonds entfalten. Im Unterschied zum sogenannten Umlageverfahren der gesetzlichen Rente stiftet die ‚kapitalgedeckte Rente‘ Geschäftsgelegenheiten für das private Geldvermögen. Die Konzentration neuer Milliardensummen bei Banken, Versicherungen etc. liefert dem Kreditkapital den Stoff für seine spekulative Plusmacherei. Und dass der dort gut angelegt ist, versteht sich von selbst, weil sich die Finanzprofis schon aus purem Egoismus um eine ordentliche Rendite kümmern. Das soll die „Sicherheit“ einer sozialen Versorgung stiften, die der Staat für „unsicher“ erklärt. Womit wieder ein Stück mehr Marktwirtschaft Einzug in eine Sphäre hält, die sonst immer nur kostet und sich so wenig ‚lohnt‘. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht gut geht.
3.
Soweit die sachliche Seite der anstehenden Rentenreform. Deren politökonomischer Zweck ist klar. Die Arbeitskosten fürs Kapital sollen gesenkt werden. Klar sind auch die Konsequenzen, die sich daraus für die Lohnarbeiter ergeben. Für sie bedeutet das Vorhaben eine einschneidende Schlechterstellung, was ihren Lohn und ihre Altersversorgung angeht. So soll das wunderbare Reformwerk natürlich nicht gesehen werden. Die politischen Macher kümmern sich höchstpersönlich um eine objektive Meinungsbildung, veranstalten also eine ziemlich umfangreiche Propaganda des Nutzens und verkaufen, sekundiert von der Öffentlichkeit, die Schlechterstellung als Riesenvorteil für die Betroffenen.
Die kapitalgedeckte Privatvorsorge, so erfährt man von kompetenter Seite, basiert auf der genialen Idee, zu trennen, was nicht zusammen gehört. „Entkoppelung“ heißt das Stichwort, und gemeint ist das Grundübel der GRV, deren Umlageverfahren die Rente an den Bruttolohn „koppelt“, so dass jede Beitragserhöhung die Arbeitskosten fürs Kapital tangiert: diesen Zusammenhang soll die Reform „entkoppeln“. Die Entlastung des Kapitals auf Kosten von Lohn und Rente liegt freilich ganz im Interesse der Arbeiter und Rentner. Denn das Umlageverfahren stiftet noch einen anderen fatalen Zusammenhang – eine moralisch und finanziell nicht zu verantwortende Abhängigkeit der Generationen, die in der Vergangenheit mit dem unpassenden Kompliment einer ‚Solidargemeinschaft‘ bedacht wurde. In Wahrheit, so weiß man, wird die aktive Generation der Lohnarbeiter von den Ansprüchen der Alten erdrückt und in eine Art soziale Geiselhaft genommen. In Zahlen ausgedrückt: Drei Arbeiter finanzieren derzeit einen Rentner, bald sind es nur noch zwei und demnächst dreht sich das Verhältnis um; das haben Riesters Biometrieexperten aus dem „generativen Verhalten“ der Deutschen errechnet. Mit dem moralischen Bild, wonach die eine Sorte Lohnarbeiter der anderen „zur Last fällt“, spricht die führungsbefugte und meinungsbildende Elite der Nation nichts anderes als die kapitalistische Normalität an, dass die Klasse der Lohnarbeiter in allen ihren Lebensphasen unter dem Regime des Lohnsystems leidet, nur eben in reichlich verlogener Form. Sie zieht den guten Ruf einer ‚sozialen Errungenschaft‘ aus dem Verkehr, genauer gesagt, den guten Ruf ihrer eigenen Legende darüber, an der sie selbst Jahrzehnte lang gestrickt hat, und die sie heute nicht mehr leiden kann. Selbstverständlich hat sie lauter gute Gründe, wenn sie das einstige Glanzstück und kostbarste Gut der sozialen Alterssicherung, den Generationenvertrag, nach allen Regeln der Kunst schlechtmacht. Es gibt schließlich ‚Fakten‘, auf die sie nur zu deuten braucht: Zwanzig Prozent vom Lohn landen erst gar nicht auf dem Konto der Arbeiter, sondern von vorneherein in der Rentenkasse; und sie gehen nicht einmal für die eigene Rente weg, sondern für die der Väter und Großväter, die umgekehrt den Lohn der Söhne und Enkel verfuttern. Beim interessierten Schlechtmachen des alten Systems scheut man sich nicht, bis hart an die Grenze zur Wahrheit zu gehen, entlarvt schonungslos den systematischen „Sozialabbau“ und verweist auf den ‚Kern‘ aller bisherigen Reformen, mit denen der Staat jahrelang Lohnplünderung für eine immer mickrigere Rente betrieben hat. Bei Bedarf können sich die Kritiker der proletarischen Armut auch darauf verständigen, dass das Rentnerdasein in Deutschland eine einzige Idylle ist, eine Nische der Gemütlichkeit mitten im Kapitalismus. In der geht es den Alten ziemlich „gut“ – viel zu gut, wie gleich dazu gesagt werden muss, damit die Botschaft komplett ist. Lohnarbeiter, die nicht mehr arbeiten, haben Rechtsansprüche auf Lohnersatz; Leute, die geschäftsmäßig zu nichts mehr taugen, also die Grundvoraussetzung für Armut erfüllen, werden doch tatsächlich mit Geld versorgt. Und das in einem Umfang, bei dem von ‚echter‘ Armut und ‚wirklicher‘ Not keine Rede sein kann. Freilich, so schön und in gewissem Sinn luxuriös das ist, auch die Idylle hat einen Haken: ‚wir‘ können sie uns nicht leisten. Das können die Arbeiter an ihrem Lohnzettel ablesen und die Alten an ihrer mickrige Rente…
Sehr berechnend setzen die Reformer auf die praktische ‚Plausibilität‘ ihrer Diagnose für die Betroffenen und führen vor, was für Vorzüge demgegenüber die private Vorsorge mit der „Entkopplung“ von Netto und Brutto bringt: Niemand fällt anderen mehr zur Last; jeder sorgt „für sich selbst“, und zwar besser und sicherer, als jede ‚Solidargemeinschaft‘ das vermag. Denn „entkoppelt“, so der weitergehende Gedanke, wird damit nicht nur das Verhältnis der Generationen, sondern – man höre und staune! – die Rente von der Arbeit. Begeistert von der Vorstellung, dass die Rentenkosten nicht mehr die Lohnkosten, sondern nur noch die Kosten für die Lohnarbeiter in die Höhe treiben, versteigen sich die Befürworter des nationalen Billiglohns zu der Auffassung, nach der Kapitaldeckung bedeutet, dass Rentner nicht mehr von dem leben, was andere erarbeiten, sondern von ihrem angesparten kapitalisierten Geld.
Eine wunderbare Aussicht! Jeder Lohnarbeiter wird sein eigener Kapitalist – und der Lebensfeierabend ist gesichert! Leider hat die großartige Idee ein paar Schönheitsfehler. Und zwar erstens, was die behauptete Funktionsweise eines solchen Kapitalfonds angeht. Der muss zunächst aufgebaut werden. Von wem und wovon, ist keine Frage. Bevor die künftigen Fondsrentner ein paar Spurenelemente an Rendite zu Gesicht bekommen, müssen sie ein paar Jahrzehnte rentable Arbeit abliefern, damit aus Lohnteilen ein ‚Kapitalstock‘ entsteht, sprich: die Umwandlung von angespartem Geld in Geldkapital stattfindet. Einmal aufgebaut, ist der Fonds allerdings nicht dazu da, einfach die angehäuften Rentenansprüche zu bedienen; das würde ihn ja glatt wieder aufzehren und so tun, als wäre er nie Kapital, sondern bloß ein riesengroßes Sparschwein gewesen. Damit er als Fonds funktioniert, also in der Lage ist, Auszahlungen zu leisten, ohne dass der Kapitalstock tangiert und als fungierendes Geldkapital in Frage gestellt wird, braucht’s eine Quelle, die seine Dauerhaftigkeit gewährleistet. Wer diese Quelle ist, und woraus sie sprudelt, ist schon wieder keine Frage: Genügend aktive Lohnarbeiter müssen den kontinuierlichen Zufluss von Beitragsgeldern besorgen, wobei Kontinuität allein nicht reicht. Auch in der Masse muss der Zufluss stimmen, und das heißt nach der vielbeschworenen „Alterspyramide“ eben auch – von wegen „unabhängig“ von der „ökonomischen und demographischen Entwicklung“! –, dass immer weniger Aktive mit ihrem Geld für einen Rentenfonds geradestehen müssen, der für immer mehr Inaktive die entsprechenden Erträge hergeben soll: In diesem Prinzip unterscheidet sich das Kapitaldeckungsverfahren gerade nicht vom gesetzlichen System des Umlageverfahrens, und das ist auch gar nicht weiter überraschend. Denn bei allem Getöse, das um die Kapitalform der privaten Rente veranstaltet wird, bleibt eines gewiss: hier wird nicht Reichtum, sondern Armut gemanagt. Dass die Versicherungsgesellschaften mit den zentralisierten Spargeldern der Lohnarbeiter ihr Geschäft machen, von dem nach Abzug von „Verwaltungskosten plus Gewinn“ auch noch etwas für die Rente übrig bleiben soll, ist schon so vorgesehen. Nur zeigt das eben, inwiefern und für wen dieses Geld als Mittel des Geschäfts, also der kapitalistischen Bereicherung fungiert, und für wen nicht; und insofern macht es den Unterschied und Gegensatz kenntlich zwischen dem Fonds als Kapitalanlage und seiner ‚Rolle‘ als Instrument der ‚sozialen Sicherung‘. Dass beides zusammenpasst, also ausgerechnet das Kreditkapital die proletarische Altersarmut kompensiert, ist die alberne Mär, die allenthalben verkündet wird. Das wäre ja noch schöner, wenn sich bei einer Versicherung der Versicherte bereichern würde – und nicht die Versicherung.
Nicht minder verwegen nimmt sich zweitens die Behauptung aus, die über die wundersame Fähigkeit des Geldes zur Selbstvermehrung zirkuliert. Während der Staat bei der gesetzlichen Rente nur sauer verdiente Lohngelder umverteilt, also einen notorischen Mangel verwaltet, wirft – so die frohe Kunde – der kapitalisierte Lohn „Rendite“ ab und ist darin selber eine Quelle von Reichtum. Da liegt es für den Lohnarbeiter, dessen Erträge aus der Arbeit immer spärlicher ausfallen, gewissermaßen auf der Hand, sich – wenigstens ein Stück weit – auf die Seite der Gewinner zu schlagen und mit seiner privaten Rente am kapitalistischen Geldwachstum teilzunehmen, von dessen Dynamik und Rasanz er sich täglich überzeugen kann: New York, Tokio, Frankfurt. In der Tat kriegt der Lohnarbeiter reichlich Anschauungsmaterial dafür geliefert, wie sich die Spekulation von seiner Arbeit ‚unabhängig‘ macht. Via Presse und Fernsehen oder direkt auf dem Weg der praktischen Lebenserfahrung wird er mit der Tatsache vertraut gemacht, dass die Rendite umso besser ausfällt, je weniger Arbeit angewendet wird. Entlassungen im Zuge einer erfolgreichen Fusion, einer gelungenen Sanierung oder Rationalisierung treiben die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen in die Höhe und zeigen, wozu die spekulative Form der kapitalistischen Reichtumsvermehrung fähig ist: sie verschafft sich ihre eigenen Mittel und rechnet sich reich, macht also aus künftigem Gewinn, der noch gar nicht gemacht ist, ihr gegenwärtiges Geschäftsmittel. Freilich liegt darin auch der Haken: Denn all das schöne Geld, das die Spekulation erzeugt, ist ja nicht zum Verjuxen bestimmt; in seiner Eigenschaft als Geldkapital, das sich vermehren und Zinserträge abwerfen soll, ist es darauf angewiesen, dass es als Geschäftsmittel für andere taugt. Das Gelingen der Spekulation setzt also voraus und beruht darauf, dass das ‚wirkliche‘ Geschäft des produktiven Kapitals gelingt, andernfalls wird die schönste Spekulation zunichte. Es ist also doch nicht so unwesentlich, was in den Fabrikationsstätten des kapitalistischen Reichtums passiert. Damit dort Gewinne tatsächlich erwirtschaftet werden, macht das Kapital zwar jede Menge Arbeiter überflüssig, nicht aber die Arbeit; die wird dadurch rentabel gemacht. Und das Maß der Rentabilität, also des notwendigen Ausbeutungsgrads der Arbeit, wird nicht zuletzt mit den Zinsansprüchen des fiktiven Kapitals in die Welt gesetzt.
Dieselben – ob politische Macher oder studierte Experten –, die die Vorzüge der neuen Rente am ‚Geld heckenden Geldkapital‘ demonstrieren, welches ohne Arbeit auskommt, machen übrigens gar kein Geheimnis daraus, worauf es bei der Rente im Zusammenhang mit der Arbeit ankommt. Sie sind es ja, die ewig darauf herumreiten, dass die Löhne gesenkt gehören, Arbeit also billiger und lohnender gemacht werden muss, damit das Kapital ungehindert wachsen kann. Dieselben, die so freizügig sind, Arbeitern und Rentnern den Weg zur Börse zu weisen, wo das Geld auf der Straße liegt, werden nicht müde nachzuweisen, dass die Rente ein Lohnkostenproblem ist, und die Zukunft der Nation als Kapitalstandort davon abhängt, dass die Rente mitsamt dem Bruttolohn gesenkt wird, damit Deutschlands Unternehmer in Sachen Ausbeutung nicht den Anschluss an die weltweite Konkurrenz verlieren. Statt vom Bruttolohn, der einen Seite der Ausbeutung, die eh nichts bringt, sollen die Rentner daher vom Mehrwert, der anderen Seite der Ausbeutung, ihr Quentchen abkriegen. Wieviel sie zu erwarten haben, und wie sicher ihre kapitalgedeckte Vorsorge ist, darüber werden sie nicht einmal im Unklaren gelassen. Aktien sind Risiken! Und mehr als 100 DM im Monat sind auch nach 30 Jahren Ansparzeit beim besten Willen nicht drin. Und darüber brauchen sie sich am Ende auch nicht zu wundern: Von den Erträgen, die ein solcher Kapitalfonds abwirft, mögen gewisse Luxusgeschöpfe der kapitalistischen Welt angenehm leben, weil sie als Eigentümer von Geldkapital Börsengeschäfte treiben; zum Durchfüttern der ganzen Masse von Rentnern allerdings ist der Dax weder vorgesehen noch geeignet. Geschäft ist Geschäft – und keine Armenspeisung.
4.
Die Regierung erhält für ihr Rentenvorhaben allenthalben gute Noten. Die Richtung stimmt – sagen die Kapitalisten und sind zufrieden. Das hat Deutschland gebraucht! tönt die Öffentlichkeit und ist beeindruckt vom Reformwillen der Schröder-Mannschaft, die ein Jahr zuvor noch eine „Chaos-Truppe“ war. Und selbst die Opposition muss zähneknirschend eingestehen, dass sie gegen Riesters Konzept im Prinzip nichts einzuwenden hat. Kritik ist deswegen aber noch lange nicht ausgestorben. Im Gegenteil. Die gute Sache ist der Stoff für lauter Verbesserungsideen.
Den ersten Beitrag liefert die Gewerkschaft, deren konstruktiver Geist die Forderung nach mehr Lohn als Antwort auf die neu aufgeworfene soziale Frage von vorneherein ausschließt. Bestens vertraut mit den modernen Beschäftigungsverhältnissen – man ist ja Mitgestalter derselben –, ist der Arbeitervertretung klar, dass die gesetzliche Rente nicht mehr „ausreicht“, weil sie von Arbeitsbiographien ausgeht, die heutzutage völlig unrealistisch sind. Das macht die neue ‚Rentenkomponente‘ der privaten Vorsorge sinnvoll und notwendig. Empört ist die Gewerkschaft allerdings darüber, dass die Arbeitgeber in keiner Weise an den zusätzlichen Rentenkosten beteiligt und so aus ihrer „Verantwortung“ entlassen werden. Die IG Metall droht mit einer großen „Herbstkampagne“. Da muss der Kanzler als Kenner der Materie und erfahrener Lobbyist schon ein Machtwort gegen das „Kartell der Unbeweglichen“ sprechen, das anscheinend zu blöd ist, den Clou seiner Reform zu begreifen. Die könnte er sich wirklich schenken, wenn er die Arbeitgeber daran beteiligt. Die Öffentlichkeit findet das auch, hat aber noch ein griffigeres Argument zur Hand: Arbeitgeberbeiträge! Da lacht sich die Zeitung, die „die Leser hat, die sie verdient“, schier krank und hält der Gewerkschaft einen „Mythos“ unter die Nase, den Journalisten von Format längst durchschaut haben. Wissen denn die Gewerkschaften nicht, dass die vielzitierten Arbeitgeberbeiträge „ökonomisch gesehen normale Lohnbestandteile“ sind, die „in Wirklichkeit keine Lastenverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bewirken“? Sind sie am Ende die letzten Naivlinge, die einer – von derselben Öffentlichkeit dreimal täglich lancierten – Ideologie auf den Leim gehen und dem „Irrglauben“ anhängen, dass „jeder, der eine bestimmte Abgabe entrichtet, sie auch effektiv trägt“? Da ist Nachhilfeunterricht angebracht über den Unterschied zwischen Ökonomie und Ideologie: Die „etwas paternalistische Art“ der Einbindung der Arbeitgeber in die soziale Verantwortung „muss nicht schlecht sein“, will sagen: leistet immerhin gute ideologische Dienste; sie sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass die Arbeitgeber per „Rationalisierung und Tarifpolitik“ all das „zurückholen“, was ihnen als Lohnlast zugemutet wird, und so dafür sorgen, dass die Lohnnebenkosten letztlich doch vom richtigen Konto abgebucht werden. Fragt sich nur, weshalb es dennoch so viel Aufregung über die „sozialen Abgaben“ gibt? Auch da weiß die Zeitung, die offenbar auch die Redakteure hat, die ihre Leser verdienen, Bescheid: Die Abgaben haben „den Nachteil, dass sie die gesamte Altersversorgung an den Arbeitsplatz und dessen Kosten binden“. Das ist doch mal ein Wort zur Ideologiekritik! – Inzwischen nimmt die Gewerkschaft in ihren Unterabteilungen eine „differenziertere“ Haltung ein und ihre Drohung zurück. Nein, das Bündnis für Arbeit soll an der Rente nicht scheitern; und auf Konfrontationskurs zu „ihrer“ Regierung will die Gewerkschaft schon gar nicht gehen. Zumal Riester „Nachbesserungen“ verspricht: Zu „Altersarmut“ wird es nicht kommen. Nicht 58, auch nicht 63, sondern 64 Prozent sind das Ende der Fahnenstange. Unter diese Marke wird das allgemeine Rentenniveau nicht fallen. Jedenfalls nicht für den proletarischen Ausnahmeathleten, der auf den schönen Namen „Eckrentner“ hört und das Kunststück schafft, mit einer lückenlosen 45-jährigen Lohnarbeiterkarriere seine vollen 64%-igen Ansprüche zu erwerben. Für alle anderen gilt natürlich – proportional heruntergerechnet – das Gleiche. Beruhigend auch die Tatsache und ein Zeichen der politischen Vernunft, die in dem Land herrscht, dass die saudumme Frage – vierundsechzig Prozent wovon? – gar nicht erst gestellt, sondern mit „Nettolohn“ gleich beantwortet wird. Der ist das Maß aller Dinge und steht für „Lebensstandard“, den sich allerdings nur echte Lohnarbeiter leisten können. Für die aussortierten Alten ist nämlich der „effektive“ Lohn der Aktiven, dessen Bruttoform den weltweiten Vergleich rentabler Arbeitsplätze bestehen muss, ein wahrer Luxus; weswegen zwei Drittel bis die Hälfte reichen. Immerhin eine schöne Altersdividende.
Während die Gewerkschaft über einen möglichen „heißen
Rentenherbst“ debattiert, hat ihr linker
parlamentarischer Arm noch ein zusätzliches Problem. In
der SPD-Bundestagsfraktion „wächst der Unmut“ über
Riester: Man habe die Blüm-Reform nicht verhindert, um
selbst eine schlimmere Variante durchzusetzen.
(FR) Schlimm finden die
SPD-Linken, dass die Regierung auf die Pflege des
sozialen Images der Partei pfeift und der Opposition die
Gelegenheit gibt, sozialdemokratisches Terrain zu
besetzen und sich als Anwalt der ‚sozial Schwachen‘ zu
profilieren. Wirklich ‚Benachteiligte‘, wer hätte das
gedacht, gibt es nämlich schon noch: Familien mit
Kindern. Um die kümmern sich – zum Leidwesen der
Dresslers und Steiners – CDU/CSU mit einer
Doppelstrategie. In ihrer christlichen Verantwortung für
den ‚Wert‘ der Familie fordert die Union ein paar
Steuermärker pro Kind für die staatlichen
Aufzuchtsanstalten und empört sich im gleichen Atemzug
darüber, dass Riester eine Rentengarantie für diejenigen
vorsieht, die unter den Sozialhilfesatz fallen. Das
findet die Union extrem unsozial, weil die Bundesländer,
die für die Sozialhilfe zuständig sind, das Geld für
diese Sorte Rentner nicht mehr von deren Familien
„zurückholen“ können. Die Öffentlichkeit hält sich nicht
weiter mit der Kunst demokratischer Familienpolitiker
auf, zwischen Nachwuchs und rechtsfähigen Kindern zu
unterscheiden, denn: „dieser Ansatz ist richtig“; sie
fragt sich allerdings, ob die Union gut beraten ist, ihre
Oppositionsstrategie ausgerechnet darauf zu
konzentrieren, sich als „Anwalt der kleinen Leute“
aufzuspielen. Sicher, ein paar Punkte zu sammeln nach dem
„Motto: Seht her, wir kämpfen für die Schwachen!“ – das
leuchtet ihr als Strategie der Betörung künftiger Wähler
schon irgendwie ein. Genau besehen aber dann doch nicht,
weil sie dahinter einen Anfall von „Populismus“ wittert,
der all die „gutgemeinten Ideen“ der Union in einen
„maßlosen Wunschzettel für Weihnachten“ verwandelt und
ziemlich zielsicher in ein „Gejammer über angebliche
soziale Kälte“ mündet. Damit kommt eine moderne
Opposition heutzutage nicht weiter; damit „blamiert sie
sich nur“. Und deswegen bringt eine „Blockadepolitik“, so
verlockend sie erscheint, nichts: „die Union riskiert nur
ihre Kompetenz“. Um die sorgen sich die selbsternannten
PR-Fachleute der konkurrierenden Machthaber: „Wer nur
verteidigt, verliert“. Womit die Rentendebatte endgültig
da ist, wo sie in einer funktionierenden Demokratie
hingehört.
(Zitate Süddeutsche Zeitung)