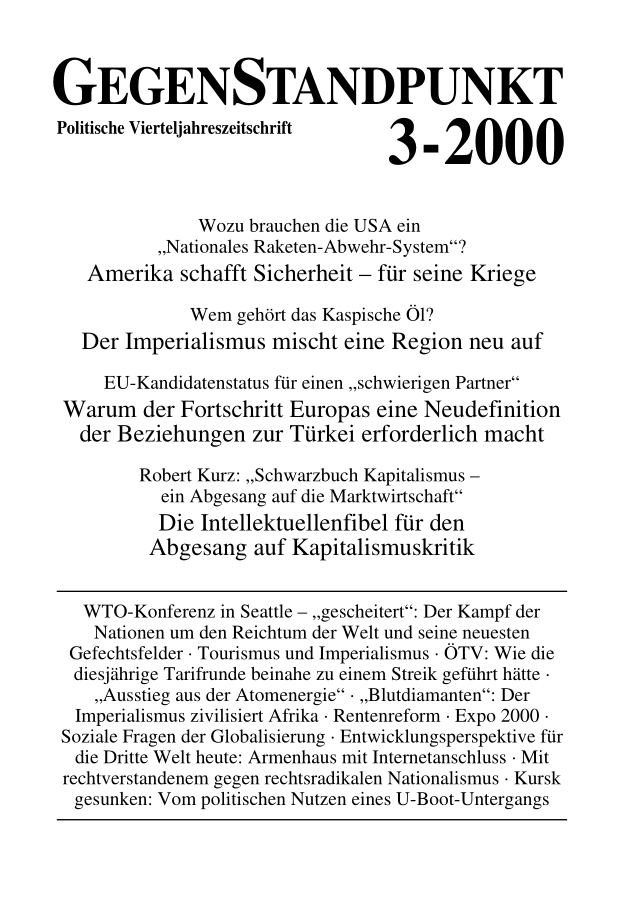Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Steuerreform beschlossen, Länder bestochen, Regierung bestärkt, Opposition beschämt:
Die Sternstunde des Deutschen Bundesrats
Die Abstimmung im Bundesrat über die rotgrüne Steuerreform gerät zu einem „Politkrimi erstens Ranges“: in solchen Sternstunden der Demokratie erwartet der demokratische Untertan von seinen regierenden und oppositionellen Herrschaften „politische Meisterleistungen“ und „Führungsstärke“ im parteiinternen und länderübergreifenden Machtpoker, wen interessieren da noch Steuern und wer demnächst wie viel zahlt!
Aus der Zeitschrift
Teilen
Steuerreform beschlossen, Länder
bestochen, Regierung bestärkt, Opposition
beschämt:
Die Sternstunde des Deutschen
Bundesrats
„Seit dem 14. Juli ist die Steuerreform 2000 nicht nur eine gute, sondern auch eine beschlossene Sache“ – zumindest kann man dies einer in allen großen Zeitungen und Nachrichtenmagazinen ganzseitig geschalteten Anzeige des Bundesministeriums für Finanzen entnehmen. Die Seite der „guten Sache“ bedarf offenbar keiner großen Ausführungen mehr: Spätestens seit den schrecklichen Jahren des „Reformstaus“ ist jedem gebildeten Steuerbürger hinlänglich bekannt, dass eine solche Reform „dringend erforderlich“, „überfällig“ und ganz allgemein „unvermeidbar“ ist. Politiker aller Parteien, Wirtschaftsvertreter und anteilnehmende Kommentatoren haben den Rest der steuerzahlenden Leute darüber aufgeklärt, dass nicht weniger als das Wohl und Wehe des Standorts Deutschland von geschickten Modifikationen des Steuersystems abhängt. Ihrer Auffassung nach stiften Steuerentlastungen lauter anlagefreudige Privatvermögen, üben magnetische Anziehungskraft auf Kapitalinvestoren aller Länder aus, beflügeln den Aufschwung und schaffen lauter neue Arbeitsplätze, so dass also ausgerechnet der fiskalische Abzug vom Reichtum, durch und für die öffentliche Gewalt, recht eigentlich dessen Vermehrung hervorruft – sofern er nur, in hinreichend raffinierter Weise neu organisiert, „die Wirtschaft entlastet“, also den Reichen mehr von ihrem Reichtum lässt und überhaupt (wir sagen nur „Halbeinkünfteverfahren“!) ganz allgemein „vereinfacht“ und für jeden „durchschaubarer“ wird. Soweit ist die „gute Sache“ Konsens.
Die Seite, dass die Sache nun auch eine
beschlossene
ist, hat hingegen einige Aufregung
verursacht. Abgespielt hat sich nämlich in jener
schicksalsträchtigen Nacht vor der Abstimmung im
Bundesrat je nach Lesart ein „an Dramatik nicht zu
überbietender Kampf“, eine „taktische Meisterleistung“
oder auch ein „noch nie dagewesener Missbrauch eines
Verfassungsorgans“; kurz: ein
„Politkrimi ersten Ranges“
„Triumph und Desaster“, wie liegen sie doch nahe beieinander: Da ist die Opposition, wenngleich nicht gegen die „gute Sache Steuerreform“ eingestellt, so doch dagegen, dass die rot-grüne Steuerreform eine gute Sache sei. Ganz wie ihre regierungsamtlichen Gegenspieler hat sie sich das Thema Steuerreform als herausragendes Betörungsinstrument in der Konkurrenz um die Macht im Staate auserkoren. Im demokratischen Machtkampf setzt sich vorteilhaft in Szene, wer „Reformen durchbringt“, was in der Sache nichts anderes heißt, als gewöhnlichen Leuten die jeweils neu gültigen Bedingungen von Leben, Arbeiten und Steuerzahlen verbindlich vorzuschreiben. Eine Steuerreform muss also, damit sie „durchgehen“ darf, „die Handschrift der Union“ tragen, weil sich andernfalls nur die Regierung damit profiliert. Denn der Wählerwille ist erfolgreich so gebildet, dass eine Partei, die er kürzlich in die Opposition geschickt hat, seine Gunst dann erneut verdient, wenn sie beweisen kann, dass „ohne sie nichts läuft“. Und da die CDU/CSU über das verfügt, was man im Bundesrat eine „Blockademehrheit“ nennt, hätte bei der Abstimmung eigentlich nichts schief gehen dürfen. Einfach und bestechend der geplante „Spielablauf“ des „Sommertheaters Steuerreform“: Der Reformvorschlag der Regierung scheitert im Bundesrat, muss also in die nächste Verhandlungsrunde; die Regierung muss der Opposition Zugeständnisse machen, schaut also schwach auf der Brust aus; die Union hat durch diese Demonstration ihrer Macht ihren „politischen Gestaltungswillen“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt – und das gilt unter Demokraten allemal als so etwas ähnliches wie ein Rechtstitel auf zukünftige Ermächtigung zum tatsächlichen „Gestalten“.
Statt dessen kommt alles ganz anders. Die Regierung – gewitzt durch 16 Jahre Erfahrungen mit dem „System Kohl“ – verspricht Bundesländern, die von Koalitionen mit FDP- oder Unionsbeteiligung regiert werden: Geld. Den Bundesländern leuchtet das ein. Ihre Chefs ringen hart mit ihrer und um ihre Verantwortung, „Länderinteressen über Parteiräson zu stellen“ (der Landesfürst und deshalb notgedrungene Parteiverräter Diepgen), und anschließend sich zu einer Zustimmung durch. Wer hätte geahnt, wie spannend dieser „Krimi“ wird. Jedenfalls nicht die Führungsspitze der Union. „Falsch“, „zu spät“ oder auch gar nicht „informiert“ über das Umfallen ihrer regierenden Parteifreunde, steht sie nun vor den Trümmern ihrer „Oppositionsstrategie“. Über Nacht und hinterrücks hat Schröder sie im „Machtspiel um die Steuerreform“ ausgebremst, und so erscheint auf dem Spielplan des „Sommertheaters“ die Neuauflage des Erfolgsdramas „Die Krise der CDU“.
Dass ein hohes Gut wie eine Reform, die doch eben noch – wir erinnern uns – von fundamentaler Bedeutung für den nationalen Wirtschaftserfolg war, zum Stoff für die Parteienkonkurrenz gemacht wird, gilt unter Demokraten nur dann als Vorwurf, wenn dadurch allseits für fällig erachtete Entscheidungen verhindert werden. Dienen parteitaktische Manöver hingegen der Überwindung einer solchen „Blockade“, gehen sie voll in Ordnung. Da gemäß demokratischer Übereinkunft die erfolgreiche Ausübung politischer Herrschaft eine einzige Dienstleistung am Bedürfnis der gewöhnlichen Leute ist, gilt das Beherrschen ihrer Fallstricke und Kniffe, die Durchsetzung im Machtkampf in und zwischen den Parteien, als unabweisbare Empfehlung für Machthaber und solche, die es werden wollen. In solchen Sternstunden der Demokratie erwartet der demokratische Untertan dann aber auch „taktische Glanzleistungen“ und „politische Meisterschaft“, straft den ab, der es an solcher missen läßt, und schlägt sich unfehlbar auf die Seite des Siegers. So wird aus dem Politkrimi ein
„Triumph der Regierung“
„Alle Achtung, Kanzler und Finanzminister.“ (FR, 15.7.) Die Regierung hat dank ihrer „taktischen Meisterleistung“ mit einem Schlag in der öffentlichen Beurteilung alles wettgemacht, was ihr seit zwei Jahren angeblich daneben geraten ist, und steht „zur Halbzeit“ nun „erstaunlich gut da“ (SZ, 15.7.). Weil es ihr gelungen ist, die Geschlossenheit der Opposition aufzubrechen, ist alles vergeben und vergessen. Vergessen eben auch, dass eine Steuerreform über solche Kleinigkeiten entscheidet wie den verbindlichen Lebensstandard der Jahre 2001ff., der einer von der Reform beglückten Menschheit nach Abführung aller Abgaben an den Staat übrig bleibt. So billig geht es in der Demokratie zu: Die Niederlage des Gegners adelt automatisch den, der „im Machtkampf die Nase vorn“ behält. Da „mag man über die Mittel und Wege streiten, die der Kanzler bei der Durchsetzung der rot-grünen Steuerpläne angewendet hat“ (Handelsblatt, 17.7.), und manch liberales Blatt mag sich wünschen, die Steuerreform möge auf feinere demokratische Verfahrensweise, „frei vom Odium der Mauschelei“ (FAZ, 15.7.), zu Stande gekommen sein: Nichts gibt einer Regierung so Recht wie ihr Erfolg; und ein wenig „Skrupellosigkeit“ hat bekanntlich noch keinem Staatsmann geschadet.
Völlig ungetrübt vom neulich noch heftig problematisierten Verdacht einer möglichen Käuflichkeit deutscher Politik, preist der demokratische Sachverstand des Kanzlers Coup, es bei „den Wackelkandidaten zwischen Rhein und Ostsee“ einfach mal mit Geld als Hebel für das Zustandekommen genehmer politischer Entscheidungen zu versuchen, als genialen Schachzug – und plaudert so ganz nebenbei in seiner Begeisterung aus, dass sich mit Geld natürlich Zustimmung erkaufen lässt, denn womit sonst sollten sich eigentlich „Interessen der Länder“ hierzulande „vertreten“ lassen. Man muss die Millionen halt nur in aller Öffentlichkeit und nicht in dunklen Kassen verteilen, dann leuchtet jedem Demokraten ein: „Das waren die besseren Argumente.“ (SZ, 15/16.7.)
Wer dagegen, wie der Fraktionsvorsitzende der CDU, Merz, giftet, so würde „der Föderalismus erst gekauft und dann zerstört“, outet sich als „schlechter Verlierer“. Und als ein ungeschickter obendrein: Schließlich hat seine Partei in Sachen Bestechlichkeitsvorwürfen doch noch offene Rechnungen, die so nur jedem – zumindest hämischen Naturen in der SZ-Redaktion – gleich wieder einfallen. Und unter diesem Gesichtspunkt eröffnet sich für professionelle Politbeobachter die eigentlich heiße Kost nach der „dramatischen Nacht“ im Bundesrat: die
„Niederlage der Union“
Die Opposition hat nicht einfach eine Abstimmung verloren, sondern ist „fulminant“, „ohne wenn und aber“ und äußerst „blamabel“ gescheitert, wo sie unbedingt hätte gewinnen müssen: im „ersten Testlauf“ für den „Neuanfang der Partei“ nach Kohl. „Das Fiasko der neuen Partei und Fraktionsführung bei der Abstimmung im Bundesrat ist ein Triumph für den Altbundeskanzler, es ist Wasser auf die Mühlen der Selbstgerechtigkeit des Helmut Kohl.“ (SZ, 17.7.) Weil sich von einem ehedem erfolgreichen Vorsitzenden nur „absetzen“ kann, wer selbst Erfolg hat, spricht alles für den alten Dicken, was seinen Nachfolgern misslingt: So schlicht gestrickt ist das demokratische Gemüt.
Seit die Union sich im Bundesrat blamiert hat, ist also ihr „Dilemma“ für alle wieder offenbar: „Sie ist kopf-, profil- und erfolglos.“ (Der Spiegel, Nr.29) Ihren neuen Köpfen ist nicht gelungen, was ein neuer Parteikopf können muss: ordentliche Seilschaften bilden, die Partei in den Ländern (ja, auch mit Geld) auf Linie bringen, Konkurrenten in ihre Schranken verweisen und so aus der Partei ein „Kraftzentrum“ machen – genauso eines, wie sie es schon mal unter dem alten Parteiführer war. Eine Führungsspitze, die noch nicht mal „genug Respekt genießt“, um im eigenen Haufen Gehorsam zu erzwingen, verliert auch beim demokratischen Beobachter postwendend an Respekt. Der glaubt ihr dann nicht mehr so recht, dass sie die Macht im Staate, sprich seinen Gehorsam verdient. Kein Wunder also, wenn ihre Partei noch immer „von der Vergangenheitsbewältigung zerrissen“ wird.
Kaum steht als neuer Hauptleidtragender der Steuerreform die CDU fest, häufen sich die guten Ratschläge. Wer nämlich erst über eine „Verhinderungsmehrheit im Bundesrat“ verfügt und dann noch nicht mal etwas daraus machen kann, muss neben mangelnder Führungsstärke auch
„taktisches Ungeschick“
bewiesen haben. Gottlob mangelt es nicht an Leuten, die im Nachhinein genau wissen, wie man es hätte besser machen können. Der erste Fehler war die Wahl des Themas selbst. Das als oppositioneller Hauptkampfschlager gedachte Thema ‚Steuerreform‘ entpuppt sich für die Union als Rohrkrepierer. Spätestens danach glaubt ihr auch keiner mehr, dass sie überhaupt „ihre Ablehnung schlüssig zu begründen“ (FAZ, 15.7.) vermocht hätte. „Weil große Teile der deutschen Wirtschaft sich in Sachen Steuerreform auf die Seite der Regierung geschlagen“ (ebd.) haben, eignet sich das Thema nicht mehr. Vorbei also mit der „Rettung“ des „kleinen Mannes“ namens „Mittelstand“ vor der rot-grünen Steuerreform; lieber auf bewährte Erfolgsrezepte wie Ausländerfeindschaft, Kampfhunde und Homosexuellenehe zurückgreifen, als den Kanzler „auf einem Feld schlagen“ zu wollen, wo er unschlagbar sein muss. Zweitens hätte die Parteiführung also nicht das taktische Modell der „Totalablehnung“ fahren sollen, was es ihr jetzt leichter gemacht hätte „das Gesicht zu wahren“; oder doch zumindest drittens rechtzeitig das „Bröckeln“ in der „Ablehnungsfront“ erspüren und das Signal zum einstimmigen Umschwenken geben müssen. Dann nämlich hätte sich der Erfolg der Regierung als Erfolg der Union verkaufen lassen. Soviel zu den berühmten „Sachfragen“ und „politischen Inhalten“. Altgediente Parteistrategen und publizistische Besserwisser im Verein geben Auskunft darüber, was sie in der Demokratie sind: Mittel zum Zweck der Profilierung in der Konkurrenz um die Macht im Staate. Wer sich mit einem „Inhalt“ nicht profiliert, kann ihn über Bord gehen lassen, oder hätte sich am besten gleich einen anderen gesucht. Mal wieder argwöhnt kein noch so skeptischer Beobachter darin einen Verrat z.B. am Steuerzahler, alle widmen sich ganz einer ihrer Lieblingsfragen:
Wer ist wie beschädigt?
Das ist zum einen der Fraktionschef. Merz ist „durchgefallen“, „einen Kopf kürzer gemacht“, und überhaupt zeigt sich erst jetzt: Er war „zweite Wahl, ohne dass es eine erste gegeben hätte.“ (SZ, 24.7.) Nachdem es ihm nicht gelungen ist, sie zum Erfolg und damit „zusammen zu führen“, hat die Partei ihn nicht mehr lieb und gibt ganz nebenbei noch selber zu, dass sie erst neulich bereit war, einen Mann als „Träger des Neuanfangs“ zu bejubeln, der doch bloß eine „Notlösung“ gewesen war.
Ungeschickt, dass Merz als „Steuerfachmann und nicht als Oppositionsführer argumentiert“ und sich „in die erste Reihe gedrängt“ hat. Das sollten Chefs nicht machen, weil sie dann nur persönlich „für das miserable Ergebnis haftbar gemacht“ werden. In der ersten Reihe soll der Bürger als Wähler keine Fachleute sehen, sondern geschickte Taktierer, die – siehe Kanzler – vielleicht nichts von Steuern verstehen, dafür aber Erfolge vorzuweisen haben. Merz ist also „am stärksten beschädigt“. Andererseits kann die CDU nicht alle vier Wochen einen neuen Fraktionschef wählen – insofern hat er noch mal Glück gehabt.
Dann ist da die Parteivorsitzende, die bedröppelt eingestehen muss, dass sie „jetzt in der Opposition ist“. Merkel – so merkt man – muss also noch „viel lernen“. Vor allem: An der Macht zu sein, das bedeutet: „sich durchsetzen“, sich nicht zu einer „Hardliner-Strategie“ drängen lassen, die dann nichts bringt, aus der „Schwäche“ der anderen ihre Stärke machen, eben „die Partei führen“. Das beherzigt, könnte sie doch noch „zur Gewinnerin“ des „Schwarzen Freitags“ der CDU werden. Ihren guten Wille dazu stellt sie gleich unter Beweis, indem sie einen guten Rat (s.o.) in die Tat umsetzt und sich energisch in die nächste „Sachfrage“ stürzt. Aber vielleicht ist das Einschwören der Partei gegen den rot-grünen „Irrweg“ einer „Homo-Ehe“ ja schon wieder als „Thema völlig ungeeignet für eine Kampagne“, und damit auch ungeeignet, um aus dem „sympathischen Werbeträger“ Merkel ein echtes „Symbol des Neuanfangs“, sprich einen neuen Kohl, der aus dem Osten kommt und Angela heißt, zu machen.
Jedenfalls ist jedem Beobachter klar, dass sich in der CDU eine „Neusortierung der Machtverhältnisse“ anbahnt – was ist dagegen schon die kleinliche Betrachtungsweise, wer demnächst wieviel Steuern zahlt.
Denn da gibt es ja auch noch einen Vorsitzenden der Schwesterpartei, nebst seiner nie offen verkündeten, aber darum jedem nur um so besser bekannten Ambition. Die Frage nach dem „Grad der Beschädigung“ eines Stoiber verknüpft sich dort mit der für demokratische Gemüter noch ungleich spannenderen Frage nach dem nächsten Kanzlerkandidaten. Wie Stoibers Chancen zur Kandidatenkür nach dem „Debakel“ gestiegen oder gesunken sind; ob es ihm gelingt, die Niederlage den „Weichei-ern“ in der Union anzuhängen, oder ob nicht vielmehr die Abstimmung von einem „Akt der Notwehr“ gegen seine „Arroganz“ zeugt, also ihn besonders „trifft“; ob er die Landesverbände nun endgültig gegen sich hat, oder ob es ihm gelingt, „Rache an den Verrätern“ zu nehmen – niemand hält solche Erkundigungen für eine widerwärtige Beschäftigung. Im Gegenteil: Die persönlichen Karrierechancen – immerhin, die angestrebte Karriere ist die einer Ermächtigung zum souveränen Gebrauch der politischen Gewalt – ehrgeiziger Parteirivalen verständnisvoll zu verfolgen, ist das Genussobjekt und Ausweis politischen Auskennertums für den demokratischen Untertan. Bei dem ist angekommen, woran die politischen Herren sich messen lassen wollen: Durchsetzungsfähigkeit im parteiinternen Machtpoker. So werden die Probleme der Mächtigen mit der Macht problematisiert, mit jeweils plus und minus kommentiert; und daran – so ist die Demokratie gestrickt – entscheidet sich dann wirklich, ob jemand einmal Kanzler wird, oder ob ihn schon im Vorfeld der frühe Kandidatentod ereilt.
Wen interessieren da noch Steuern.