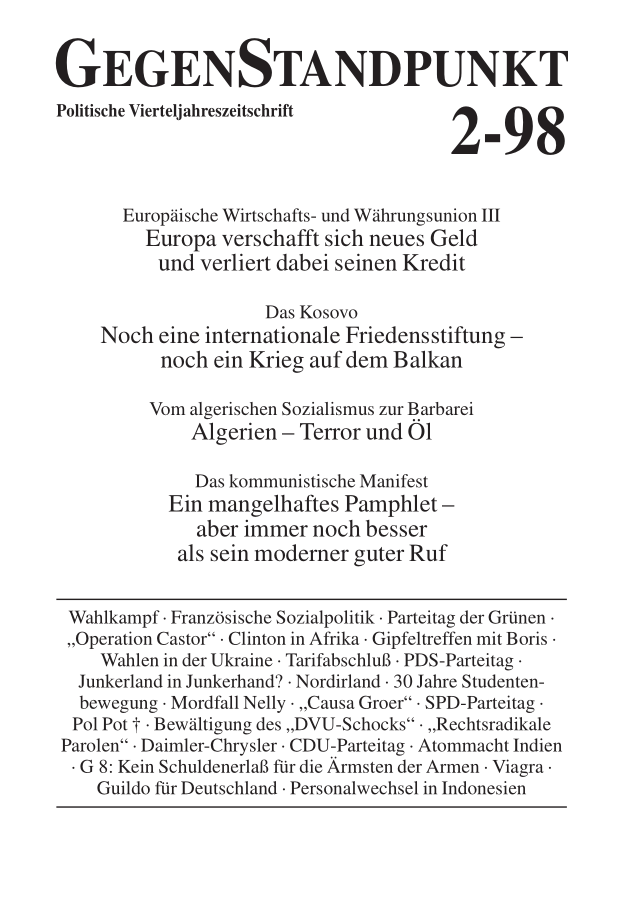Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
PDS-Parteitag in Rostock:
Sozialismus als „Mitarbeitsfähigkeit“
Die PDS hält in Rostock ihren Parteitag ab. Sie verabschiedet dort ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst und teilt der Nation mit: Sie sei zwar noch hauptsächlich im Osten des wiedervereinigten Vaterlands verankert und dem dort besonders schlecht behandelten Volk besonders zugetan und verpflichtet; sie sei aber nach wie vor entschlossen, auch unter den Unterprivilegierten in den alten Bundesländern mindestens 2 Prozent Wählerstimmen zu erobern; denn sie sei – nachdem die SPD auf Gerhard Schröders Rechtskurs eingeschwenkt ist – die, und zwar die einzige sozialistische Oppositionspartei in Deutschland. Sie präsentiert sich in dem Bewußtsein und mit dem Anspruch und wirbt damit, eine politische Position zu besetzen, die zur Demokratie nun einmal dazugehört und quasi vakant bliebe, wenn es sie nicht gäbe.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
PDS-Parteitag in Rostock:
Sozialismus als „Mitarbeitsfähigkeit“
Die PDS hält in Rostock ihren Parteitag ab. Sie verabschiedet dort ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst und teilt der Nation mit: Sie sei zwar noch hauptsächlich im Osten des wiedervereinigten Vaterlands verankert und dem dort besonders schlecht behandelten Volk besonders zugetan und verpflichtet; sie sei aber nach wie vor entschlossen, auch unter den Unterprivilegierten in den alten Bundesländern mindestens 2 Prozent Wählerstimmen zu erobern; denn sie sei – nachdem die SPD auf Gerhard Schröders Rechtskurs eingeschwenkt ist – die, und zwar die einzige sozialistische Oppositionspartei in Deutschland. Sie präsentiert sich in dem Bewußtsein und mit dem Anspruch und wirbt damit, eine politische Position zu besetzen, die zur Demokratie nun einmal dazugehört und quasi vakant bliebe, wenn es sie nicht gäbe.
Und hat damit nur allzu recht. Denn:
- Im Gesamtkunstwerk des demokratisierten Klassenstaats hat die sozialistische Linke als Normvariante des falschen staatsbürgerlichen Willens, Bewußtseins und Engagements ihr systematisch vorgezeichnetes festes Plätzchen.
- In der Demokratie haben alle gesellschaftlichen Interessen ein Recht darauf, sich politisch, als Beitrag zum Funktionieren des Gesamtladens, zu Wort zu melden; und es finden sich Parteien, die dieses Recht stellvertretend wahrnehmen. In diesem Sinne wird auch die berechtigte Sorge einer ganzen gesellschaftlichen Klasse, in den Pauperismus abzurutschen bzw. nicht mehr aus ihm herauszukommen, einfühlsam bedient: Sogar Regierungsparteien empfehlen sich den Opfern des nationalen Kapitalismus, den sie organisieren, als Anwälte ihrer Nöte und Interessen. Bei so machtvoller Repräsentation der berechtigten Anliegen des politökonomischen Bodensatzes der Gesellschaft bleibt verständlicherweise trotzdem immer eine gewisse Unzufriedenheit übrig. Dieser Rest wird traditionell von einer Opposition betreut, die ihre durchaus dauerhafte Berufung darin sieht, für eine grundsätzlich bessere staatliche Behandlung der systematisch erzeugten Armut einzutreten – deren schlechte Behandlung wäre nämlich gar nicht unbedingt nötig, würde den Reichen nur etwas mehr von ihrem Reichtum abgezwackt. So wird aus materieller Unzufriedenheit eine verkehrte Minderheitenmeinung. Die Parteien, die dem Klassenstaat diesen Dienst tun, tragen den Traditionsnamen sozialistisch.
- Im demokratischen Gemeinwesen darf sich überhaupt jeder mit politischen Verbesserungsvorschlägen zu Wort melden und die Vorstellung pflegen, per Wahl würden die Politiker dazu verpflichtet, darauf auch zu hören. Da die jeweils regierenden Parteien diesen Irrglauben regelmäßig blamieren – sie entnehmen dem Wahlakt ganz systemgemäß ihr unwidersprechliches Recht auf den freiwilligen Gehorsam der Regierten –, hält sich unter dessen hartnäckigen Anhängern die radikale Minderheitenmeinung, eigentlich wären demokratische Wahlbürger zu viel mehr Einflußnahme auf die Mächtigen berechtigt und diese durch ihr demokratisches Amt dazu verpflichtet, ihrem Volk entsprechende Chancen zu eröffnen. Daß demokratische Macht unübersehbar anders funktioniert, gilt ihnen als undemokratische Entgleisung. Diese Täuschung gehört zum Traditionsbestand der Linken.
- Der bürgerliche Staat hat in der ganzen Welt nationale Interessen durchzusetzen und zu sichern. Daß das ohne Androhung und gelegentliche Anwendung von militärischer Gewalt nicht geht, spricht nicht gerade für diese Interessen. Daher pflegen demokratische Nationen ihre Kriege zu rechtfertigen, und zwar sehr fundamentalistisch unter dem Titel ‚Verantwortung‘, mit handfesten Feindbildern sowie durch das Ziel, mit dem Krieg auch wieder aufzuhören, sobald sie alles in ihrem Sinn geordnet haben – der Erfolg heißt dann ‚Frieden‘ und sieht im Vergleich zu seinem notwendigen Mittel, dem Krieg, sehr angenehm und wie dessen Gegenteil aus. Mit diesem handfesten Schein eines Gegensatzes zwischen dem politischen Zweck ihrer globalen Einmischung – ‚Frieden‘ – und dessen Mittel – militärische Gewalt – handeln imperialistische Nationen sich eine Sorte Anhänger ein, die das ein bißchen zu radikal verstehen und im Namen des Friedens eine prinzipielle Skepsis gegen die guten Gründe ihrer Staatsmacht für militärische Gewalttätigkeiten sowie ein generelles Mißtrauen gegen die Profis dieses ehrenwerten Geschäfts entwickeln. Als etwas weltfremde Minderheitenmeinung ist auch diese antimilitaristische „Grundhaltung“ in der imperialistischen Demokratie genehmigt, aus ihrem ideologischen Arsenal kaum wegzudenken und nach der parlamentarischen Systematik auf der Linken zu Hause.
- Schließlich ist der demokratische Staat auch noch das Vaterland seiner Insassen und erwartet als solches eine grundsätzliche Parteilichkeit von den Leuten: Die sollen es schätzen, zu ihm zu gehören. Das tun die meisten auch mehr oder weniger; sozialistische Linke allerdings nur in Verbindung mit dem heftigen Antrag, sich mit ihrer Minderheitenmeinung unter dem bürgerlichen Gewaltmonopol mit nationalem Eigennamen auch gut aufgehoben wissen zu dürfen; das Ergebnis ist dann regelmäßig ein gepflegtes patriotisches „Leiden an der Nation“. Allen Volksgenossen, die einfach so zu ihrem nationalen Kollektiv stehen, wirft diese Minderheit „blinden Nationalismus“ vor, distanziert sich von der Art, wie der Staat diesen -ismus bedient, und bekennt sich zu einer antinationalistischen Heimatliebe. Auch das wird in der Demokratie, in friedlichen Zeiten jedenfalls, als Normvariante toleriert.
- Mehr als diese Positionen besetzen und im Parlament vertreten will die PDS tatsächlich nicht. Und durchaus richtig liegt sie mit ihrer Einschätzung, daß das im heutigen Deutschland außer ihr niemand macht.
- In der Abteilung ‚Soziales‘ ist jedes Plädoyer für eine anständige Behandlung der vom Pauperismus bedrohten Mehrheit im allgemeinen und der von diesem „Schicksal“ ereilten Minderheit im besonderen längst in dem Schrei nach „Arbeit!“ untergegangen. Alle Momente von sozialistischem Protest gegen drohende und stattfindende Verelendung haben sich aufgelöst in der unterwürfig-„realistischen“ Anerkennung der beiden Bedingungen, die die Arbeitgeber der Nation für die Gnade der „Beschäftigung“ von „Mitarbeitern“ stellen und die sowieso gelten: mehr Leistung für weniger Geld.
- Der radikaldemokratische Wunsch nach mehr „Basisnähe“ der Mächtigen und stärkerer Bürgerbeteiligung an deren Sorgen hat sich in dem Maße erledigt, in dem diejenigen Linken, die ihn am heftigsten vorgebracht haben, als parlamentarische Partei Karriere gemacht haben und in die Nähe der Regierungsmacht gelangt sind. Seither erfüllt sich auch für sie das Ideal der Herrschaftsfreiheit in der Beteiligung westlicher wie östlicher ‚Bürgerrechtler‘ an der freien Konkurrenz um die Macht.
- Für den antimilitaristischen Bürgerprotest sind längst die goldenen Zeiten vorbei, als die Vorbereitung eines Atomkriegs in Europa selbst an sich kriegsbereite Patrioten um den Fortbestand ihres heimatlichen Frontstaats im Ernstfall fürchten ließ. Mittlerweile entdecken auch die ehemaligen Idealisten einer gewaltfreien Staatenwelt den Unterschied zwischen Ideal und Realität – und zielsicher überall dort, wo die Weltordnungsmächte Feinde ihrer Sache ausmachen und aufmischen, eine unabweisbare sittliche Verpflichtung ihres Heimatstaates zu bewaffnetem Eingreifen.
- Erledigt hat sich schließlich auch der langjährige bundesdeutsche Widerspruch, daß das Bekenntnis zur real existierenden freiheitlich-kapitalistischen Heimatmacht praktisch eine Relativierung der Parteilichkeit fürs einzig wahre, aber eben ein wenig irreale Gesamt- Großdeutschland bedeutete und die Sehnsucht nach dessen Wiederherstellung unter dem Vorbehalt einer politisch-moralischen Absage an den letzten gesamtheitlichen Vorgängerstaat stand. Inzwischen bekennen sich linke Verfechter eines antifaschistischen „Verfassungspatriotismus“ zur pur nationalen „Identität“ ihrer politischen Triebe.
Insofern also: freie Bahn für die PDS. Keine parlamentarische Partei macht ihr linke, sozialistische, antimilitaristische, Nationalismus-kritische Positionen streitig.
- Und die Partei wirft sich in die Bresche. Sie füllt glatt die parteipolitische Lücke im demokratischen Spektrum. Sie vertritt den Sozialismus, den sonst niemand vertreten mag – und das noch viel schlechter, als er ohnehin schon ist.
- Die Masse ihrer Mitglieder bedient die PDS mit Sozialismus in Gestalt einer durch sie verkörperten Tradition: Sie steht programmatisch für die guten Absichten der untergegangenen DDR, nämlich „Wirtschafts- und Sozialpolitik“ unauflöslich zu „vereinigen“, keinerlei Dissens zwischen der Staatspartei und der regierten Basis aufkommen zu lassen und das Monopol der kapitalistischen Mächte auf Definition und Herstellung des Weltfriedens zu brechen. Alle Differenzen zum normalen Gang der Dinge im Klassenstaat, die im Programm einer sozialistischen Linken stecken, gehen auf in der Erinnerung, daß die DDR mit ihrer Sorte Staatsräson dieses Programm allemal eher eingelöst hat als die BRD, die das überhaupt nie wollte. Dabei macht die Partei zugleich zweifelsfrei klar, daß sie niemanden in ihren Reihen duldet, der so etwas wie eine Rückkehr zu den „alten Zeiten“ befürwortet: Die Zustimmung zur bundesdeutschen Demokratie rangiert eindeutig und weit vor allem Sozialistischen an der alten DDR, an das die Überreste der einstigen Massenbasis des Arbeiter- und Bauern-Staats so gerne zurückdenken. Der ganze oppositionelle Anspruch der PDS reduziert sich somit auf den Wunsch, dem alternativen Patriotismus von einst im neuen Gesamtdeutschland seinen gerechten Platz zuzubilligen.
- Ihren Wählern in Gesamtdeutschlands neuer Ostzone empfiehlt die Partei ihren demokratischen Sozialismus als Standpunkt entschiedenster Beschwerdeführung über die ungleiche Behandlung des zum bundesdeutschen Stammland hinzuaddierten Volksteils. Sie fordert wirkliche Gleichberechtigung sowie eine in die Vergangenheit zurückreichende menschlich-staatsbürgerliche Anerkennung der guten Leutchen im Osten, als vollwertige Deutsche nämlich. So bringt sie die sozialistische Empörung über die Ausgrenzung und Drangsalierung der redlichen Armut und die linke Sehnsucht nach mehr Bürgerrechten auf das Ideal einer Volksgemeinschaft ohne west-östliche Diskriminierung herunter. Sozialistische Parteinahme für die „Erniedrigten und Beleidigten“ als Angebot an beleidigte Patrioten – diese Metamorphose des staatsbürgerlichen Linksradikalismus wird auch dadurch nicht besser, daß es das Ressentiment des Mehrheitsvolks gegen die ex-realsozialistischen Nachzügler zweifellos gibt und die Diskriminierung natürlich von der stärkeren Seite ausgeht.
- In den alten Bundesländern schließlich will sich die PDS mit dem Angebot bemerkbar und ein wenig beliebt machen, allen eine politische Heimstatt in Berlin zu bieten, die sich in der alten BRD genausowenig akzeptiert vorkommen wie die enttäuschten Teile des Ex-DDR-Volks. Ihr Sozialismus gerät damit zum methodischen gemeinsamen Nenner aller möglichen Spielarten eines unglücklichen Nationalbewußtseins. Voll erhalten bleibt allein der traditionsreiche Fehler, an keinem aufgegriffenen „Mißstand“ dessen Systemnotwendigkeit zu kritisieren, sondern Betreuung durch die Staatsmacht zu fordern und diese Forderung durch parlamentarische Repräsentation einzulösen.
Der Sozialismus, um den die PDS den bundesdeutschen Parteienpluralismus ergänzt, ist ein – umfassend angelegtes, vor allem auf Ex-DDRler ausgerichtetes und dort auch wirksames – Integrationsprogramm für Außenseiter der neuen deutschen Volksgemeinschaft.
- Der konstruktive politische Wille, den die PDS programmatisch vorträgt, nützt ihr bei den Stammparteien des demokratischen Gemeinwesens überhaupt nichts. Die haben einen Konkurrenzverein am Hals, den sie sich beim Anschluß der DDR wahrhaftig nicht mitbestellt haben; und der hat nicht bloß viel zuviel Erfolg im Osten, sondern das auch noch viel zu dauerhaft. Für die Parteien des bundesdeutschen „Verfassungsbogens“ ist das längst Grund genug für den Beschluß, das PDS-Programm als fortdauernden DDR-sozialistischen Verrat an Deutschlands Einheit und Parteinahme für ein „verbrecherisches System“ und „Regime“ zu denunzieren und die Partei strikt und apodiktisch auszugrenzen. An Bündnissen überall dort, wo es ihrer lokalen und regionalen Machtposition nützt, lassen sie sich dadurch zwar keineswegs hindern. Diese Bündeleien wiederum relativieren aber keineswegs den berechnenden Fundamentalismus ihrer Absage: Im Großen, auf Bundesebene, gilt unverbrüchlich die Politik der Nicht-Anerkennung der PDS als bündnisfähige parlamentarische Kraft.
Auf diese Ausgrenzung, die auf Vernichtung der Partei zielt, reagiert die PDS im schlechtesten Sinne defensiv. Daß sie mit ihren Bedenken gegen den Einbruch der bundesdeutschen Realität in Deutschlands Osten der DDR ideologisch die Treue hielte, begreift und akzeptiert sie als Vorwurf, gegen den sie sich rechtfertigen muß. Und das tut sie ausführlich: Auf die Abgrenzung gegen den längst obsoleten „Stalinismus“ der SED verschwendet sie mehr Diskussionszeit und mehr Einsatz zur Gleichschaltung abweichender Theorien als auf eine Kritik der beklagten kapitalistischen „Mißstände“. Was dann schließlich deren Bekämpfung angeht, so knüpft die Nachfolgepartei der SED konsequent an die schäbigste Tradition des demokratischen Sozialismus an: Nachdem jede Unzufriedenheit mit „den Verhältnissen“ – gleichviel ob „Kapitalismus“ oder „Treuhand-Mißwirtschaft“ – programmatisch Recht bekommen hat, wird jegliches Moment von Distanz zu „den Verhältnissen“ der tiefen und weisen Einsicht geopfert, daß, wer an diesen „etwas ändern“ will, in ihnen und nach deren Regeln mitmachen muß; ganz gleich, was dann noch an „Veränderung“ drin ist. Was als linke „Kritik“ anfängt, gerät so zum Dementi jeder Gegnerschaft und zur Revision jeder praktischen Abgrenzung gegen die beklagten „Zustände“. Damit bleibt es – wieder einmal und wie schon die ganze traurige „Geschichte der Arbeiterbewegung“ hindurch – den politischen Gegnern überlassen, auf der Unvereinbarkeit der linken und sozialistischen Parteiziele mit dem kapitalistisch-sozialstaatlichen und parlamentarischen Status quo zu bestehen und den parteioffiziellen Widerruf aller Programmpunkte, die nach einem destruktiven „Anti“ klingen, als verlogen zu „entlarven“. Das wiederum finden die linken Sozialisten erst recht gemein; und sie haben einen Grund mehr, Ungerechtigkeiten zu bejammern – diesmal eine, die ihnen als kreuzbraver Partei angetan wird. Und daraus ziehen sie seit jeher nur den einen Schluß: sich den bestehenden Kräfteverhältnissen noch nicht genau genug angeschmiegt zu haben, also noch konformistischer werden zu müssen.
Ganz in diesem Sinne nimmt die PDS sich einmal mehr ganz fest vor, nicht bloß opportunistisch zu sein und überall, wo es geht, mit den anderen Parteien zu deren Konditionen zu bündeln, sondern auch im Großen ihre geschworenen Feinde, die etablierten BRD-Parteien, von der Bedingungslosigkeit ihres Opportunismus zu überzeugen, um deren Ausgrenzungsbeschluß zu knacken. Ihre Kampfparole dafür heißt
Mitarbeitsfähigkeit
und bezeichnet gar keine „Fähigkeit“, die die Partei sich aneignen müßte – außer der zur gekonnten Verleugnung systemkritischer Anklänge in ihrem Programm, über die sie längst verfügt: Die angestrebte Tugend besteht in der puren Hoffnung, von den derzeitigen Oppositionsparteien für die Übernahme der Regierungsmacht, schließlich auch in Bonn/Berlin, benötigt und benutzt zu werden. Einem Schröder die parlamentarischen Steigbügel halten zu dürfen – eben dem Gerhard Schröder, dessen SPD mit ihrem „Rechtsruck“ das ganze weite Feld des demokratischen Sozialismus der PDS ganz allein überlassen hat; den zynischen Kalkulationen der etablierten Bonner Opposition willfährig und ohne eigene Ansprüche zu entsprechen – nur um so als nützliche Kraft im Parlament Anerkennung zu finden: Das ist derrealistische
Kern des Sozialismus, den die Bisky-Gysi-Truppe vertritt.
*
Die PDS schätzt „die Geschichte“ als Lehrmeister über alles. Deswegen noch einmal anders gesagt: Warum wird immer so wenig aus den Alternativen, für die und mit denen demokratische Oppositionsparteien – je radikaler, um so alternativer und umgekehrt – zu werben pflegen? Verbesserungsvorschläge in Sachen Führung & Leitung der Nation, von der Verwaltung der Armut über den zweckmäßigen Gebrauch des Steueraufkommens und der Staatsschuld bis hin zum garantiert friedlichen Einsatz des nationalen Gewichts in der Außenpolitik, sind – wie abweichend auch immer – praktizierter Nationalismus. Deswegen werden ihre alternativen Seiten noch allemal der „Politikfähigkeit“ und dem „Realismus“, dem „konkreten Teilerfolg“ und „vorläufig Machbaren“ Zug um Zug geopfert. – Freilich ist es aus demselben Grund auch nicht schade darum…