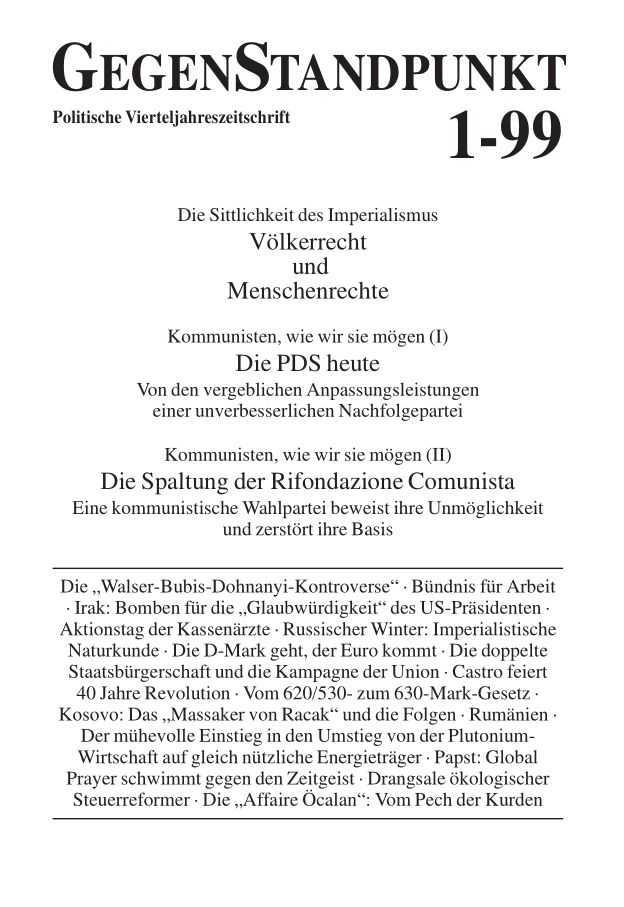Kommunisten, wie wir sie mögen (I)
Die PDS heute
Von den vergeblichen Anpassungsleistungen einer unverbesserlichen Nachfolgepartei
„Gnadenlos normaler“ Nationalismus – von unten, von links und vor allem vom Osten her! Dagegen steht die Einheitsfront der Demokraten mit ihrem Verfassungsschutz-Patriotismus. Denn die PDS stört wg. Erfolg und sie vertritt den Zoni – das ist verdächtig und hat Konsequenzen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Kommunisten, wie wir sie mögen
(I)
Die PDS heute
Von den vergeblichen
Anpassungsleistungen einer unverbesserlichen
Nachfolgepartei
10 Jahre nach dem Anschluß ist die Nachfolgerin der ehemaligen Staatspartei der DDR in der politischen Landschaft des anschließenden Staates eine feste Größe. Erneut ins Parlament gewählt, erstmals an einer Landesregierung beteiligt: Ihre Anhänger halten das für einen schönen Erfolg, ihre Feinde – alle Träger des demokratischen „Verfassungsbogens“ in Regierung und Opposition – für einen unerträglichen Zustand. Was die PDS treibt, ist eine Sache: Sie ist bei allen Problemstellungen und -lösungen, die diese feine Nation kennt, wenn nicht mit Tat, so doch stets mit Rat dabei. Daß die PDS es ist, die das treibt und überall dabei ist, die andere – und entscheidende. Die nicht, lautet das einstimmige und vernichtende Urteil der politischen und öffentlichen Front gegen „Honeckers Erben“ – in Rat und Tat. Die einen strengen sich an, jede Abweichung vom allgültigen Konsens der gewachsenen Nation, die man ihr vorwarf oder die sie selbst als Mangel verspürte, zu tilgen; die maßgeblichen Vertreter der Republik halten an dem prinzipiellen Vorbehalt fest, daß eine parteiliche Anwältin der menschlichen Erbmasse des einkassierten „Unrechtsregimes“ in diesem Gemeinwesen nichts zu suchen hat. – Ein schwer auflösbarer Konflikt.
Die Politik der PDS: „Gnadenlos normaler“ Nationalismus
Mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, diesmal in
Fraktionsstärke und unter einer rot-grünen Regierung,
sieht die PDS-Spitze die Zeit gekommen: Nicht krasse
Opposition, sondern antreibende Unterstützung
(Gysi)
steht auf ihrer Tagesordnung. 39mal Beifall aus den
Reihen der PDS während der Regierungserklärung Gerhard
Schröders
, zählt die Frankfurter Rundschau und
zitiert Lothar Biskys Herzenswunsch: Nach der Phase
der Ausgrenzung beginne nun die Zeit der ‚gnadenlosen
Normalität‘
. Wobei das Moment von Zumutung, auf das
der Vorsitzende anspielt, offenbar geringer wiegt als die
erhoffte Prämie der neuen Oppositionsrolle: Von der
Ankündigung solidarischer Klapse für das neue
Herrschaftspersonal, zu dem sie eine „größere Nähe“ als
zu Kohl verspürt, erwartet die PDS ihre
Anerkennung als gnadenlos normale Partei. Unter
Erinnerung an ihre ehedem ein wenig krasser vorgetragene
Kritik an „pur“ kapitalistischen Lebensverhältnissen und
„un“demokratischer Machtverteilung sieht sie sich da
angekommen, wo sie immer hin wollte: Die Partei ist auf
dem guten Weg zur Mitverantwortung
.
Und das nicht etwa, weil sie mit der Kritik gebrochen
hätte; sie hat sie nur konsequent zu Ende gedacht: Wer
immerzu mit Verbesserungvorschlägen in Sachen
Leitung der Nation aufwartet; wer die Politik
von der sozialfürsorglichen Verwaltung der Armut über den
zweckmäßigen Gebrauch des Steueraufkommens und der
Staatsschuld bis hin zum garantiert friedlichen Einsatz
nationalen Gewichts in der Außenpolitik für rundum
verbesserungsfähig, also auch
verbesserungswert hält; der muß sich bald selber
die Frage stellen, ob er krampfhaft auf den
alternativen Seiten seines praktizierten
Nationalismus besteht oder lieber am ‚Machbaren‘
mitstrickt, das zwar immer nur ‚vorläufig‘, dafür aber
bestechend ‚konkret‘ ist. Die Chance,
Politikfähigkeit
nachzuweisen, ist jetzt da – die
PDS wird in zwei ostdeutschen Landtagen von der SPD zum
Regieren gebraucht, erhält eine Bundestagsvizepräsidentin
und darf im Vorsitz des Petitionsausschusses
Beschwerdebriefe ihrer Landsleute beantworten –, wird
weidlich genutzt und ruft zugleich das innerparteiliche
Gewissen auf den Plan. Die Süddeutsche Zeitung berichtet
vom Berliner Parteitag 1999:
„Jungkommunistin Sahra Wagenknecht fürchtet um die sozialistische Identität der Partei. Sie warnt vor dem Verlust von Glaubwürdigkeit: ‚Wenn das unser Weg ist, Genossen, wo gehen wir dann hin? Mir graut vor dem Tag, an dem die PDS ihren Schily und ihren Fischer hat!‘“
Irgendwie muß die Frau etwas verpaßt haben. Ihr
verbissenes Engagement für Glaubwürdigkeit läßt sie
einfach nicht glauben, was kaum zu übersehen ist: Die PDS
geht nirgendwo hin, sie ist längst angekommen;
nicht eines gruseligen Tages wird sie ihren Schily und
ihren Fischer haben, sie hat einen Bisky und
einen Gysi. Und die haben – wie es gute
demokratische Sitte ist, sofern sie in keiner
DDR-Volkskammer stattfindet – die Mehrheit, also das
Sagen, also recht: Sahra hat rhetorisches Talent, aber
sie hat keine Mehrheit. In einer Partei kommt es darauf
an, was sich durchsetzt, nicht so sehr darauf, was es
alles gibt
(Gysi).
Was sich in der PDS durchsetzt: Das sind tiefe Einsichten in die Kunst verantwortlichen Handelns. Was sie – per Zustimmung in Bonn, im Magdeburger „Tolerierungsmodell“ oder als Koalitionspartner in Meck-Pomm – an der Macht zum Wohle der Nation anstellt, das ist sie ihren Wählern schuldig. Den doppelsinnigen Gebrauch von ‚Verantwortung‘ beherrscht die PDS wie jede andere Partei; nicht normal ist lediglich der zusätzliche Rechtfertigungsbedarf, der davon rührt, daß die PDS von woanders herkommt:
„PDS – das heißt: Politik von unten, von links und vom Osten her!“ (Biskys Parteitagsrede).
Erstens: Von unten!
Mit der Programmatik fiel die PDS einerseits noch nie groß aus der Rolle, weil auch keine andere Partei auf die Idee käme, mit der Selbstverständlichkeit zu werben, „Politik von oben“ zu machen. Woher denn sonst? Für das Unten, für wen denn sonst, als dessen Oben sie sich regelmäßig ermächtigen lassen, machen Volksparteien Politik, was ein einziges Angebot ist: Wir regieren das Land und seine Leute, und das sogar besser als die Konkurrenz. Andererseits war das „von unten“ bei der PDS als zunächst notorischer Oppositionspartei immer etwas anders gemeint: Die Macht hätte gerade dem einfachen Volk eher zu geben als von ihm zu nehmen. Dieses wohlmeinende Dogma aus der Schatzkiste gutpolitisierter Untertanen ist nun umzudefinieren. Denn die Freunde des Unten mögen sich zwar immer noch mehr der Broiler- als der Kaviarperspektive verbunden fühlen, sind aber zweifelsfrei oben: In den Anstalten demokratischer Herrschaftsausübung eben – und deren Maßstäbe bilden jetzt die Richtschnur ihres Handelns. Die Hoffnung auf den Staat als Erfüllungsgehilfen eines besseren Lebens muß die PDS dafür nicht einmal kritisieren; der Standpunkt der Obrigkeit erniedrigt jedes persönliche Bedürfnis schon ganz von selbst zum bloß ‚Wünschbaren‘, dessen Erfüllbarkeit vom wirklich ‚Machbaren‘ abhängt. Zur Erklärung dieses Übergangs bemüht die PDS in der Tat den Blickwinkel „von unten“; die volkstümliche Ideologie von der begrenzten Haushaltskasse des Staates, die genauso leer sei wie die meisten Sparbücher in DM-Besitzer verwandelter Arbeiter und Bauern, ist zur Selbstdarstellung einer linken Partei ‚in der Verantwortung‘ – die nie so kann, wie sie will, das aber feste! –, wunderbar geeignet:
Zweitens: Von links!
„Da, wo die PDS in der Verantwortung stehe, könne ‚nur
real vorhandenes und nicht virtuelles Geld aus vorerst
nicht realisierten PDS-Konzepten‘ ausgegeben werden“
(Bisky, nach: Neues Deutschland). Bedauernd, aber
entschlossen teilt er mit, daß die PDS die Wünsche ihrer
Anhänger ausschließlich an der gebieterischen Macht des
Geldes mißt und blamiert, genauer eigentlich: an
den staatlichen Zwecken, für das es ausgegeben wird. Man
mag Herrn Bisky zwar nicht fragen, ob er weiß, wieviele
AKWs und Panzer schon mit virtuellem Geld bezahlt worden
sind; sein neues Programm
(die Revitalisierung
des Kapitalismus: Eine Herausforderung für sozialistische
Politik
) sagt es aber auch so klar genug: Die
Grundrechenarten
(SZ) des Regierens im
Kapitalismus, die alle Welt den Sozialisten abspricht,
haben sie gelernt
– und die gelten, als
alternativlose Maxime ihrer Politik. Die
sozialpolitischen PDS-Konzepte sind zwar schön, aber
unbezahlbar; darum kann die PDS für sie nichts mehr tun;
sie gehen „vorerst“ nicht, also nie. Als
Mit-Regierungspartei erkennt sie an, daß auch sie sich
für das Wachstum des Kapitals einsetzen muß und
ihre Konzepte nur „real“ werden können bei sozialer
Enthaltsamkeit. Daß es dann auch nicht mehr dieselben
Konzepte sind, scheint die PDS eher zu freuen als zu
befremden: Ob die Regierungsverantwortung ein
heilsamer Lernprozeß
(SZ)
sei, bejaht ihr Gysi jedenfalls.
„Auf jeden Fall. Plötzlich rechnen unsere Leute mehr. Wir können im Bundestag keinen sozial- oder wirtschaftspolitischen Vorschlag mehr machen, ohne daß einer fragt: Was sagt eigentlich Ihr Regierungsvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern dazu? Außerdem haben wir es mit einer anderen Regierung zu tun: Wenn die einen Sozialbeschluß macht, müssen wir darüber nachdenken, wie wir uns dazu verhalten. Wie erklären wir unseren Wählern, daß wir für eine so geringe Erhöhung des Kindergeldes stimmen?“
Eine sachkundige Klarstellung: Abweichende Vorstellungen vom Regieren mögen für eine Oppositionspartei noch angehen, gar nützlich sein; an der Macht angekommen, sind sie purer Luxus, der sich rasch abgeschminkt gehört. Also wird den „sozial Benachteiligten“ erklärt, daß die PDS zwar weiterhin unter Anspielung auf ihre materielle Lage gewählt werden will, auf deren Linderung, geschweige denn Beseitigung aber nicht verpflichtet werden kann. Das heißt, Azubis, Arbeitslosen, 630-Mark-Putzen und anderen mehrheitsfähigen Randgruppen klarzumachen, daß ihre Interessen zurückzutreten haben, weil das für den Bestand der Partei unerläßlich ist.
Das ist es, was von links bleibt: Eine endlich
regierungsfähige
Alternative müht sich um die
Erklärung, warum das stinknormale Regieren bei
ihr in den besten Händen ist. In der
Zwickmühle
, die die feixende Presse „nach 100
Tagen Schweriner Modell“ (SZ) registriert, stecken andere
Parteien nämlich nicht: Die SED-Nachfolger müssen
ihrer Klientel wehtun
. Daß die Herrschaft ihrem Volk
einiges zumutet, ist doch selbstverständlich; in
Erklärungsnot geraten überhaupt nur Vereine, die einmal
das politisch aberwitzige Versprechen abgegeben haben,
die Leute hätten etwas davon, wenn sie (links)
wählen. Inzwischen ist die PDS aber reif genug, die
„Zwickmühle“ materieller Verheißungen und glaubwürdiger
Regierungsarbeit elegant zu lösen. Die Frage
‚Wer braucht die PDS?‘ beantwortet sie in dieser
Reihenfolge: „Der soziale Zusammenhalt,
der Markt, die Demokratie, die
Kultur, der Staat und Europa“
(Bisky, Schlußwort), kurz: die ganze zauberhafte Nation
samt ihrer Klassengesellschaft und ihrem supranationalen
Imperialismus.
Drittens und hauptsächlich: Vom Osten her!
Ärgerlich an dieser Nation ist darum nur eines: So
richtig wiedervereinigt
sei sie noch nicht. Die
materielle Kluft zwischen Ost und West
müsse
verringert, die Verwahrlosung der frisch produzierten
Erwerbslosen und die Verödung ganzer Gegenden verhindert,
mehr Jugendclubs und High-Tech-Fabriken mit
Arbeitsplätzen finanziert werden – Forderungen, an deren
Nicht-Erfüllung die PDS immer dasselbe anklagt: So wird
das nichts mit dem sozialen Zusammenhalt
.
Ungerecht und für den heiligen inneren Frieden gefährlich
ist es, daß die Nation es ihr, der Sachwalterin
ostdeutscher Interessen
, die auf Integration
des Ossis pocht, immer so schwer macht, ihrer Klientel
das geile
Gefühl zu vermitteln, in diesem
erstklassigen Land nicht länger als Deutsche zweiter
Klasse
behandelt zu werden. Darauf hat sie den
Sozialismus nämlich zusammengekürzt: Auf das demütige
Begehr nach Gleichstellung – in Tariflöhnen und „gering
erhöhtem“ Kindergeld; auf das Ideal einer
Volksgemeinschaft ohne Erniedrigung der neuen Bürger –
die als ein Volk auf den Ausländer herabblicken
kann; auf die Hofierung beleidigter Patrioten –
deren sämtliche Täuschungen über das Glück, ein Deutscher
zu sein, sie bestätigt, wenn sie ihrer Enttäuschung
schmeichelt und diese „vom Osten her“ vertritt. Kein
Wunder also, daß die Hauptkampflinie der PDS weniger
materiellen Forderungen gilt – für die (s.o.) eh keine
Staatsknete lohnt, und wenn, dann stets für geknechtete
neue Länder wie Sachsen und Anhalt erhoben
werden –, als der Ehre des Ossis gewidmet ist,
und da in erster Linie ihrer eigenen moralischen
Rehabilitation.
Mit diesem Bedürfnis macht die PDS Schlagzeilen der
besonderen Art: Sie betreffen ausschließlich ihre
Stellung als SED-Nachfolgepartei
zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung
. Daraus,
das rechtliche und moralische Erbe der SED angetreten zu
haben, macht sie keinen Hehl, besteht aber auf ihrer
grundlegenden Läuterung: Nicht
antimarktwirtschaftlich, nicht
antidemokratisch, nicht antimilitärisch
– konstruktive Bedenken gegen „Auswüchse“ des
Kapitalismus und „Fehltritte“ der Bundeswehr belegen das
prinzipielle Pro in der Sache –; umso mehr
erbittert die PDS, daß der westdeutsche Gesinnungs-TÜV
ihr die Wandlung weder abnimmt noch honoriert. Dem
begegnet sie auf zweierlei Weise:
Sie entschuldigt sich, gefragt und ungefragt, in
Briefen an ehemalige Bundespräsidenten und öffentlichen
Hemdzerreißaktionen; bricht pausenlos mit einer
Vergangenheit, an der ein Teil ihrer Mitglieder
bestenfalls in der Schulbank teilhatte, ohne die Gnade
der späten Geburt zu genießen; säubert ihre
Reihen von IMs, Ladendiebinnen und Verteidigern des
Mauerbaus, was ungefähr dasselbe ist; und fragt dabei
immerzu, ob und wann es endlich genug ist. Denn
aufs Loswerden des Kommunismusverdachts ist dieser Teil
ihrer politischen Glaubwürdigkeitsarbeit schon berechnet,
auch wenn die Entschuldigung beim einzig senkrechten
System dieser Welt und dessen politmoralischen Zensoren
keineswegs nur berechnend ist. Eine Gegenleistung in Form
einer Absolution der Sünden, wenigstens eines
Schlußstrichs
, sollte bitteschön sein; und da jene
nicht kommt, drängt sich der PDS der Verdacht auf, ein
Opfer vorsätzlicher Willkür zu sein. Ihr
demonstratives Contra auf die staatliche Überwachung,
Kontrolle und Belästigung von Parteimitgliedern und
Ex-DDR-Bürgern dient diesem Beweis:
Sie kritisiert die Regelüberprüfung aller Kandidaten für
den Staatsdienst und ostdeutschen Abgeordneten als
überflüssige und unnötig mißtrauische
Zwangsgauckung
; wirbt um Verständnis für
gebrochene Biographien
, jugendliche
Verfehlungen
und andere Verstrickungen
;
verteidigt ihre rückwärtige Haltung zur DDR mit dem nicht
übertrieben parteilichen Lob, daß in ihr nicht alles
schlecht
war; provoziert mit dem geplanten
Beratervertrag für den verurteilten Spion Rupp; beantragt
als Akt der Versöhnung
eine Amnestie für
verurteilte DDR-Hoheitsträger
; plädiert alles in
allem für ein Ende des Grundsatzvorbehalts, das nach
zehnjähriger Schnüffel- und Abrechnungspraxis ohne
Schaden möglich, wegen eigener Läuterung und
wegen des Miteinanders der Menschen in der beginnenden
Berliner Republik
(Bisky) aber auch
vernünftig sei.
Der Versuch der PDS, den Kampf gegen ihre Diskriminierung
auf dem Feld der Moral (teilweise auch des
Rechts) zu gewinnen, mißlingt. Ihr Bemühen, die
Feindschaft gegen sie einerseits durch Erfüllung
demokratiesittlicher Normen, andererseits durch den
Nachweis deren Sinnlosigkeit zu entkräften, schlägt fehl.
Die Bitte um Gleichbehandlung und Gnade stößt
allenthalben auf Granit. Dem Antrag auf gnadenlose
Normalität
wird nicht stattgegeben, ein absehbares
Ende der verfassungsschutzmäßigen Behandlung von Partei
und ihrer Klientel wird nicht in Aussicht gestellt;
allerdings nicht aufgrund von ‚Willkür‘, auch nicht, weil
die Große Anti-PDS-Koalition einfach ‚unvernünftig‘ wäre.
Der Entstasifizierungs- und Verfolgungswahn hat System
und seinen Grund.
Die Einheitsfront gegen die PDS: Verfassungsschutzpatriotismus total
Es verhält sich nämlich gar nicht so, daß der PDS schlicht etwas ‚vorenthalten‘ würde. Die Liste der Vergehen der PDS – im normalen Bonner Umgangston wahlweise „Partei Der Schurken“ oder „Partei Der Spaltung“ – ist deshalb so lang und monströs, weil die Partei unter einen besonderen und viel fundamentaleren Vorbehalt gestellt ist, als daß man ihn durch den Beweis von Normalität und Wohlverhalten ‚ausräumen‘ könnte. Alles, was die PDS sagt und tut, ist verkehrt und subversiv, weil es die PDS ist.
Die PDS hat Erfolg. Das stört, und zwar grundsätzlich
Die PDS nutzt ihre Stimmengewinne, um sich als
Sprachrohr des Ostens
zu engagieren und staatliche
Subventionen vorrangig für die neuen Länder zu
beantragen. Der Grund für ihre Ausgrenzung ist
der Einsatz für ‚zu kurz gekommene‘ Menschen und
Bundesländer aber nicht.
Einerseits ist das werbewirksame Deuten auf das Elend von
Regionen und Bewohnern, dessen Betreuung originäre
Aufgabe der Politik
sei, kein Privileg der PDS;
diese Manier, die Entscheidungshoheit des Staates über
die Berechtigung von Ansprüchen zu unterstreichen,
beherrschen die großen Volksparteien naturgemäß ebenso.
Die Forderung nach Extra-Anstrengungen
und
verstärkten Transferleistungen für den Aufbau Ost
,
den noch jeder Bundeskanzler zur Chefsache
erklärte, ist auch nicht gerade verfassungswidrig.
Andererseits bringt es den nie in Verruf; die
PDS schon. Ehrenwerte Zitate von der Dringlichkeit
blühender Kapitallandschaften, die genausogut von Kohl
oder Schröder stammen könnten, werden nach Enttarnung
ihrer Herkunft für das Gegenteil genommen: Aus dem Munde
der PDS steht jede Betonung von Ost-
für den
unziemlichen Versuch, ‚Extrawürste zu verlangen‘ und die
Nation ‚ein zweites Mal zu spalten‘.
Wir müssen verhindern, daß sich eine östliche Partei
als Heimatverein etablieren kann
(Rau). Ein
Heimatverein, vor dem unser künftiger Präsident in diesem
Falle warnt, ist ja an und für sich nichts Schlimmes –
die äußeren Lebensumstände als ‚Heimat‘ zu verhimmeln,
ist vielmehr eine hohe Staatsbürgertugend: Bei der PDS
rückt die Betonung regionaler Eigenart in die Nähe des
geistigen Separatismus. Nach unserer Freiheit, unseren
Bananen und unserem Mallorca lechzend: So haben wir die
Zonis begrüßt, als sie rüber kamen und bei
uns mitmachen wollten – dann ist das bißchen
Rotkäppchensekt und Stolz auf olympische Schwimmerfolge
glatt geschenkt; die PDS aber, so der Befund, pflegt und
mobilisiert den Zoni-Patriotismus gegen seine
neue Zentralgewalt in Bonn, demnächst Berlin, auf die die
neuen Bürger jetzt zu hören haben. Die sollen erst mal
zeigen, daß sie so sind wie die anderen und
nichts eigenes. Damit steht das Urteil fest: Eine Partei,
die die ostdeutsche Besonderheit betont, ist und bleibt
eine von drüben, also keine von uns.
Daß die PDS Erfolg hat, verläßlich und eher
zunehmend Stimmen einfährt, nicht mal mehr vom Regieren
abzuhalten war: Daran stört das angestammte
„Parteienspektrum“ deshalb erheblich mehr als nur die
unliebsame Konkurrenz, die man mit den üblichen
parlamentarischen Intrigen bekämpft – solange man sich
davon etwas verspricht – oder benützt, sobald das mehr
bringt. Ganz jenseits der Frage, welchen
alternativen Gebrauch der Macht PDS-Abgeordnete
eigentlich im Sinn hätten – in den Zeitungen ist eher zu
lesen, daß die Fraktion Schwerin alle schmerzhaften
Einschnitte
und den Transrapid gewissenhaft mitträgt
und die Fraktion Magdeburg jedes Regierungsvorhaben der
SPD duldet
–, wird ihnen einfach jede kritische
Wortmeldung als böser Wille zu einem anderen
Staat, als verdeckte Staatsfeindschaft, zur Last gelegt:
„Nun muß der Finanzminister erkennen, daß die PDS den Grundrechenarten offenbar nicht zugänglich ist. Zwar sieht sie die Notwendigkeit der Einsparungen weiter ein, aber die unvermeidlichen Kürzungen im sozialen Bereich vertreten – das will sie nicht. Weil dies in ihren Augen nicht ihr Staat ist, schert es sie auch wenig, wenn er durch Überforderung an Grenzen stößt“ (SZ).
„Nicht ihr Staat“ – und damit auch noch
überlebensfähig! Das ist das Verbrechen der PDS und darin
faßt sich die Kriegserklärung gegen sie zusammen. Die
ganz Rechten unter ihren Feinden animiert das zur
Neuauflage von Freiheit statt Sozialismus
. Die CSU
nimmt die erste Regierungsbeteiligung Roter Socken
zum Anlaß, mit einem Stopp der Zahlungen für den
Osten
zu drohen. Wo die PDS mitregiert, sind die
Standortbedingungen nicht attraktiv
(Stoiber).
Erneut: Kein investitionshemmendes Gesetz der PDS weit
und breit, kein Kapitalist, der sich je über
PDS-verhetzte, streikende Ossi-Arbeiter beklagt hätte –
vor der Diagnose rettet sie das ‚trotzdem‘ nicht:
Unverbesserliche Nachfolgepartei, die eine
untergegangene, unter Freudentränen übergelaufene
Nationalmannschaft heute wie ein Volk im Volke vertritt.
Mehr noch: Die unverwüstlichen 20% Wählerstimmen gebieten
den Schluß von der Partei auf ihren Sumpf.
Wahrscheinlich ist der ganze Osten eine von
sozialistischem Gedankengut „durchrasste Gesellschaft“,
wie der bayerische Ministerpräsident das gerne ausdrückt.
So stellen Politiker aus dem Westen das ostdeutsche
Volk unter einen generellen Illoyalitätsverdacht:
Will mitten in der neuen Republik immer noch Zoni
bleiben!
Die PDS vertritt den Zoni. Das ist verdächtig und hat Konsequenzen
„Wiedervereinigung“, das hieß: Die Herrschaft der BRD gliedert sich das ostdeutsche Volk ein, unterwirft es ihren ökonomischen und politischen Sachgesetzen. „Wiedervereinigung“, das hieß damit auch: Das Volk der DDR erhielt das Angebot zum Überlaufen, indem man es von seinen Herren schied; die Begrüßung der Zonis beinhaltete die Abrechnung mit dem Staat. Die Scheidung in die wenigen Lumpen aus Wandlitz und ihre Schergen auf der einen Seite und die vielen, im Prinzip guten, lediglich verführten Opfer auf der anderen war die Methode der Integration von 17 Millionen Neubürgern auf einen Schlag. Der Wille zur Integration, sprich: reibungslosen Anpassung an die neuen Lebensverhältnisse, wurde den Zonis einerseits großzügig unterstellt, andererseits aber mit einen Test verbunden: Ob sie in ihrem alten Leben wirklich nur Opfer waren, das wollte die neue Obrigkeit schon noch wissen. Wie üblich bei der Eingliederung von Ausländern wurde Integration auch im besonderen Falle unserer Brüder und Schwestern aus Ostzonesien an Bedingungen geknüpft: Rückwärts an den Nachweis, der SED-Herrschaft keine Dienste erwiesen zu haben, vorwärts an die Aufforderung, der alten Staatsbürgeridentität bruchlos abzuschwören. In beiderlei Hinsicht ist die Prüfung nicht zufriedenstellend ausgefallen:
Das Aktenstudium der Gauck-Behörde hat weniger zur Ent- als zur Belastung vieler DDR-Bürger geführt – was die staatliche Neugier auf ihre Vita nicht bremste, sondern forcierte. So kamen immer neue inoffizielle Mitarbeiter der DDR-Staatsmacht ans Licht; und die anhaltende Sympathie der Wähler für die SED-Nachfolgerin generalisierte das Urteil: Haben unter ihrer alten Herrschaft gar nicht gelitten, hängen immer noch an dem Laden! So setzt sich die Vermutung durch, daß ihr 40jähriges Leben im Realen Sozialismus doch Wirkung gezeigt und das Volk der DDR gegen seine eigene deutsche Natur und Mentalität kollektiv der falschen Nation gedient hat. Den Verdacht, den der westdeutsche Gesinnungstest in den hinzugewonnenen Personalbestand seiner Herrschaft hineingerührt hat, entdeckt er – absolut jenseits der Frage seiner tatsächlichen ökonomischen Benutzbarkeit oder erwiesener Achtung vor dem Gesetz – an ihm wieder. Das schärft den Blick, nach hinten wie nach vorne:
„Die Grenze zwischen Tätern und Opfern darf nicht verwischt werden.“ (Däubler-Gmelin)
Rückwärtig zieht jede mittlere Karriere von DDR-Bürgern –
Juristen, Pädagogen, Geisteswissenschaftler: mit
Parteilichkeit kennen die unsrigen sich aus! – den
Verdacht der Mittäterschaft auf sich. Die Grenze
zwischen möglichen Tätern und bloßen Opfern steht nicht
einfach fest, sondern wird von dieser Republik, hier in
Gestalt ihrer Justizministerin, gezogen: Um
zweifelsfrei kein Täter gewesen zu sein, sollte
man sich vom täglichen DDR-Leben lieber ferngehalten
haben; die Gefahr von Stasi-Kontakten war in Betrieben,
Schulen, Tanzstunden und Sportvereinen doch sehr groß.
Natürlich ist diese Täter-Definition, die sich von
tun ableitet, absurd. Aber gerecht: Denn es geht
um die Frage von Schuld, um das Ausstellen oder
Verweigern von Persilscheinen. In ihrer ganzen
agententheoretischen Brillianz drückt diese Definition
die Vorstellung aus, die westdeutsche Volksvertreter von
jenem Unrechtsregime
haben, das ihr Grundgesetz 40
Jahre lang nicht als Staat anerkannte: Wo drüben
alles gesellschaftliche Leben von Unterdrückung
geprägt war, erscheint jede aktive Begegnung mit dessen
Instituten als potentielle Komplizenschaft.
Aktuell folgt daraus der dazu passende Umgang. Wenn
unsere Neubürger nach zehn segensreichen Jahren
Lohnabhängigkeit, Meinungsfreiheit und Aldi an ihrem
alten System immer noch „nicht alles falsch“ finden, dann
ticken sie auch heute nicht richtig. Das in zu vielen
Wahlkreuzen an der verkehrten Stelle identifizierte
Beharren auf einer „eigenen Biographie“
trifft auf den praktizierten Rassismus der Loyalität:
Zonis erfreuen sich, weil sie Zonis waren und in ihrem
Innersten bleiben wollen, einer kleinen Sonderbehandlung.
Wer bei, also für uns etwas werden will –
zum Beispiel Parteisprecherin der SPD oder Laienrichterin
am Verfassungsgericht Brandenburg –, dessen Biographie
wird schon gewürdigt, aber anders, als etwa Dörte Caspary
oder Daniela Dahn das meinen: Die Gauck-Behörde wird
noch eine unbestimmte Anzahl von Jahren arbeiten
müssen.
(Thierse) In Fragen linientreuer Gesinnung
ihrer kleinen Mitherrscher und schwankenden
Zwischenschichten überläßt die Nation nichts dem Zufall.
Zonis ist der Staatsbürgerspruch, daß früher
alles irgendwie besser war, nicht erlaubt: In
ihrem Früher gab es kein richtiges Leben im
falschen. Wenn Zonis heute rumnörgeln – zum
Beispiel über fehlende blühende Landschaften –, dann ist
etwas faul: an ihnen. Das erhärtet den Verdacht, daß die
DDR in Gestalt ihrer zweibeinigen Erbmasse ‚weiterlebt‘:
Die unerträgliche Ostalgie
vieler ihrer neuen
Untertanen gilt der amtierenden Herrschaft als Indiz
dafür, zwar 17 Millionen Pässe ausgegeben, aber
noch nicht die dazugehörigen 17 Millionen
Patrioten gewonnen zu haben.
Es ist schon ein einmaliger, aber konsequenter
Treppenwitz der Geschichte. Dem einzigen Volk, für das je
ein Doppel-Paß bereitlag – ein westdeutscher
Personalausweis für jeden „DDR“-Bürger: kollektiv, ohne
Aufnahmeverfahren und Auswahlkriterien –, wird nach
seiner Einbürgerung, ohne daß die Wahl zwischen zwei
Staatsangehörigkeiten überhaupt noch existierte, wegen
seiner Vergangenheit als Volk der DDR
die Frage gestellt, ob man in einem Leben zwei Herren
dienen kann. Das Fragezeichen hinter der
Berechnungslosigkeit des Gehorsams, die jeder Staat von
seinem Menschenmaterial verlangt, verdienen sich die
Ex-Zonis nicht erst durch irgendein Fehlverhalten,
sondern dadurch, daß ein Loyalitäts-Wechsel in
der Tat einen gewissen Widerspruch enthält: Der
fundamentalistische Verdacht der – wenn auch nur ideellen
– Treue zu den alten Machthabern (oder deren „Erben“) ist
ihm immanent. Er begründet den Zweifel, ob den einstigen
Brüdern und Schwestern
der absolute
Unterwerfungswille unter ihre neue Herrschaft ebenso
‚ein-geboren‘ ist, wie deren Inhaber das von 60
Millionen ‚echten‘ Eingeborenen wie selbstverständlich
annehmen.
*
Die Prognose, es werde noch eine ganze Generation
dauern
, bis die Stasi-Archive geschlossen werden
könnten und das Gespenst PDS
verschwunden sei,
wird darum wohl stimmen. Die Säcke von
Papierschnipseln
, die die Gauck-Behörde noch
zusammenzusetzen hat; die Überführung der vielen
kleinen und größeren Mitläufer
beim falschen
System; die Erledigung einer Partei, die links von der
SPD dauerhaft Fuß fassen will
: Dies gut Ding will
Weile haben. An der Erfüllung ihrer eigenen Vorhersage
wird die Nation es jedenfalls nicht mangeln lassen.