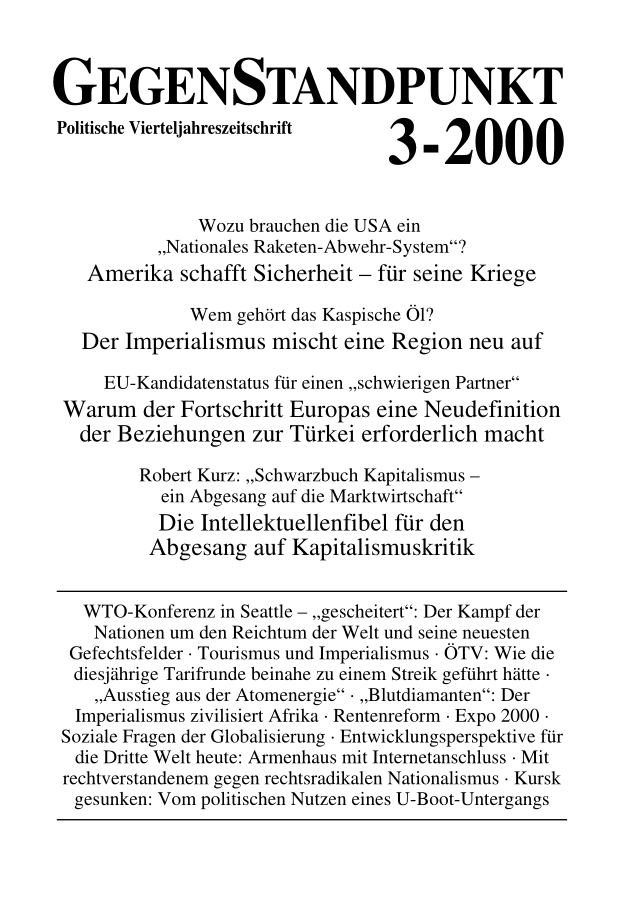Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Aus unserer Reihe: Lohnsenkung – jede Woche eine gute Tat
Böser Schnitzer der ÖTV: Wie die diesjährige Tarifrunde beinahe zu einem Streik geführt hätte
Die ÖTV droht mit einem Streik im Schongang um lächerliche 0,2 Prozent Lohnerhöhung und bläst ihn ab mit einem Kompromissvorschlag, der „unter dem Strich ein schlechteres Ergebnis als im Schlichterspruch“ ergibt – selbst das ist der öffentlichen Hetze zu viel.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Aus unserer Reihe: Lohnsenkung –
jede Woche eine gute Tat
Böser Schnitzer der ÖTV: Wie die diesjährige Tarifrunde
beinahe zu einem Streik geführt hätte
Nach den üblichen schwierigen Verhandlungen im Öffentlichen Dienst sind wieder einmal die Schlichter gefragt. Die zaubern, wie so oft, eine Empfehlung hervor, die den beiden Tarifparteien alleine nie gekommen wäre, und die deshalb von beiden als fairer Kompromiss angenommen wird: Löhne und Gehälter sollen statt der ursprünglich geforderten 5 Prozent rückwirkend zum 1. April zunächst um 1,8 Prozent steigen. Im Jahr darauf sollen die Einkommen um weitere 2,2 Prozent erhöht werden. Die Einkommen im Osten werden auf 90 Prozent des Westniveaus angehoben. Die Leistungen der Zusatzversorgung werden eingefroren.
Damit können die Beschäftigten zufrieden sein, so
Innenminister Schily als oberster Dienstherr, denn der
Abschluss liege nur marginal unter dem Tarifabschluss
der Chemiebranche
(SZ,
2.6.), dafür aber marginal „über dem der
Baubranche“, also recht ausgewogen in der Mitte zwischen
zwei ziemlich marginalen Abschlüssen. Auch ÖTV-Chef Mai
findet, dass mehr nicht drin ist, und empfiehlt das
Ergebnis seiner Mannschaft. Soviel Vernunft trägt ihm das
Lob von Schily ein, schließlich gibt es nur in der
privaten Wirtschaft Gewinne zu verteilen
, über die
ein Minister nicht verfügt und die er somit auch nicht
sozialisieren kann, wie das in der Privatwirtschaft
üblich ist. Im Gegensatz zu den Kapitalisten muss der
Staat riesige Schulden abtragen
(ebd.), woraus ersichtlich wird, wer hier
eigentlich mehr Geld braucht.
Die Tarifrunde hätte hier zu Ende sein können. Doch bei der anschließenden Abstimmung der großen Tarifkommission lehnen die Bezirkschefs den Schlichterspruch als „völlig inakzeptabel“ ab. Sie haben einen schwerwiegenden Einwand, nämlich allen Ernstes den und sonst keinen, dass keine Zwei vor dem Komma steht. Die 1,8 Prozent des Schlichterspruchs stufen sie als eine „verteilungspolitisch mittlere Katastrophe“ ein und stellen klar, dass der angebotene „Inflationsausgleich“ für die ÖTV eine Beleidigung ihrer gewerkschaftlichen Ehre ist – die liegt nämlich zwei Zehntel Prozentpunkte höher. Die Gewerkschaftsleitung beschließt folglich eine Urabstimmung und mobilisiert die Basis, für einen Streik zu stimmen. 76 Prozent der abstimmenden Mitglieder finden es in Ordnung, dass ihre Gewerkschaft für einen Arbeitskampf eintritt, in dem sie nicht nur keine gescheite, sondern gleich gar keine Forderung stellt; gestreikt werden soll vielmehr für ein Prinzip, das die Gewerkschaft mit der Formel „eine Zwei vor dem Komma“ beschreibt.
Das Echo der Öffentlichkeit lässt nicht auf sich warten:
Das soll sich lohnen? Statt 1,8 jetzt 2,0
Prozent? Die „lächerliche Differenz“ missversteht
allerdings niemand als Plädoyer für einen wirklich
lohnenden Streik; irgendwelche Zweifel daran, wie es
gemeint ist, lässt man ja auch gar nicht erst aufkommen:
Die Gewerkschaft ist durchgedreht! Denn so „lächerlich“
die Differenz für einen Streik, der sich lohnen würde,
auch sein mag, für einen Streik, der sich nicht gehört,
ist sie allemal viel zu hoch und ein Beleg dafür, dass
die Gewerkschaft jeden Bezug zur ‚Realität‘ verloren hat:
„Traumtänzerei“ (SZ, 2.6.)
und Gewerkschaften drohen Amok zu laufen
(SZ, 8.6.) lautet die
Generallinie der Kritik:
„Das ist zwar nicht der GAU, aber das ist eine mehr als peinliche Entgleisung der Tarifrunde im Jahr 2000. Einer Tarifrunde, in der sogar die warnstreikversessene IG Metall in aller Geräuschlosigkeit und Vernunft einen Abschluss hingelegt hat, der selbst ihre ärgsten Kritiker sprachlos machte. Und nun plustern sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf und meinen, es ließe sich mit einem Streik ein besseres Ergebnis herausschlagen, als es die beiden Schlichter in nicht geringer Anstrengung mit beiden Parteien herausziseliert haben.“ (SZ, 31.5.)
Dabei haben andere Gewerkschaften längst vorgemacht, wie es richtig geht. Die – zwar nicht streikversessene, aber immerhin – „warnstreikversessene“ IG Metall hat eingesehen, dass mit Streiks nichts zu erreichen ist, und konsequent gehandelt. Sie weiß nämlich, wie man selbst die „ärgsten“ Gewerkschaftsfeinde zu Lob und Anerkennung zwingt: einfach geräuschlos vernünftig sein und das verlangen, was die Gegenseite freiwillig herschenkt. Völlig klar deshalb, dass die ÖTV sich mit ihren „Entgleisungen“ noch die Feindschaft der letzten Gewerkschaftsfreunde zuzieht:
„Notabene: Nichts gegen Arbeitskämpfe als solche. Zuweilen sind sie historisch notwendig, treiben gesellschaftliche Entwicklungen voran, bieten dem Millionenheer von abhängig Beschäftigten die einzige Chance, sich unter Hinnahme von materiellen Verlusten und in gemeinschaftlicher Anstrengung zu erkämpfen, was ihnen von Kapital oder Regierung unbilligerweise vorenthalten wird. Von derartigen Dimensionen ist aber die gegenwärtige Auseinandersetzung weit entfernt.“ (FR, 10.6.).
Nichts gegen Arbeitskämpfe „als solche“ – aber einen Arbeitskampf zu führen, ist ja wohl das Letzte! Erst recht in einer „historischen“ Situation, in der weit und breit nichts von jener „Dimension“ zu erkennen ist, in der Lohnforderungen „gesellschaftliche Entwicklungen“ vorantreiben. Denn im Jahr 2000 wird den Proleten von Kapital und Staat weiß Gott nichts mehr vorenthalten – eher ist es schon umgekehrt:
„Die Arbeitgeber sind ÖTV und DAG weit entgegengekommen – angesichts ihrer leeren Kassen vielleicht schon zu weit.“ (SZ, 2.6.)
Das sollen sich vor allem die Ostler hinter die Ohren schreiben, die mit ihrem realsozialistischen Gerechtigkeitsfimmel ‚gleicher Lohn für gleiche Leistung‘ ihre Lage notorisch verkennen: „Natürlich leistet ein Müllmann in Cottbus nicht weniger als sein Kollege in Castrop-Rauxel. Nur hilft das wenig.“ Nämlich am wenigsten der Staatskasse, der sie auf der Tasche liegen. Sie scheinen wohl vergessen zu haben, dass sie Kostgänger der Nation sind, deren Löhne subventioniert werden müssen:
„Trotz Milliardentransfer aus den alten Ländern ist die Finanzkraft der ostdeutschen Länder und Kommunen so schwach, dass eigentlich schon die heutigen Saläre zu hoch sind.“ (ebd.)
Ein bisschen ungerecht sind die Vorwürfe der Öffentlichkeit an die ÖTV natürlich schon. Denn auch die Gewerkschaft hat gegen einen Arbeitskampf schwerwiegende Bedenken. Am Aberwitz eines Streiks ohne Forderung bemerkt sie nicht den Aberwitz, sondern das Dilemma, in das sie sich hineinmanövriert hat: So ein Streik ums Prinzip ist zwar leicht zu beschließen, ihn aber wirklich zu führen, beißt sich ein wenig mit dem Prinzip. Zum einen weiß sie, wie unpopulär ein Streik in der Bevölkerung ist. Und für nichts und wieder nichts die Öffentlichkeit gegen sich aufzubringen, das ist das Letzte, was sie will. Deshalb plant sie einen „Streik im Schongang“ und entwirft eine „Minimax-Strategie“ – „minimaler Einsatz mit maximaler Wirkung“. Durch ganz viele „kreative Aktionen“, wie z.B. dem Boykott der „Kassenhäuschen in Museen und Freibädern“, der nur das Kassieren, nicht aber das Freizeitvergnügen verhindert, soll der Bevölkerung gezeigt werden, wie gut es die Gewerkschaft meint.
Zum anderen muss sie an ihre Mitglieder denken. Ihre
Bedenken sind da nicht von der Art, dass sie irgendwelche
Zweifel hätte, ob sie ihre Mitglieder überhaupt für eine
derart blödsinnige und schädliche Prinzipienreiterei
streiken lassen soll. Das ist eine andere Welt. Die
Gewerkschaft wälzt vielmehr die Sorge, ob sie mit ihrem
Streikbeschluss nicht falsche Erwartungen weckt und die
Mitglieder „radikalisiert“, so dass die am Ende womöglich
mehr fordern, als was nach den Maßgaben
gewerkschaftlicher Vernunft, also ‚realistischerweise‘
drin ist. Selbstverständlich geht die Gewerkschaft davon
aus, dass die Kollegen „rechnen können“. Aber dass sie
das Rechnen anfangen könnten, betrachtet sie als
das Risiko, das sie mit dem Anzetteln dieses
Streiks eingeht: Wenn nämlich die Kollegen den Aufwand
eines Arbeitskampfes ins Verhältnis zu dem von der ÖTV
anvisierten Ergebnis setzen, dann – so denkt die
Gewerkschaft – wird ihr das Abblasen des Streiks und die
Rückkehr zu Verhandlungen nur erschwert. Deswegen wäre es
am vernünftigsten, wenn man wieder ins „Bündnis für
Arbeit“ zurückkehren würde, schließlich geht es netto
um den Preis für eine halbe Kinokarte im Monat
(FR, 10.6.). Die schwierige
Frage lautet also, „wie sich der so harsch abgelehnte
Schlichterspruch mit ein paar kosmetischen Eingriffen
vielleicht doch noch in eine endgültige Tariflösung
verwandeln“ lässt (SZ,
10.6.), denn dass die Gegenseite keine halbe
Kinokarte zahlen kann, ist klar.
Ebenso klar ist, dass der ÖTV niemand den Vorwurf des Zynismus macht, wenn sie ganz ehrlich ihr „kosmetisches“ Prinzip ausplaudert, sondern jeder darin den Willen zur „Vernunft“ erkennt. Und der wird dann tätig. Nach einer nochmaligen Nachtsitzung wird ein neuer Kompromissvorschlag präsentiert: für die Monate April bis Juli jeweils 100 Mark pauschal, ab August für 13 Monate ein Anstieg um 2,0 Prozent, danach eine weitere Anhebung um 2,4 Prozent für eine Laufzeit von 14 Monaten. Das sollen die anderen Gewerkschaften erst mal nachmachen! Die Ostler werden auch nicht vergessen. Sie dürfen noch ein bisschen länger auf die Anhebung ihrer Bezüge warten, mit Zwischenstufen sollen sie bis 2002 auf 90 Prozent des „Westniveaus“ kommen. Die Verhandlungen über die Zusatzversorgung werden aus den Tarifverhandlungen ausgeklammert und auf Basis des heutigen Standes erst einmal bis 2002 „eingefroren“; wenn es bis dahin zu keiner Einigung kommt, gilt dies unbefristet weiter. Das Weihnachtsgeld steht sowieso schon auf dem Stand von 1993, und so soll es auch die nächsten zwei Jahre bleiben.
Wie nicht anders zu erwarten, sind alle mit dem Ergebnis
zufrieden. Die ÖTV, weil sie eine „Formel“ gefunden hat,
die optisch sehr viel schöner aussieht als die
andere
(Berlins ÖTV-Vorsitzende
Stumpenhausen, SZ, 15.6.), schließlich steht „die
Zwei“ vor dem Komma, und die wiegt allemal die Tatsache
auf, dass „unterm Strich ein schlechteres Ergebnis als im
Schlichterspruch“ herausgekommen ist, wie der Spiegel
sachkompetent nachrechnet. Der Minister hat bekommen, was
ein Dienstherr zu schätzen weiß, nämlich 31 Monate
„gewonnene Planungssicherheit“ (Schily, SZ, 15.6.). Die haben zuletzt
auch die Mitglieder für die eigene knappe Kasse.
Da mag dann auch die Öffentlichkeit mit Anerkennung nicht
sparen: „Dumm gelaufen“, vermeldet das deutsche
Nachrichtenmagazin und bekundet seine Zufriedenheit
darüber, dass sich die richtige Seite durchgesetzt hat.
Dass hierzulande Lohnsenkungen in solchen alternativlosen
„Ritualen“ durchgesetzt werden, ist den Schreibern dieses
Magazins so selbstverständlich, dass sie den Schaden für
die Beschäftigten ganz sachgemäß, also mit
triumphierender Häme als Blamage der Gewerkschaft
verbuchen. Und so kann es gar nicht ausbleiben, dass
andere Hüter des nationalen Wohls aus dem „Tarifzirkus“
die Empfehlung an die Basis ableiten, mit den „Ritualen“
gleich ihren ganzen gewerkschaftlichen Zusammenschluss
wegzuschmeißen: Sind zentrale Tarifverhandlungen für
immer selbstbewusstere Staatsdiener mit immer
unterschiedlicheren Interessen eigentlich noch
zeitgemäß?
(SZ, 14.6.) So
darf die angeschmierte Mannschaft als Kronzeuge für die
öffentliche Hetze fungieren, dass man das ganze
gewerkschaftliche Theater wirklich nicht mehr braucht.
„Zeitgemäß“ beruft man sich auf den Arbeitsmann, der mit
seinem Unmut über die Tarifrunde zeigt, dass er selbst am
Besten weiß, was gut für ihn ist: sich nämlich als
„selbstbewusster“ Diener seiner Herren den Sachzwängen zu
fügen, die ihm von Staat und Kapital so oder so
präsentiert werden.