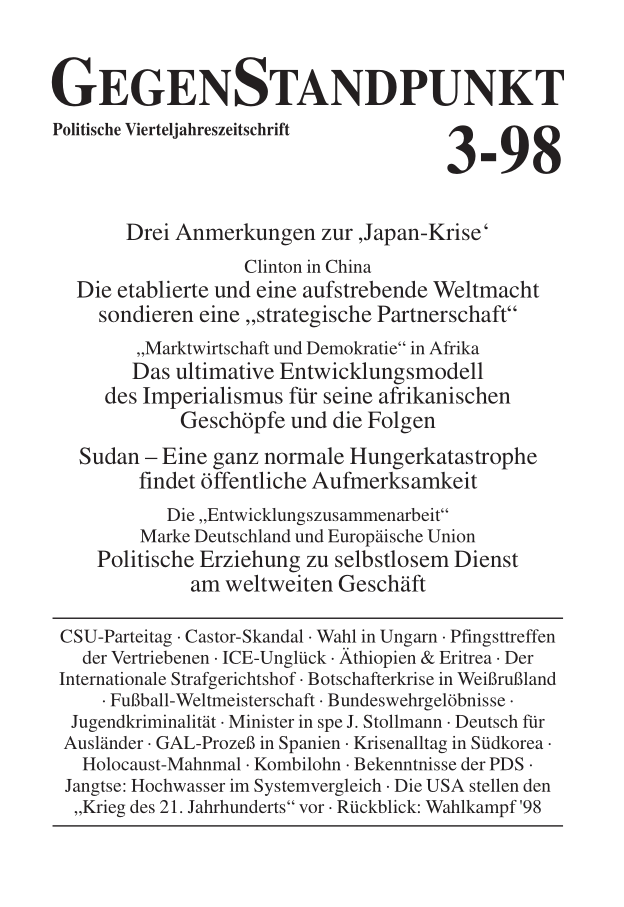Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Öffentliche Gelöbnisfeier in Berlin
Trittin beleidigt Bundeswehr – ein „perverses Ritual“
1. Letzter Vorbehalt des grünen Antimilitarismus: Keine „Traditionspflege“! Was der grüne Minister aus Niedersachsen linken Wählern zu bieten hat, die er nicht der PDS überlassen will. 2. Noch eine „Tradition“ – grüne „Schadensbegrenzung“: Wie alle – inklusive die eigene Grüne Partei – über Trittin herfallen, und die moderne demokratische Kriegsmoral Urstände feiert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Öffentliche Gelöbnisfeier in
Berlin
Trittin beleidigt Bundeswehr – ein
„perverses Ritual“
Öffentliche Rekrutenvereidigung am 10. Juni in Berlin.
Unter der Parole „Gelöbnix 98“ organisieren ein paar
linke Gruppierungen zusammen mit der PDS eine
Gegenveranstaltung, auf der als prominenter Redner auch
der Parteisprecher der Grünen, Jürgen Trittin, auftritt,
um gegen öffentliche Gelöbnisse zu protestieren.
Die beschimpft er als „perverses Ritual“ und macht den
zuständigen Minister Rühe für die rechtsradikalen
Umtriebe in der Truppe verantwortlich: Wer öffentliche
Gelöbnisse veranstaltet, muß sich über Rechtsradikale in
Armee und Gesellschaft nicht wundern.
Mehr noch,
Trittin sieht eine verhängnisvolle Parallele – nur die
Nazis hätten Gelöbnisse „öffentlich“ veranstaltet – und
bezieht daraus den Vorwurf, daß Rühe mit seiner
fragwürdigen Traditionspflege die demokratische deutsche
Armee selbst in die Tradition der Wehrmacht
stelle.
Die Reaktion der Öffentlichkeit und der politischen Gegner erfolgt prompt. Eine „Entgleisung“ und „Schande“ so etwas, eine „Beleidigung“ der Soldaten, die bei ihrer Pflichterfüllung ihr „Leben riskieren“. Die ganze Nation ist „hell empört“, und es besteht Konsens in dem Urteil, daß
„Trittins Äußerungen und die Debatten bei den Grünen deutlich (machen), daß die Partei nicht reif und nicht fähig ist, in einer Bundesregierung außen- und sicherheitspolitisch herausragende Verantwortung zu übernehmen“ (SZ).
Dabei rätseln diejenigen, die in Rot-Grün eine Chance zur
Ablösung des „Systems Kohl“ sehen, über die offenkundige
„Torheit“ eines Mannes, der doch schon „oft bewiesen
hat“, daß ihm die hohe Schule der politischen Vernunft
nicht fremd ist: Er denkt in den Kategorien der Macht
und des Machterhalts.
(ebd.) Und gerade weil er den Beweis
längst geliefert hat, daß er zu pragmatischem Handeln
fähig
ist, muß man sich fragen: Was nur treibt
Jürgen Trittin?
Das fragen sich auch die Grünen
„entsetzt“ und „empört“ angesichts des „Desasters“. Die
Partei nämlich sieht den Auftritt ihres Sprechers
ungefähr genauso wie ihre Gegner, weswegen sich
„Ratlosigkeit“ breit macht und „Wut“. – Was also „treibt“
den Mann?
Letzter Vorbehalt des grünen Antimilitarismus: Keine „Traditionspflege“!
1. Die Grünen haben ihr Verhältnis
zur Bundeswehr bereinigt. Die NATO ist kein Thema mehr,
Fischer will Außenminister werden; vor der deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik breitet er seine
außen- und sicherheitspolitischen „Visionen“ aus, die
Herren sind beeindruckt bis begeistert. Auch dem
Kampfeinsatz der Truppe will die Partei sich nicht länger
verweigern. Trittin selber, das räumt sogar die FAZ
anerkennend ein, hat der Bundestagsfraktion seiner
Partei den Weg geebnet, den Bundeswehreinsatz in Bosnien
als gelungen zu bezeichnen, mithin den deutschen Soldaten
hohes Lob zu spenden
(FAZ
22.06.98). Bei dem Lob sollte es nicht bleiben.
Mit Blick auf den „kleinen Parteitag“, der die Scharte
des „großen“ auswetzen sollte, bemühte sich der
gleiche Trittin monatelang, der Bundestagsfraktion der
Grünen die Zustimmung zur Verlängerung des
Bosnien-Einsatzes der Bundeswehr zu erleichtern
(ebd.). Wie man weiß, mit
Erfolg. Die Grünen sind bereit für „den Wechsel“ in Bonn,
und als Partei, die in die Regierungsverantwortung will,
können und wollen sie sich keinen Antimilitarismus mehr
leisten. Kritik an der Bundeswehr, Bedenken gegen
Peacekeeping mit oder ohne UN-Mandat – nichts wäre für
die Partei, die an die Macht will und sich damit zur
„weltpolitischen Verantwortung“ des neuen Deutschland
bekennt, disqualifizierender als eine Kritik an den
nationalen Interessen, die ein schlagkräftiges Militär
unbedingt erfordern. Das wäre ja glatt eine Absage an
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Daß der
gescholtene Trittin so etwas im Sinn hat, glauben nicht
einmal diejenigen, die ihn wegen seiner Berliner Rede
schelten:
„In einer oberpfälzischen Kaserne trat Trittin jüngst selbst vor Offizieren auf. Dort warb er um Vertrauen in die sicherheitspolitischen Vorstellungen der Grünen für das 21. Jahrhundert.“ (SZ 18.06.98)
2. Was Trittin „treibt“, ist niemandem ein Geheimnis. Nicht nur, daß Gegner und Öffentlichkeit, die sich in Sachen Wahlkampf bestens auskennen, sofort Bescheid wissen, er selbst spricht es offen aus:
„Erst war er beim Bundesverband der Deutschen Industrie in der Bonner Beethovenhalle, dann abends in der Harald-Schmidt-Show. ‚Ich muß mich doch auf die Erwartungshaltung des Publikums einstellen.‘ Auch vor den Berliner Gelöbnis-Gegnern habe er dies natürlich getan … Trittin gibt zu (!), daß er mit Reden wie in Berlin ein linkes Potential an die Grünen binden möchte, ‚auf das sich sonst die PDS mit ihrem großen Arsch draufsetzt‘. Die Grünen müßten auch ihre ‚Stammwähler halten‘, und da sei ein ‚gewisses Austarieren nötig‘, glaubt Trittin … ‚In bestimmten Milieus‘ machten sich Zweifel breit, doziert er, ‚ob die Grünen noch die Friedenspartei sind‘.“ (SZ 22.06.98)
Was hat eine Friedenspartei mit antimilitaristischer
Tradition, die ihren Frieden mit der Militärmacht
Deutschland geschlossen hat, weil sie sie führen
will, ihrem „linken Potential“ zu bieten? Natürlich keine
Kritik des praktizierten Militarismus der Nation, dafür
ein überzeugendes Angebot an die Klientel, damit sie
ihrem Beruf als „Stammwählerschaft“ nachkommt und ihre
„Erwartungshaltung“ nicht von der verhaßten Konkurrenz
bedienen läßt. Das Angebot ist eine
unmißverständliche Absage an eine „Tradition“.
Der Antimilitarismus, den die grüne
Friedenspartei sich als Restposten dieser „Tradition“ bis
heute bewahrt hat, präsentiert sich zeitgemäß als
Antikritik in Sachen Militär: Kein Einwand gegen
die Bundeswehr, kein böser Vergleich zur Wehrmacht, kein
(Pauschal-)Verdacht gegen Soldaten und Offiziere wegen
falscher Gesinnung, wie das neulich noch in Mode war. Die
Institution geht in Ordnung, der Auftrag ist gebilligt,
die Truppe moralisch intakt. Trittin betont in dem
Gespräch auch, die Bundeswehr sei von ihrem
Selbstverständnis her, auch was ihre Offiziere,
Unteroffiziere und Mannschaften angeht, in keiner Weise
mit einer dieser vordemokratischen Armeen zu
vergleichen
. (SZ
29.06.98)
Nur der oberste politische Befehlshaber zieht sie in den Sumpf mit seiner unsäglichen Traditionspflege, macht sie damit attraktiv und anfällig für Leute, die in der Armee nichts zu suchen haben. Die Gelöbnisfeier steht also in der Kritik, aber nicht einmal das ist wahr. Denn „pervers“ ist das „Ritual“ für Trittin durch den Umstand, daß es nicht im Kasernenhof exerziert, sondern öffentlich inszeniert wird. Und selbst daran könnte er nichts kritikabel finden, wenn nicht schon Hitler seine Vorliebe für den „Staatsbürger in Uniform“ entdeckt hätte. In dieser formellen Unterscheidung besteht der ganze Einwand, der an der Gelöbnisfeier selber nichts bemerken und aussetzen will. Und das wäre ja auch seltsam: Wer die Soldaten statt „auf eine abstrakte Bundesrepublik“ auf die „Verfassung“ und das „Grundgesetz“ dieser konkreten Republik einschwören möchte, der will an Vereidigungsfeiern nicht das kritisieren, was sie sind:
– Das feierliche Versprechen der Soldaten, die Freiheit und Souveränität der Nation unter Absehung jedes individuellen Interesses bis zum Einsatz ihres Lebens zu verteidigen. Der Eid, auf den jede Armee ihre Soldaten verpflichtet, dem Vaterland in Gehorsam zu dienen, sprich: den eigenen Willen restlos höheren Instanzen zu überantworten und Befehle auszuführen ohne den leisesten Gedanken an ein Wozu. Mithin die Bekräftigung der bedingungslosen Bereitschaft, die in der Ausbildung erworbene Fähigkeit zum Töten auf Kommando jederzeit wirksam werden zu lassen, also beim Umbringen von Ausländern wie lebende Tötungsmaschinen zu funktionieren, weil es bei diesem Handwerk einzig und allein auf den hoheitlichen Willen des Staates ankommt.
– Eine Zeremonie, mit der die höchste Gewalt die Feier ihres vorzüglichsten Standes zelebriert. Eine Feier also, in der sich Anlaß und Zweck sehr sachgemäß in der Symbolik und Theatralik nationaler Größe und Würde austoben, weswegen sie auch kein Ort für kritische Diskurse über Sinn und Zweck der Armee oder „Probleme der inneren Führung“ ist. An Fahne und Nationalhymne, Trommelwirbel und Zapfenstreich kann und soll das Menschenmaterial, auf das der Staat zurückgreift, wenn er mit der Feindschaft gegen seinesgleichen Ernst macht, im Gefühl des Ergriffenseins die Würde seines Standes und die Ehre, die ihm da zuteil wird, an sich selber erleben, Gänsehaut eingeschlossen.
– Eine öffentliche Feier des Militärs, zu der das Volk geladen ist, in dessen Namen die Truppe schließlich marschiert. Nicht nur daß es mitempfinden darf, wenn behelmte Soldaten im Schlagschatten des nächtlichen Fackelscheins ihren Eid sprechen. Es dient auch als „Beweis“, daß die Armee eine des Volkes ist – und umgekehrt ein Volk ohne Armee nichts wert. Das Nationalgefühl, das dabei auf seine Kosten kommt, hat keinen Grund, sich zu schämen. Von „Blut und Boden“ ist nicht die Rede, weil die demokratische Armee „Frieden und Freiheit“ verteidigt, „Menschenwürde“ und „Völkerrecht“, also für jene hehren Ziele einsteht, die – dem „Gebot der Humanität“ folgend – zu weltweitem Eingreifen verpflichten. Patrioten, demokratische zumal, dürfen deshalb stolz auf ihre Soldaten sein.
3. Nicht diesen „Geist“ und Gehalt
der Gelöbnisfeiern findet Trittin kritikabel. Es sind die
äußerlichsten Gesichtspunkte und Umstände des „Rituals“ –
der öffentliche Rahmen, das Datum (Lidice), und die
„Geschichte“, also die Tatsache, daß außer der BRD „nur
noch“ Hitler-Deutschland diese Praxis kannte –, die ihn
an Schlimmes, den großen undemokratischen
Schadensfall der Nation, gemahnen und Anlaß zur Warnung
sind. Die heraufbeschworene „Gefahr“ besteht nicht – Gott
bewahre! – in einem möglichen „Rückfall“, sondern in
einem „Mißbrauch der Soldaten“, in der „Beschmutzung“ der
guten Bundeswehr durch die leichtfertige Pflege
einer traditionsreichen, aber ruhmarmen deutschen
Geschichte
(Berliner
Rede). Das sind die Restbestände sogenannter
„Faschismen“, von denen linke Antifaschisten die
Demokratie und ihre Armee gesäubert sehen wollen. Ohne
die wäre, besser gesagt: ist die Nation mitsamt
ihrem Gewaltapparat schwer in Ordnung und über jeden
Zweifel erhaben. Mit dieser Armee, deren politische
Führung „nur noch“ auf die Traditionspflege verzichten
müßte, haben sich linke Antimilitaristen
endgültig versöhnt: Denn eine echte „Parlamentsarmee“ wie
die Bundeswehr wird kontrolliert und getragen von den
Repräsentanten des Volkes; ihre Akzeptanz gründet nicht
auf „dumpfen“ nationalistischen Gefühlen, sondern auf der
vernünftigen Einsicht in lauter gute Gründe für ihren
Einsatz; eine solche Armee verfolgt keine
nationalen Ziele mehr, sie ist unfähig zur
„Aggression“, weil sie stets im Namen der „Humanität“ die
Menschenrechte verteidigt.
4. Das ist das Angebot, mit dem Trittin seine „Stammwähler“ betört. Er wird schon wissen, warum. Daß die Kritik der denkbar unkritischste Endpunkt des grünen Antimilitarismus ist, honoriert die Öffentlichkeit dennoch keineswegs als Beitrag zur Bereinigung alter Vorbehalte. An der konstruktiven Harmlosigkeit des Einwands nimmt sie vielmehr nur wahr, daß der Mann überhaupt noch eine Kritik an der Bundeswehr hat, die nach den Maßstäben der nationalen Kriegsmoral sakrosankt ist. Die Gehässigkeit, mit der die Nation über Trittin herfällt, dokumentiert nicht dessen Radikalismus, sondern den der Nation: Jedes noch so wohlgesinnte Bedenken „beweist“, daß der Bedenkenträger als nationales „Sicherheitsrisiko“ einzustufen ist, und zwar so grundsätzlich, daß seine Partei gleich von sämtlichen „sensiblen“ Bereichen der Politik ausgeschlossen werden muß:
„Fischer wird – nun erst recht – nicht Außenminister werden können. Auch das Amt des Verteidigungsministers sowie das des Bundesinnenministers wird Schröder den Grünen nicht zuweisen können.“ (SZ 23.06.98)
Was sonst in Wahlkampfzeiten allemal in Ordnung geht, das „Wählerfischen“ auch an den „extremistischen Rändern“ des politischen Spektrums, wird Trittin daher ganz sachlich übelgenommen. Die Bundeswehr hat aus dem Wahlkampf wirklich herauszubleiben, heißt im Klartext: Mit Distanz zu dieser Institution, welcher auch immer, darf man auf gar keinen Fall auch noch Wahlkampf betreiben. Daß der grüne Politprofi die Berechnungen demokratischer Parteien im Kampf um die Macht kopiert, gilt nicht als Zeichen seiner „Lernfähigkeit“, folglich auch nicht als wahltaktischer Schachzug, dessen Gelingen zu begutachten wäre. Profil zeigen und linken Wählerrand abgrasen, damit beim Kampf aller um die „Mitte“ nicht wertvolle Stimmen aus dem „Milieu“, das auch bedient sein will, verloren gehen, ist einfach „pervers“.
Für diesen Befund haben Demokraten gute Gründe. In dem Willen, den Rechtsextremismus überflüssig zu machen, können sie nichts Verwerfliches entdecken, weil sie im Standpunkt ziemlich viele „Berührungspunkte“ bemerken. Die Staatswidrigkeit des Rechtsextremismus besteht nämlich darin, daß er sich „zu“ staatskonform aufführt, also etwa in der Ausländerpolitik das zu „tun“ verspricht, wovon die CSU immer „nur redet“. Deswegen ist es prinzipiell legitim, als Demokrat so zu reden, daß den Rechten ihre „dumpfen Parolen“ im Hals steckenbleiben – um auch noch die unzufriedenen Extremisten staatlicher Ordnung für deren ordentliche Manager zu gewinnen. Das ist dann Taktik, die kein schlechtes Licht auf die Gesinnung wirft, deren völlig ehrenwerte Normalform auf die Art gegen ihre Übertreibung durchgesetzt werden soll. Die einzigen demokratischen Bedenken, die dagegen gelegentlich aufkommen, bestätigen das: Wenn die legitimen demokratischen Töne selbst für den abgebrühten Geschmack von Politbarometerexperten ein wenig zu schrill ausfallen, keimt die Sorge auf, ob die angebotenen „einfachen Lösungen“ überhaupt etwas bringen, sprich: am Ende gerade denjenigen nützen könnten, gegen die sie gerichtet sind.
Ganz anders verhält es sich mit dem Willen, den Linksextremismus – worin auch immer der bestehen soll – zu „integrieren“, also vom „großen Arsch der PDS“ zu befreien und an grüne Realpolitik zu „binden“. Hier ist die Nation sich völlig sicher, daß sie es mit einem in der Sache unverträglichen, letztlich staatsfeindlichen Standpunkt zu tun hat. Da gibt es wenig bis gar keinen Konsens im Anliegen, in deren Namen Radikalinskis zur Ordnung zu rufen wären, sondern nach gültigem Konsens der angestammten bundesdeutschen Demokraten eine auch in kleinen Dosen verkehrte Gesinnung, die aus- und nicht eingegrenzt gehört. Eingrenzungsversuche nach dieser Seite hin sind daher ein falsches Entgegenkommen – und entlarven die behauptete Taktik als Alibi von Gesinnungstätern:
„Daß sich Trittin dann auch noch über das Massaker von Lidice ausließ, ist mit Mangel an Logik oder schierer Dummheit nicht mehr zu erklären: dahinter steht ein geschlossenes radikales Weltbild. Schließlich mußte ein führender Politiker der Grünen auch wissen, was er tat, als er sich bereit erklärte, zusammen mit Gysi (PDS) bei dieser traurigen Veranstaltung aufzutreten. Das war Konkurrenz allein unter dem Aspekt des Wählerfischens im selben extremistischen Lager, ansonsten sind die beiden Herren weitgehend deckungsgleich.“ (FAZ, 12.06.98)
Noch eine „Tradition“ – grüne „Schadensbegrenzung“
1. Der trostlose Rest des grünen Antimilitarismus, die wahlkampfmäßige Berechnung auf eine längst aus dem Verkehr gezogene „Tradition“, nützt dem obersten Strategen des Machterwerbs ebenso wenig wie seiner Partei. Ganz gezielt nehmen die regierenden Parteien ebenso wie der potentielle Bündnispartner SPD zehn Tage später die Bundestagsdebatte über die Verlängerung des SFOR-Mandats in Bosnien zum Anlaß, mit Trittin und den Grünen abzurechnen bzw. sich entschieden von ihnen zu distanzieren. „Dumm und würdelos“, so der angegriffene Minister Rühe, sei Trittins Auftritt gewesen, „eine Schande für die deutsche Politik“.
„Rühe griff auch Fischer an, der ‚in Nadelstreifen‘ vor der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik spreche, während sein Parteisprecher ‚gegen die Bundeswehr pöbelt‘. Auch SPD-Fraktionschef Rudolf Scharping verurteilte Trittins Auftritt in Berlin. Die SPD faßte ihre Kritik wie Union und FDP sogar in eine Resolution. Alle drei Fraktionen verteidigten darin die öffentlichen Gelöbnisse.“ (SZ 20.06.98)
Das „überzeugende Votum“ der Grünenfraktion für die
Fortsetzung des SFOR-Einsatzes ist nichts wert
angesichts des Berliner Auftritts des Parteisprechers.
Der Verteidigungsminister hat schließlich ein Gutachten
erstellen lassen, das – wie der Name schon sagt –
glaubwürdig bescheinigt, daß die Bundeswehr gut
ist und nicht „unterwandert“. Neunzig Prozent der
Bevölkerung stehen hinter ihr, an der „Verbundenheit“ der
Hauptstadt mit ihr können auch lautstarke Minderheiten
nichts ändern
(Diepgen),
folglich kann auch das Gelöbnis kein militärisches
Relikt aus der Vergangenheit
sein, es ist
bleibende Verpflichtung in Gegenwart und Zukunft
und nicht dem Wandel des Zeitgeistes unterlegen
(Rühe). Und: Wer hat denn das
Oder-Hochwasser erfolgreich eingedämmt, wenn nicht
„unsere Soldaten“! So eine Armee verdient es nicht,
„beschmutzt“ und „beleidigt“ zu werden. Herr Trittin soll
sich gefälligst entschuldigen!
2. Mit derselben Gehässigkeit wie
die Nation fällt die eigene Partei über Trittin her. Sie
ist sich weitgehend einig, daß der „Schaden“ immens ist;
eine „politische Katastrophe“, „verheerend“ dieser
Auftritt. Sie gibt den Vorwürfen der Öffentlichkeit und
ihrer politischen Gegner in allen Punkten recht und kennt
auch den Schuldigen – den eigenen Vorsitzenden.
Auf den prügelt sie ein. Die Frage des Preises
kommt auf den Tisch und ist in guter demokratischer
Manier sofort entschieden: 5 gewonnene Kreuzberger
Stimmen gegen 5000 verlorene aus dem
„bürgerlich-liberalen Lager“. Ein Witz! Wer so
kalkuliert, dem sind die Koordinaten des Realitätssinns
abhanden gekommen: „ein Kämpfer gegen die Zeit“. Aber das
weiß man ja schon länger. Übergang also zum
Charakter. Trittin ist „uneinsichtig“ und
„verbohrt“, er ist unfähig zur Selbstkritik und
„unberechenbar“ auch intern. Politische
Konsequenzen: Trittin ist eine „Belastung“ für
die Partei. Ist er überhaupt noch tragbar? Sollte er
nicht besser zurücktreten? Offen wird darüber spekuliert,
daß der „Burgfrieden“ – wg. „Erscheinungsbild“ vor Wähler
– exakt bis zum Wahltag halten werde, dann aber könne er
sich seine Karriere abschminken: Trittin habe nun
keine Aussichten mehr auf ein Ministeramt
.
(SZ 24.6.98) Ätsch! Den
Höhepunkt dieser freundschaftlichen Aussprache unter
Genossen bildet die Bundestagsdebatte zum SFOR-Einsatz
der Bundeswehr. Dort distanziert sich als erster der
Parteigenosse Fischer von Trittin, was die erstaunte
Öffentlichkeit als „Demontage“ und „Sensation“ zur
Kenntnis nimmt. Es folgen weitere Grünen-Abgeordnete, die
ihren Dissens in „persönlichen Erklärungen“ („Trittin hat
nicht für mich gesprochen“) vortragen, den Soldaten für
ihre „riskante Arbeit“ in Bosnien danken und mit
hemmungslosen Bekenntnissen zur Bundeswehr der Würde des
Anlasses entsprechen:
„Winni Nachtweih, einer der linken Abgeordneten, der sich lange mit seiner Entscheidung für den Bundeswehreinsatz in Bosnien quälte, hat nach seinem Ja zur SFOR … eine persönliche Erklärung abgegeben … Wer ihn des ‚Verrats an pazifistischen und antimilitaristischen Grundsätzen‘ bezichtige, habe ein ‚dogmatisches Verständnis von Prinzipientreue‘. Winni Nachtweih stand im Oktober 1996 mit einem Trupp aus seiner Fraktion … über dem zertrümmerten Sarajewo, und er schämte sich, weil Pazifisten zulassen wollten, daß die Menschen unten in Sarajewo ‚wie in einer Mausefalle‘ gefangen waren.“ (SZ 22.06.98)
Wer „Prinzipientreue“ nicht „dogmatisch“ versteht, der muß zur Einsicht gelangen, daß nur die Bundeswehr die einzig wirkliche „pazifistische und antimilitaristische Bewegung“ sein kann. Das ist der Weg zur Macht, den die Partei sich merkt. Der Geist, den Rühe mit den Gelöbnissen angeblich heraufbeschwört, fühlt sich in den Reihen der Grünen längst zu Hause. Und er hat wieder einmal gar nichts mit militaristischem Getöse zu tun, dafür sehr viel mit „Humanität“ – dem Titel für moderne demokratische Kriegsmoral.
3. Zu guter Letzt besinnen sich die Grünen auf ihren Willen zur Macht. „Betroffen“ vom eigenen Werk, betrachten sie die Prügel, die sie öffentlich und intern mit der ganzen Erbitterung moralischer Gehässigkeit gegeneinander ausgeteilt haben, als „Scherbenhaufen“ und beklagen die „öffentliche Selbstzerfleischung“. Mit diesem „Bild der Zerrissenheit“ kann man keine Wahl gewinnen, also gilt die Parole: „Schluß mit den Eigentoren!“ Nach den „Krisengesprächen“ und dem „Friedensschluß“, den Fischer „mit zusammengebissenen Zähnen verkündet“ (SZ), erklären die Kritiker „den Streit für beendet“. Dem folgt die Demonstration der Geschlossenheit der Führungsmannschaft, die Arm in Arm ihre Eintracht und gute Laune vor den Kameras zeigt. Auch in der Sache ist man sich einig, sogar schriftlich: Trittin hat in seiner Rede die Bundeswehr nicht mit der Wehrmacht gleichgesetzt. Und: „Einen gegenteiligen öffentlichen Eindruck bedauern wir.“ (Erklärung)
Als „Rückzug“ soll das nicht verstanden werden und auch
nicht als „Niederlage Trittins“. Denn das
unverwechselbare „grüne Profil“ hat weiterhin Bestand:
Öffentliche Gelöbnisse lehnen die Grünen aber nach wie
vor ab.
(SZ) Daß solches
„Profil“ zu zeigen, „nötig“ ist, aber auch „schwierig“,
dafür finden die Grünen bei den Vertretern der vierten
Gewalt dann wieder das größte Verständnis:
„Wie weit nach links dürfen sich die Grünen in der Öffentlichkeit bewegen, ohne im Herbst unter die Fünf-Prozent-Marke zu rutschen?… Wie deutlich müssen die Grünen sich zu ihrem linken Spektrum bekennen? Schließlich soll Rot-Grün zumindest für einen Teil der Wähler als Reformbündnis erscheinen.“ (SZ 27.07.)
Sicher, eine „idiotische Kurzansprache“ (ebd.) sollte es nicht mehr geben.
Denkbar wäre aber auch, daß man – zumindest dem
„einen Teil“ der Wähler (der für die 5%-Marke
zuständig ist) – reinen Wein über Trittin einschenkt und
endlich sagt, daß es genau jene Art von …
Grundsatzlosigkeit (war), die Schröder und Trittin in
Niedersachsen vier Jahre lang außerordentlich erfolgreich
zusammenarbeiten ließ.
(ebd.) Der andere braucht das ja
nicht zu wissen.