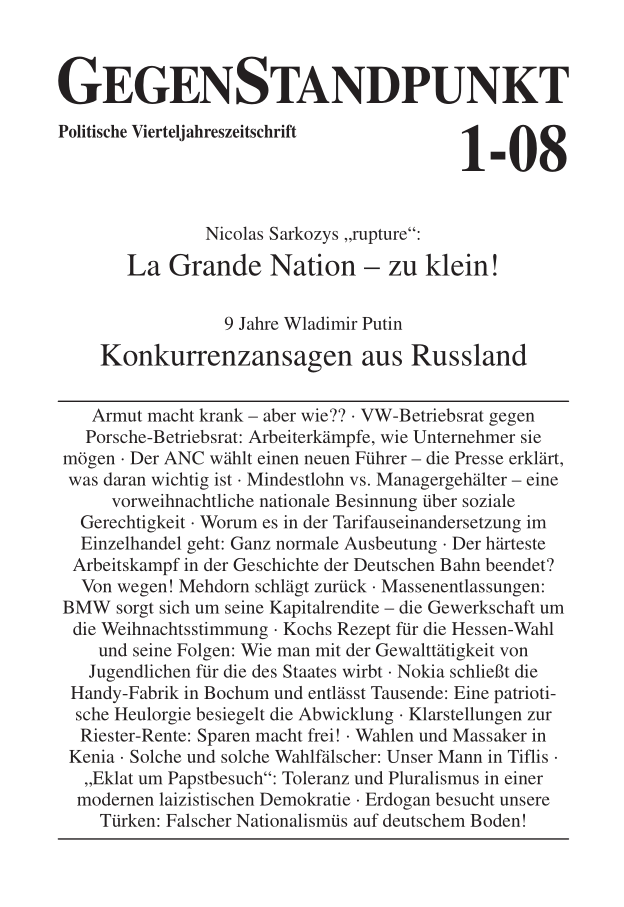Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Wahlen und Massaker in Kenia:
Wieder einmal bleiben uns die Afrikaner ihre Demokratisierung schuldig
Bei den Präsidentschaftswahlen am 27.12.2007 in Kenia wird nach Ansicht aller Beobachter das Wahlergebnis zugunsten des bisherigen Amtsinhabers Kibaki gefälscht. Sein schärfster Konkurrent Odinga „hatte zwar in sechs von acht Provinzen gesiegt. Die Wahlkommission hatte dennoch mit angeblich 230.000 Stimmen Vorsprung Kibaki zum Wahlsieger erklärt.“ (HB, 16.1.08) Außerdem liegt Odinga kurz vor Auszählung von fast 90% der Stimmen noch deutlich vor Kibaki in Führung; doch es kommt „zu seltsamen Verzögerungen beim Auszählen … ‚Aber Herr Vorsitzender, das sind doch nicht die Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe‘, hörte das Fernsehpublikum einen Wahlbeamten rufen, als Samuel Kivuitu, der Chef der Wahlkommission, wieder einmal eine unerklärlich hohe Stimmenzahl für Kibaki verkündete. Auch Kivuitu selbst schien die Sache nicht geheuer zu sein. Einmal sagte er, und auch das wurde von den Mikrofonen des Fernsehens eingefangen: ‚Irgendetwas stimmt hier nicht.‘“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Wenn sich Afrikaner massakrieren, schädigt das unsere Interessen ...
- ... und, das vor allem: die Demokratie
- Vom wirklichen Elend des demokratischen Machtkampfs in einem afrikanischen ‚Vielvölkerstaat‘
- Der Konsens der Demokraten: Obwohl Wahlen in Afrika nichts bessern, müssen sie sein ...
- ... als Eingriffstitel für eine harte imperialistische Oberaufsicht!
- Nach der ethnischen Tragödie die demokratische Farce: Berliner Verhältnisse für Nairobi
Wahlen und Massaker in Kenia:
Wieder einmal bleiben uns die Afrikaner ihre Demokratisierung schuldig
Bei den Präsidentschaftswahlen am 27.12.07 in Kenia wird nach Ansicht aller Beobachter das Wahlergebnis zugunsten des bisherigen Amtsinhabers Kibaki gefälscht. Sein schärfster Konkurrent Odinga hatte zwar in sechs von acht Provinzen gesiegt. Die Wahlkommission hatte dennoch mit angeblich 230 000 Stimmen Vorsprung Kibaki zum Wahlsieger erklärt.
(HB, 16.1.08) Außerdem liegt Odinga kurz vor Auszählung von fast 90 % der Stimmen noch deutlich vor Kibaki in Führung; doch es kommt
„zu seltsamen Verzögerungen beim Auszählen ... ‚Aber Herr Vorsitzender, das sind doch nicht die Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe‘, hörte das Fernsehpublikum einen Wahlbeamten rufen, als Samuel Kivuitu, der Chef der Wahlkommission, wieder einmal eine unerklärlich hohe Stimmenzahl für Kibaki verkündete. Auch Kivuitu selbst schien die Sache nicht geheuer zu sein. Einmal sagte er, und auch das wurde von den Mikrophonen des Fernsehens eingefangen: ‚Irgendetwas stimmt hier nicht.‘“ (SZ, 7.1.)
Noch bevor alle Stimmen ausgezählt sind, erklären sich beide Kandidaten zum Wahlsieger. Es folgen blutige Unruhen: Angehörige der Ethnie der Luo, denen Odinga angehört, machen Jagd auf die Kikuyu, als deren Vertreter Kibaki gilt, und umgekehrt. Dabei kommen Hunderte ums Leben, rund 250 000 flüchteten aus ihren Städten und Dörfern
(HB, 16.1.). Manche Beobachter warnen schon vor einem „Zweiten Ruanda“. Nachdem die USA zuerst Kibaki zum Sieg gratulieren, erklärt das Außenministerium kurze Zeit später, dass es wirkliche Probleme wegen Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung gegeben habe.
(Guardian Weekly, 4.1.08) Die für Afrika zuständige stellvertretende Außenministerin fliegt nach Nairobi und fordert von Kibaki, mit seinem Rivalen eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Doch Odinga lehnte diese kategorisch ab.
(HB, 7.1.) Auch ein Vermittlungsversuch der Afrikanischen Union, dem Kibaki nach anfänglicher Weigerung zustimmt, führt nicht zu der von „der internationalen Gemeinschaft“ gewünschten Einigung. Schließlich schaltet sich auf Vorschlag der UNO deren ehemaliger Generalsekretär Kofi Annan ein; bis auf weiteres wird verhandelt.
Wenn sich Afrikaner massakrieren, schädigt das unsere Interessen ...
So akribisch die demokratischen Medien ihrer Informationspflicht nachkommen, so eindeutig klären sie ihr Publikum darüber auf, was eigentlich auf dem Spiel steht, wenn in Afrika ein „Beinahe-Völkermord“ droht:
„Washington fürchtet, dass Kenia, in das jährlich 1,5 Mrd. Dollar aus den USA fließen, ins Chaos abgleitet. Wegen der in den Nachbarländern Somalia und Sudan aktiven islamistischen Gruppen müsse Kenia jedoch ein ‚Pfeiler im Kampf gegen den internationalen Terrorismus‘ sein.“ (HB, 7.1.) Außerdem „sei die unsichere Lage langfristig eine ‚Bedrohung für Investitionen in der ganzen Region‘, warnt der Chef der ugandischen Industrie- und Handelskammer.“ (SZ, 22.1.)
Dass in Kenia Hunderte getötet und Hunderttausende vertrieben werden, interessiert also in erster Linie in Bezug auf die Leistung, die das Land im weltweiten Kampf der USA und ihrer Verbündeten gegen den internationalen Terrorismus
zu erbringen hat, nämlich hinsichtlich seiner Funktion als Pfeiler
. Die ist jetzt gefährdet. Ebenso wie alle möglichen schönen Gelegenheiten zum Geldverdienen, die sich für die internationale Geschäftswelt gerade in letzter Zeit zunehmend ergeben haben. Schließlich wird man im Fernsehen auch noch mit dem Schicksal von Volksgenossen vertraut gemacht, die sich zufälligerweise als Touristen in dem Land aufhalten: Ist für deren Sicherheit ausreichend gesorgt? Die politisch-militärische wie die wirtschaftliche Benutzbarkeit Kenias und nebenbei auch die persönliche Sicherheit deutscher Bürger: das sind also die Werte, die auf dem Spiel stehen, wenn sich auf dem Schwarzen Kontinent wieder einmal eine Gewaltorgie abspielt. Und wer da meint, das gehe ihn alles nichts an, wird schnell eines Besseren belehrt:
„Das wäre ‚unklug, weil es die westlichen Länder zu spüren bekommen, wenn sich die Lebensverhältnisse in Afrika nicht bessern‘. Da muss man nur an die Flüchtlinge in Ceuta und Lampedusa denken. Unklug wäre es auch, weil Afrika als Wirtschaftspartner immer wichtiger wird. Chinesen und Inder sichern sich längst Abbaulizenzen für wertvolle Rohstoffe und verkaufen den Afrikanern Mobiltelefone und Textilien.“ (SZ, 31.12.07)
Aus dieser Perspektive verbietet es sich also, bei neuesten Nachrichten über ‚Neger, die nichts Besseres zu tun haben, als aufeinander loszugehen‘, desinteressiert abzuwinken. Wenn das so weitergeht, werden wir nämlich bald nicht mehr wissen, wohin mit all den Flüchtlingen, und außerdem würde Nichteinmischung unsere Arbeitsplätze gefährden, weil die üblichen Verdächtigen die Geschäfte mit Afrika machen werden, die eigentlich uns zustehen. Aus den Schlächtereien in Kenia folgt eine unabweisbare Pflicht der USA und der Europäer, sich einzumischen; schlicht deswegen, weil sie mit ihrem ‚Krieg gegen den Terror‘ und als „Wirtschaftspartner“ schon längst eingemischt sind und das Feld auf keinen Fall konkurrierenden Interessenten überlassen dürfen: So offensiv rechtfertigt nicht nur, sondern fordert unsere Öffentlichkeit geradezu eine Politik, die man früher einmal Imperialismus zu nennen pflegte.
Aber selbstverständlich geht es nie bloß um unsere eigenen Interessen: Unsere freiheitlichen Meinungsbildner wollen nur das Beste für Afrika. Was dem Kontinent und seinen Bewohnern nottut, weiß nämlich niemand so gut wie die einschlägigen Experten in unseren Redaktionen.
... und, das vor allem: die Demokratie
Die Afrikaexpertin der ‚Süddeutschen Zeitung‘ interpretiert die Ereignisse in Kenia vor allem als eine Niederlage für die Demokratisierung
Afrikas:
„Mit der dilettantischen Wahl verspielt Kenia seinen Ruf als afrikanisches Vorzeigeland. Das allein wäre schon traurig genug. Das verheerende Signal belastet aber die Demokratisierungsbemühungen auf dem ganzen Kontinent. Dabei wäre eine ordentliche Wahl ‚umso wichtiger gewesen, nachdem schon das westafrikanische Musterland Nigeria bei den Wahlen im Frühling kläglich versagt hatte‘.“ (ebd.)
Bei Frau Raupp hatte Kenia also bis Weihnachten noch einen guten Ruf – als Land, das irgendwie ihrem politischen Geschmack ziemlich gut entsprach. Vielleicht hatte sich da noch nicht bis zu ihr herumgesprochen, was Kollege Bitala vier Tage später immer schon gewusst hat:
„Jeder europäische oder amerikanische Politiker, der nach Kenia kam, pries das Land für seine Demokratie und seine Stabilität. Und die ausländischen Korrespondenten, die in Nairobi leben, rieben sich dann immer nur verwundert die Augen. Gab es doch seit langem Anzeichen dafür, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sich die Wut der Menschen freie Bahn bricht.“ (SZ, 4.1.)
Doch mit ihrem Bild von Kenia, das der Kollege als Trugbild
entlarvt, stand die Expertin nicht allein. Einen halben Monat lang vermittelt ein Heer von Sachkennern, ganz anschaulich auch im deutschen Fernsehen, das Bild einer Nation, deren Bürger vor allem damit beschäftigt sind, sich auf eine freie Wahl mit einer echten Alternative zu freuen; die dementsprechend noch am Wahltag nichts Besseres zu tun haben, als in langen Schlangen geduldig vor den Wahllokalen anzustehen, um ihr gleiches und geheimes Votum abzugeben. Dass dem Oppositionskandidaten zugetraut wird, die Mehrheit zu kriegen, wird als Beleg für die demokratische Reife des Landes gewürdigt: Kenia kriegt womöglich sogar einen Personalwechsel an der Staatsspitze per Abstimmung hin – dann müssen die Verhältnisse dort ganz einfach in Ordnung sein! Ob außer zwei Aspiranten auf die Macht im Staat sonst noch was zur Abstimmung steht; ob die Kenianer sich von einem Wahlsieger Odinga überhaupt noch etwas anderes versprechen dürfen als einen Personalwechsel; ob die Präsidentenwahl auch nur irgendetwas mit den elenden Lebensverhältnissen zu tun haben könnte, die für so viel „Wut“ in der Bevölkerung sorgen: Das ist bis zum Wahltag entweder überhaupt kein Thema, oder man wird ganz abgeklärt auch noch darüber aufgeklärt, dass der eventuelle Neue auch nicht besser ist als der alte. Dem guten Ruf der kenianischen Demokratie schadet aber auch diese Auskunft einstweilen nicht wirklich: Dass überhaupt ein friedlicher Machtwechsel möglich erscheint, ist aus demokratischer Sicht das entscheidende Gütesiegel für die Nation; daneben darf man einmal vergessen, für welche verheerenden Verhältnisse im Land bisher schon und weiterhin die Staatsmacht gerade steht, die vielleicht in neue Hände übergeht, vielleicht auch bei den bisherigen Machthabern verbleibt, auch dann aber durch die Abstimmung geadelt ist. Man ist so frei, von allem Elend abzusehen, wenn es um die Form der Ermächtigung konkurrierender Mitglieder der nationalen Politikerkaste geht.
Und damit sieht es gut aus. Die Freunde gesitteter Verhältnisse beim Erwerb von Herrschaftsmacht sind zufrieden und hoffnungsfroh – bis zum Wahltag einschließlich. Anschließend ist man dann enttäuscht: Die Form wird nicht gewahrt; so heftig wird gegen das vorgeschriebene Prozedere verstoßen, dass die Hauptsache, nämlich eine reibungslose, widerspruchslos anerkannte Ermächtigung – von wem und wozu auch immer – nicht zustande kommt. Das ist ein Unglück – tatsächlich für die Stabilität der Macht, auf die die imperialistische Außenwelt Anspruch erhebt; in der idealistisch verfremdenden Sicht demokratischer Interpreten des Geschehens jedoch in Wahrheit und vor allem für die Demokratie. Genauer: für die – offenbar auf dem ganzen Kontinent nicht besonders erfolgreichen – „Bemühungen“, den Staaten und Völkern Afrikas das Verfahren der Machtzuteilung beizubringen, das man keineswegs nur in Münchner Redaktionsstuben für das alles entscheidende Qualitätsmerkmal politischer Herrschaft hält; für den höchsten Wert, der weit über allen Notwendigkeiten des materiellen Überlebens rangiert. Von solchen Notwendigkeiten ist deswegen auch dann nicht die Rede, wenn die Expertin der ‚Süddeutschen‘ ihren Lesern darlegt, welchen fatalen „Teufelskreis“ die „dilettantische Wahl“ in Kenia auslöst:
„... die Menschen verlieren den Glauben, dass sie eines Tages faire und verantwortungsbewusste Regierungen bekommen werden. Das erschwert die Arbeit von Menschenrechtsgruppen... Dabei hätten sie Unterstützung dringend nötig, weil ihre Bewegung erst am Anfang steht. Ohne den Einsatz der Zivilgesellschaft werden sich in Afrika kaum Demokratien entwickeln.“ (SZ, 31.12.07)
Korrekt ausgezählte Stimmen wären also so etwas wie eine Garantie für faire und verantwortungsbewusste Regierungen
und die ohnehin das Beste, was der Mensch sich in dieser Welt erwarten darf: Ob Frau Raupp das selber ernsthaft glaubt, sei dahingestellt; bei den Afrikanern möchte man diesen demokratischen Glauben aber auf alle Fälle verankert sehen. Der ist nämlich nötig, damit die organisierten Missionare dieses Glaubens aus ihren Startlöchern herauskommen. Das wiederum ist unerlässlich, damit sich die demokratischen Herrschaftsformen entwickeln
, ohne die die Menschen den Glauben
an die Demokratie als Höchstwert verlieren
... Diesem Zirkel eines demokratischen Glaubens, ohne den die demokratischen Gepflogenheiten nicht entstehen, ohne die niemand an deren Segnungen glaubt, haben die passiv Wahlberechtigten der kenianischen Präsidentenwahl Schaden zugefügt; zumal sie das Ergebnis des Urnengangs nicht bloß gefälscht, sondern das gefälschte Ergebnis noch nicht einmal geduldig abgewartet haben:
„Der Amtsinhaber und sein Herausforderer haben die Lage zusätzlich verschlimmert, weil sie sich jeweils zum Sieger erklären ließen, bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Wären sie wahre Staatsmänner, hätten sie öffentlich bekunden müssen, das Resultat abzuwarten und die Entscheidung der Wähler zu respektieren.“ (ebd.)
Wenn sie wenigstens das bisschen Anstand aufgebracht hätten: Dann wäre in Kenia und auf dem Kontinent die politische Welt in Ordnung? Offenbar denkt die Expertin im Prinzip so. Sonst könnte sie nämlich unmöglich auf die neue Hoffnung
verfallen, die sie aus der bloßen Tatsache schöpft, dass die gleichzeitige Parlamentswahl bei den dort zu vergebenden Posten doch tatsächlich zu einem gewissen Wechsel des Personals geführt hat, über das man gar nichts weiter zu wissen braucht, als dass es nicht mehr das alte ist:
„Die Wahl in Kenia, so unglücklich sie gelaufen ist, zeigt auch eine positive politische Entwicklung ... Nun haben die Kenianer viele Abgeordnete durch junge Politiker ersetzt. Sie sind zwar unerfahren – aber auch unbelastet. Nach dem Wahldebakel sind sie die neue Hoffnung für Kenia.“ (ebd.)
Leider kann diese junge Garde ihr einschlägiges Talent aber noch nicht unter Beweis stellen. Denn die Lage spitzte sich zu
und gibt den anderen Experten Recht, die ein stabiles Musterland Kenia schon seit längerem für ein Trugbild
halten.
Vom wirklichen Elend des demokratischen Machtkampfs in einem afrikanischen ‚Vielvölkerstaat‘
Ein Professor für afrikanische Politik in Oxford und genauer Beobachter Kenias
ist not particularly surprised
durch den Gewaltausbruch nach der Wahl. Denn:
„Kenia hat die höchste Zahl von heimatlosen Flüchtlingen in Afrika, vor allem aus Somalia und dem Sudan. Seine Slums gehören zu den größten in Afrika und seine schnell wachsende, weitgehend arbeitslose Bevölkerung kämpft darum, dass irgendetwas von den Gewinnen des jüngsten Wirtschaftsaufschwungs für sie abfällt.“ (Guardian Weekly, 18.1.)
Der schon zitierte SZ-Reporter Bitala weiß es noch genauer:
„Auf dem Land herrscht bitterste Armut, im Norden, wo sich regelmäßig Volksgruppen wegen Weideland, Wasser und Vieh bekriegen, regiert Gesetzlosigkeit. Die Polizei ist hochkorrupt und gewalttätig, die staatlichen Institutionen funktionieren kaum. Doch am schlimmsten geht es den Millionen Menschen in den Slums der Hauptstadt. Dort bekämpfen sich militante Gangs, dort gibt es täglich ungezählte Opfer der Gewaltkriminalität, und dort sterben die Bewohner an Aids, Malaria, Cholera, Tuberkulose oder Durchfall. Wer jemals einen solchen Slum besucht hat, wundert sich, dass es aufgrund der Misere nicht schon früher zu Gewaltexzessen gekommen ist.“ (SZ, 4.1.)
Zur Erklärung der jüngsten „Gewaltexzesse“ fällt den Kennern der Szene freilich nicht viel mehr ein als eine vulgärmaterialistische Dampfkesseltheorie – der SZ-Mann stellt immerhin noch klar, dass ihm die ethnische Stoßrichtung der Gewalt entschieden missfällt, was innerhalb der deutschen demokratischen Presselandschaft geradezu als sozialkritischer Lichtblick zu werten ist:
„... es ist der Aufstand der Armen, die die Wut über ihre Misere an verfeindeten Volksgruppen auslassen. Dabei müsste sich der Hass der Habenichtse allein gegen die Herrschenden richten. Denn diese plündern seit Jahrzehnten den Staat.“ (SZ, 3.1.)
Fragt sich nur, warum die verelendeten Massen sich stattdessen dafür hergeben, den „Herrschenden“ nicht bloß ihre Wahlstimme, sondern auch noch einigen gewalttätigen Einsatz zu schenken, und ihren Hass und ihre Wut gegen ihresgleichen vom andern Volksstamm zu richten. Eine Antwort gibt – stellvertretend für viele – der Experte der Berliner taz:
„In Kenia ‚bedeutet Macht, das Leben der eigenen Volksgruppe zu verbessern‘.“ (27.12.07)
Bei dem allgemeinen Elend, das die Kikuyu in den Slums der Hauptstadt genauso trifft wie Odingas Luo und andere Völkerschaften, kann das nicht die Wahrheit über Jahrzehnte der Herrschaft von Kikuyu-Leuten sein: Was die Lebenslage betrifft, sind die Gegensätze innerhalb der diversen „Volksgruppen“ allemal unendlich viel größer als zwischen ihnen. Andersherum gelesen wird schon eher ein Stück Erklärung daraus: Die Gefolgschaft der eigenen Volksgruppe ist in Kenia das Mittel ihrer Anführer, sich Zugriff auf die Macht des Staates zu verschaffen. Dabei mag das zynische Versprechen eines besseren Lebens seine Rolle spielen. Vor allem bedienen diese Figuren sich aber für ihre Machtkämpfe der Sorte Anhänglichkeit, die anscheinend auch nach Jahrzehnten kenianischer Staatlichkeit noch allemal wirksamer funktioniert als das staatsbürgerliche „Wir Alle“, das die Insassen einer funktionierenden Klassengesellschaft mit ihrer nationalen Herrschaft verbindet: Sie nutzen die quasi natürliche Verbundenheit der großen Stammesfamilie. Naturwüchsig ist an der zwar nicht mehr viel. Ihren wirklichen Subsistenzkampf führen Kenias einfache Bürger auf ausgesprochen moderne Weise, nämlich auf den Restbeständen an Acker- und Weideland und mit den paar Reichtümern und den vielen Abfallprodukten, die der Zugriff der ‚globalisierten‘ Weltwirtschaft aus den Natur-„Schätzen“ des Landes gemacht bzw. davon übrig gelassen hat. Die Clanchefs samt Anhang konkurrieren ihrerseits um den Zugriff auf die Geldsummen, mit denen die großen Subjekte der Weltökonomie sich einheimische Machthaber kaufen, also um Positionen im staatlich organisierten Machtapparat. Dafür mobilisieren sie aber ihre an Stammesmerkmalen identifizierbare Anhängerschaft. Und als Mittel der Mobilmachung unter den modernen Umständen, die mit einem Szenario für Buschkriege und altertümliche Stammesfehden ja wirklich nichts mehr zu tun haben, haben sie das Institut der demokratischen Wahl als durchaus brauchbares Instrument entdeckt: Per Wahlkampf und anschließende Abstimmung wird der Stammeszusammenhalt zur politischen Waffe. Die quasi natürliche Zusammengehörigkeit einer Ethnie wird von den Konkurrenten um die acht für ihren politischen Kampf berechnend gepflegt; sie sichern sich damit die in Wahlstimmen nachzählbare Zustimmung zur Herrschaft eines Machtkonkurrenten her; eine Zustimmung, für die sich andere staatsbürgerliche Motive definitiv nicht auffinden lassen. Der politische Konkurrenzkampf wird demokratisiert, und das bedeutet nichts anderes, als dass die Völkerschaften so, wie sie sind, für den Kampf der großen Machtaspiranten um die Macht im Staat und um den damit unlösbar verbundenen Zugriff auf Geldmittel funktionalisiert werden.
Dass das Wahlergebnis dann einer Volkszählung nach ethnischen Einteilungskriterien gleichkommt, ist nur konsequent und von den um die politische Macht konkurrierenden Oberhäuptlingen auch so gewollt – solange die sich sicher sind, dass ihre „Volksgruppe“, gegebenenfalls zusammen mit verbündeten Stämmen, in der Mehrheit ist. Deswegen ist deren Machtkampf mit der Abgabe von Stimmzetteln aber auch keineswegs vorbei; schon gar nicht, wenn die Mehrheiten, also die Kräfteverhältnisse im Land nicht eindeutig ausfallen. Dann folgt dem für falsch befundenen Ergebnis der Kampf um dessen Korrektur: um die Richtigstellung des Kräfteverhältnisses zwischen den Stämmen der konkurrierenden Politiker, das sich nach Ansicht des formell Unterlegenen in der bloßen Anzahl der Stimmen gar nicht wirklich niedergeschlagen hat. Wahlen und Wahlkämpfe sind also nicht mehr und nicht weniger als Brennpunkte des dauernden Kampfes rivalisierender Stammesgrößen um Macht und Reichtum des Staates; die Demokratisierung dieses Machtkampfes bedeutet seine periodische Zuspitzung zu einer Art Stammeskrieg, den moderne Politiker führen lassen. Das ist das wirkliche Ergebnis der „Demokratisierungsbemühungen“, denen wohlmeinende Experten aus den Heimatländern der demokratisierten Klassengesellschaft viel Erfolg wünschen, in den real existierenden „Vielvölkerstaaten“ Afrikas.
Der Konsens der Demokraten: Obwohl Wahlen in Afrika nichts bessern, müssen sie sein ...
Den Afrikakennern aus Europa ist diese Realität keineswegs unbekannt. Das hindert die einen aber gar nicht daran, ihr bürgerliches Idealbild von einer demokratisch harmonierenden „Zivilgesellschaft“ als Messlatte an die Realität anzulegen, völlige Fehlanzeigen zu registrieren, darüber enttäuscht zu sein und daraus einen Vorwurf an das Land zu machen, das ihnen die Einlösung ihres „Trugbilds“ schuldig bleibt. Von der Vorstellung, die „failed“ und „failing states“ auf dem „schwarzen Kontinent“ hätten am Prozedere demokratischer Ermächtigung zu genesen, mögen aber auch die kritischeren Gemüter nicht lassen. Im Gegenteil: Rücksichtslos gegen jedes halbwegs plausible Verhältnis von Diagnose und Therapie konstatiert der Kommentator der ‚Zeit‘:
„Der Urgrund der Konflikte sind Armut und eine selbst für Afrika enorme Ungleichheit“,
um fortzufahren:
„Es muss eine international kontrollierte Neuauszählung der Stimmen oder Neuwahlen geben.“ (Die Zeit, 17.1.)
Und der Mann von der ‚Süddeutschen‘ folgert aus seinem Bild der desaströsen Verhältnisse in Kenia:
„Im Vielvölkerstaat Kenia wurde durch die ethnische Gewalt der vergangenen Tage so viel zerstört, dass die weitere Eskalation droht. Schon allein deshalb müsste die Weltgemeinschaft mit Nachdruck die Forderung des kenianischen Generalstaatsanwalts unterstützen, der eine Neuauszählung der Stimmen will. Die Menschen wollen nämlich keine Regierung der nationalen Einheit, wie sie die EU und die USA vorschlagen, sie wollen die Regierung, die sie gewählt haben. (Dumm nur, dass sie und vor allem ihre Anführer sich genau darüber nicht einig sind.) Und wer auch immer dann gewinnt, ob Mwai Kibaki oder Raila Odinga (Das scheint also in der Sache weiter gar keinen Unterschied zu machen ...) – der Sieger muss, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, dringend in die Pflicht genommen werden, damit er sich endlich um die Belange der Bevölkerung kümmert“ (die mit ihrer freien Wahl, auf der sie angeblich so hartnäckig besteht, in der Hinsicht also noch überhaupt nichts erreicht hat ...) (SZ, 4.1.)
... als Eingriffstitel für eine harte imperialistische Oberaufsicht!
Der Aufruf aus München macht immerhin keinen Hehl daraus, was mit dem Antrag auf „mehr Demokratie“ in und für Afrika wirklich gemeint und wer damit angesprochen ist – jedenfalls nicht die vielen Habenichts
, und schon gar nicht, dass die ihre regierenden Blutsauger – die Herrschenden
– zum Teufel jagen sollten. Demokratie in Afrika ist eine Sache, um die die Außenwelt sich zu kümmern hat, die Weltgemeinschaft
, die in dem Fall selbstverständlich nicht aus Indien, Liechtenstein oder Venezuela besteht. Genau genommen ist Demokratie in Afrika überhaupt nichts anderes als ein einziger Aufruf der aktiv wahlberechtigten Völker an auswärtige Aufseher, denen, die sie gewählt haben, auf die Finger zu hauen – und wer dafür allein in Frage kommt, steht dermaßen fest, dass die EU und die USA sich vom Fachmann sofort eine Rüge wegen falscher „Vorschläge“ zuziehen.
Dass die Entscheidung über die Machtverhältnisse letztlich vom Votum der Imperialisten der „1. Welt“ abhängt, sehen die Machthaber vor Ort auf ihre Art ganz genauso. Sie kalkulieren damit, dass die Anerkennung ihrer Herrschaft durchs mächtige Ausland für ihre Macht im Land wie für ihren Status in der Völkerfamilie allemal viel wichtiger ist als ein demokratisch astreines Votum ihres Wahlvolks. Und dass die so berechnend zu Werk gehen und die imperialistische Welt dabei mitspielt, das findet der Kommentator überhaupt nicht gut:
„In Afrika, so haben es etliche der dortigen Machthaber gelernt, ist es egal, wie Wahlergebnisse zustande kommen, Hauptsache, sie werden international anerkannt. So war es, um nur einige Beispiel zu nennen, in den vergangenen Jahren in Äthiopien, in Uganda, in Nigeria oder auch in Ruanda. In keinem der genannten Länder wurden die Mindeststandards demokratischer Abstimmungen eingehalten, und doch genießen die Staats- und Regierungschefs das Wohlwollen des Westens ... Er (Kibaki) hat nur das gemacht, was viele andere afrikanische Machthaber auch schon gemacht haben. Und die Gratulation aus Washington erfolgte prompt.“ (SZ, 2.1.)
Ganz eindeutig verletzt „der Westen“ also seine Aufsichtspflicht, wenn er sein alles entscheidendes „Wohlwollen“ so verteilt, dass verkehrte Potentaten mit ihren Berechnungen dabei auf ihre Kosten kommen. Und ganz verkehrt ist es, so wie der Oberdilettant aus Washington erst dem Falschen zu gratulieren, dann aber, wenn Unruhen ausbrechen, nicht einmal konsequent zu bleiben, sondern „zurückzurudern“ und damit den Kibaki-Gegner Odinga aufzuwerten, obwohl der doch gar kein braves Opfer und schon gar keine pflegeleichte Alternativ-Marionette, sondern für seinen Machtwillen berüchtigt
und, was die Sache erst recht unhandlich macht, schon viel zu mächtig und zu eigenmächtig ist:
„Als Anführer einer der größten Volksgruppen Kenias hat er es in der Hand, die Situation eskalieren zu lassen.“ (ebd.)
Deswegen muss schleunigst klargestellt werden: In Afrika eskaliert nur einer, das ist der demokratische Westen. Deswegen kann das kenianische Volk sich zum Anführer wählen, wen es will: Die Fähigkeit einen Aufruhr anzustacheln, der nicht bestellt ist, gehört dem Mann aus der Hand geschlagen – im Interesse der Demokratisierung, versteht sich:
„Jede westliche Regierung, die es mit der Demokratisierung Afrikas wirklich ernst meint, ist gefordert, alle Mittel einzusetzen, um zur Deeskalation beizutragen. Und dazu gehört auch, eine mächtige Drohkulisse aufzubauen, und zwar sowohl für Kibaki als auch für Odinga.“ (ebd.)
Denn – damit am Ende noch der Dümmste merkt, was mit „Demokratisierung“ gemeint ist:
„Noch ein Krisenherd in Ostafrika widerspricht allen internationalen Interessen.“ (ebd.)
Nach der ethnischen Tragödie die demokratische Farce: Berliner Verhältnisse für Nairobi
Fürs erste wollen sich die zu machtvollem Eingreifen aufgerufenen Imperialisten den Aufwand dann doch nicht zumuten, mit einem „Kriseneinsatz“ tatsächlich für eine Drohkulisse
zu sorgen, die die rivalisierenden Machthaber prompt und unerbittlich in ihre Rolle als Marionetten freiheitlich-demokratischer Drahtzieher einweisen würde. Ein ausgedienter UNO-Generalsekretär, passenderweise selber Afrikaner, tut’s vorerst auch. Der ringt – Massenelend hin, Schlächtereien zwischen Volksgruppen her – um eine große Koalition der beiden feindlichen Brüder im Kampf um Macht und Reichtum Kenias. Wie man so etwas macht, das – so Kofi Annans schlauer Einfall – können Afrikas politisierte Stammesfürsten am besten dort lernen, wo es so etwas schon gibt: von Berlin. Also wird Staatsminister Erler aus Germany eingeflogen, heimlich
, damit er den Streithähnen Kibaki und Odinga erklärt,
„wie die komplizierte Arithmetik der Macht in Deutschland funktioniere und wie man so etwas aushandeln könne“ (SZ, 15.2.) –
kurz: wie Deutschlands Häuptlinge sich Macht und Pfründe einvernehmlich zu teilen wissen.
„Und auch Erler sagt, er habe sehr vorsichtig agiert: ‚Ich bin zu keinem Zeitpunkt auf die Lage in Kenia eingegangen‘. Er habe nur erklärt, wie die komplizierte Arithmetik der Macht in Deutschland funktioniere und wie man so etwas aushandeln könne. ... Einen Koalitionsvertrag in englischer Fassung hat er auch gleich mitgebracht, damit ihn die Afrikaner nun weiter studieren können.“ (SZ, 14.02.08)
Vielleicht wird Kenia so ja wieder zum „afrikanischen Vorzeigeland“ ...