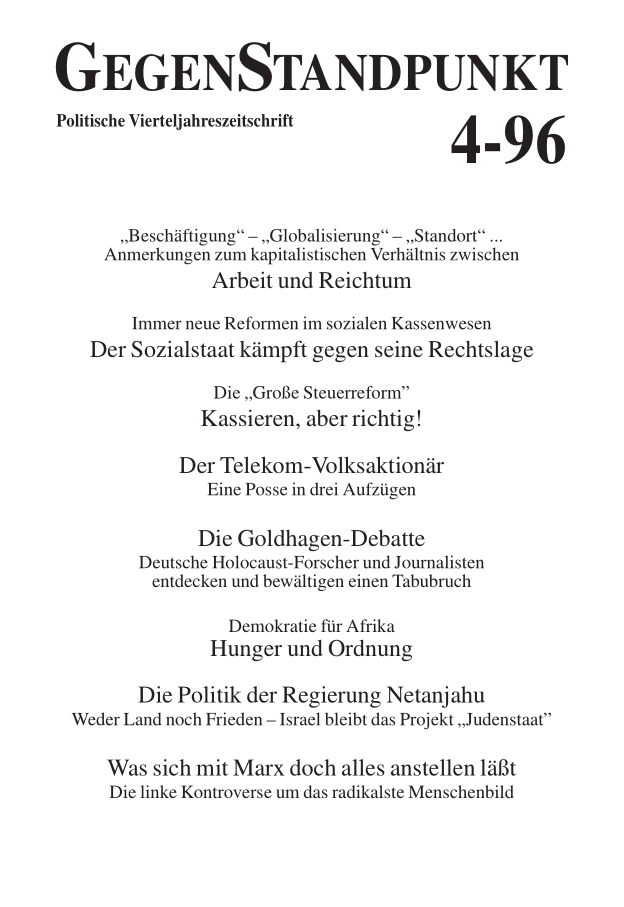Was sich mit Marx doch alles anstellen lässt!
Die linke Kontroverse um das radikalste Menschenbild
Linke wollen (sich) nicht den Kapitalismus sondern die Revolutionsresistenz des modernen Proletariats erklären. Die Notwendigkeit fürs Mitmachen entdecken sie entweder im totalen Systemzwang, der automatisch auch die geistige Anpassung produzieren soll, oder im verdorbenen Charakter der Ausgebeuteten, die sich vom Kapital mit einem guten Leben bestechen lassen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
Was sich mit Marx doch alles anstellen läßt!
Die linke Kontroverse um das radikalste Menschenbild
Ein Leserbrief
„Werte Genossen,
Ich möchte Euch lediglich auf zwei Bücher aufmerksam machen, deren Inhalt durchaus einiges an gewohnten Denkmustern, Grundannahmen und Zielsetzungen der ehemaligen MG und Eures Zirkulars implizit und explizit in Frage stellt. Da mir die nötige Zeit fehlt, näher zu erläutern, welche Punkte ich für strittig halte – mal abgesehen davon, daß ich mich nicht zu den theoretisch Beschlagensten zähle – nur kurz folgende Hinweise:
1) „Interessen“ resp. „Materialismus“ als Maßstab der Analyse und Kritik zu nehmen, war schon mal ein Fehler der verflossenen „Revis“. Anders als kapitalismusimmanent, also in ihm beheimatet und für ihn produktiv, existieren „Interessen“ doch gar nicht. Das Interesse an Lohn z.B. schließt das Interesse an Leistung für kapitalistische Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft ein, und aus dem Widerspruch des Vertragsverhältnisses – die Bedingungen der Realisierung des Lohninteresses werden vom Kapital gesetzt – folgt deswegen noch lange kein antagonistischer Klassengegensatz. Das „Scheitern“ des Lohninteresses in den Mittelpunkt der Kritik zu rücken ist deswegen äußerst fragwürdig. Nicht als Lohnarbeiter – der sich immerhin in der Ableistung abstrakter, kapitalwert-produzierender ARBEIT betätigt – steht man vernünftigerweise zu sich, sondern als Mensch, dem diese ganze Produktionsweise, d.h. die Produktions- und Austauschverhältnisse aller daran so interessiert beteiligten Leistungsidioten, ein bißchen fremd vorkommen kann.
Daß der „Materialismus“ konzediert sei – auch noch vom Staat, der gar nichts produziert –, nur leider an privateigentümliche Schranken stoße, ist ein merkwürdiges Gedankenkonstrukt (vgl. „Psychologie des bürgerlichen Individuums“, § 1). Es macht nur Sinn, wenn man Interessen – wie z.B. an Lohn – gedanklich in gute, wahre, schöne und kapitalismusbedingt definierte verdoppelt und den Schein für das zu befreiende Wesen nimmt: Gebrauchswerte, Güter, Produkte aller Arten – wenn nur das Geld nicht wär’! Eine solche Vorstellung von Materialismus macht sich sofort – als kapitalismuskritische gemeint – unglaubwürdig, wenn die Kohle stimmt. (Der bemühte Nachweis der Armut kann nur auf Arme setzen und – damit er zieht – solche, die an ihren trostlosen Diensten den Geldwert ihrer selbstverständlich erbrachten Leistungen aller Arten nicht ganz angemessen honoriert sehen.)
2) Was die Leute für die kapitalistische Produktionsweise beieinander und geistig auf Linie hält, ist primär weniger die Staatsgewalt und die Pflege moralischer Rechtschaffenheit. Interessiert am Tauschwert von allem und jedem, wie „Materialismus“ in der warenproduzierenden Gesellschaft halt so vorkommt, sind die Leute logischerweise auch am guten Funktionieren der bürgerlichen Austauschverhältnisse interessiert. Das Geld gilt ihnen als allgemeines Aneignungs- und Verfügungsmittel von Privatpersonen mit bürgerlichem Rechtsstatus, die sie offenbar auch sein wollen. Folglich taugt der „Nachweis“ nichts, daß das Geld immer die anderen haben (die kapitalkräftigen Eigentümer brauchen ja wohl nach wie vor im Interesse der Verwertung des Gesamtkapitals auch die „kleine Zirkulation“ oder?)
Entfremdete Beziehungen auf der Basis durchgesetzter WARE-GELD-Verhältnisse zu thematisieren, muß noch lange keine philosophische Vergeheimnissung kapitalistisch bestimmter Sitten und Gebräuche nach sich ziehen. Ganz im Gegenteil!
Aber lest, wie gesagt, die beiden Bücher selber mal, laßt Euch mal ein bißchen was Neues sagen – und verweist nicht auf frühere Artikel, die erhebliche Schwächen haben. Eine offene Stellungnahme in Eurer so martialisch betitelten Zeitschrift wäre selbstverständlich begrüßenswert.
– Ebermann/Trampert, Die Offenbarung der Propheten, konkret Literaturverlag Hamburg, 1995
– Wolfram Auerbach, Diesseits von Gut und Böse, Verlag für die Gesellschaft Hannover, 1996.
P.S. Ich halte die Ausführungen in den erwähnten Schriften nicht für durchweg einsichtig und gelungen. Mir ist in Bezug auf Eure Arbeiten allerdings aufgefallen, daß die „Qualität“ auch Mängel hat. Habt Euch mal lieber nicht so!“
Wir haben uns also nicht so und nehmen Deinen Brief zum Anlaß einer grundsätzlicheren Auseinandersetzung mit dieser Tendenz linken Schrifttums. Du wirst Deine Anregungen in dem längeren Text besprochen finden und Dich auch in vielem von dem wiedererkennen, was von Deinen Lektüreempfehlungen zitiert wird. Vorweg ein paar Bemerkungen zu den gravierenden Fehlern Deiner Stellungnahme.
1. Du setzt die Abhängigkeit der Arbeiter vom Kapital gleich mit einer automatischen Parteilichkeit für das Kapitalverhältnis.
Jeder der in diese Verhältnisse geboren wird, muß sich um Geld und deshalb um Arbeit kümmern. Wer das ihm aufgezwungene Interesse verfolgt und sich auf diese Weise durchschlägt, gehorcht der Not und begeht keinen Fehler, den er auch lassen könnte. Eine Parteinahme für den Kapitalismus ist das nicht. Das Interesse an Lohn schließt das Interesse an kapitalistischer Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft
keineswegs ein. Darauf wird es vielmehr als seine Bedingung gestoßen. Daß diese Bedingung und das Interesse des Arbeiters an seinem Lohn nicht dasselbe sind, bekommt der Lohnarbeiter zu spüren: Um der Bedingung zu entsprechen, muß er beim Interesse zurückstecken. Und noch nicht einmal durch Verzicht kann der Arbeiter die Vorbedingung seines Lohnes sicherstellen: den Gewinn des Kapitalisten, ohne den „Beschäftigung“ erst gar nicht zustande kommt. Arbeiter sind die abhängige Variable des Geschäfts. Sie steuern ihr Schicksal auch nicht durch Verzicht. Das Lohninteresse ist vom Kapital abhängig, wird dadurch beschränkt und oft genug zunichte gemacht. Das ist der „antagonistische Klassengegensatz.“
Mit diesem Widerspruch muß jeder Arbeiter umgehen. Wie er das tut und was er sich dazu denkt, ist eine nähere Befassung wert. Die Feststellung des Gegensatzes ist zu unterscheiden von der Frage, ob die Arbeiter daraus Klassenkampf folgen lassen. Sie lassen nämlich alles mögliche daraus folgen: Bescheidenheit, Rufe nach Gerechtigkeit, gewerkschaftliche Gegenwehr, Nationalismus usw. Das hängt eben davon ab, wie sie sich ihre Lage erklären und wie vernünftig sie ihre Beschränkung finden. Du schreibst, Arbeiterinteressen seien systemimmanent, und kehrst damit die „Revi“-Position, daß die Revolution eine automatische Wirkung der Klassenlage sei, nur in ihr ebenso falsches Gegenteil um: Jetzt soll die Unterlassung des Klassenkampfes eine automatische Wirkung der Lage sein. Arbeiterinteressen sind weder immanent noch systemtranszendierend, sondern schlecht bedient.
2. Du schließt vom falschen Bewußtsein der Lohnarbeiter darauf, daß ihre Interessen nicht geschädigt seien.
Auch wir wissen, daß die Arbeiter mit ihren auferlegten Interessen Übergänge machen, sich wegen ihrer Abhängigkeit vom Gewinn um den Erfolg der Firma, den Stand der Konjunktur, ja den der Nation sorgen und sich dafür verantwortlich machen lassen. Wir wissen aber auch, daß Leute, die sich für die Voraussetzung ihrer Beschäftigung stark machen, ihren Schaden nur vergrößern. Wer die „Notwendigkeit“ sinkender Löhne einsieht und sich geistig wie ein Teilhaber an dem Geschäft aufführt, bei dem er für Lohn antritt, wird dadurch nicht zum Teilhaber.
Es stimmt auch, daß Lohnarbeiter Ideologien des Sich-Abfindens, Gerechtigkeitsillusionen und eine Psychologie entwickeln, mit der sie um ihre Selbstachtung ringen, angesichts der Enttäuschungen, die ihr Erfolgsstreben in der „Leistungsgesellschaft“ erleidet. Mit falschen Gedanken bewahren und erneuern sie ihren Willen, es weiterhin mit anständiger Arbeit zu versuchen. Ihren Frieden mit der Welt machen sie dadurch, daß sie Zweifel an sich wälzen. Deinen Lesefrüchten aus der „Psychologie des bürgerlichen Individuums“ entnimmst Du nicht, was die Leute runterzuschlucken haben, sondern daß sie, wie auch immer, bei Zustimmung zu den Verhältnissen landen. Von der Zustimmung schließt Du darauf, wieviel Grund sie dafür haben müssen: Armut muß man, Dir zufolge, mit der Lupe suchen. Knappen Lohn kennst Du nur als Beschwerdetitel von Gerechtigkeitsfanaktikern, die nie genug kriegen. Fällt Dir denn nicht auf, daß es auch den unausrottbaren Bedarf nach Gerechtigkeit nicht geben würde, wenn materiell alles in Ordnung wäre?
Du kommst uns statt dessen mit der Idee, daß Kritik unglaubwürdig wird, wenn „die Kohle stimmt“! Wo lebst Du eigentlich? Oder schließt Du schon wieder von der Abwesenheit des Klassenkampfs auf befriedigte Interessen? Wenn es übrigens so wäre, daß allgemein die Kohle stimmte; wenn abstrakte Arbeit abzuleisten nicht mehr hieße, eine Arbeit zu verrichten, die sich für den Arbeiter nicht lohnt, dann gäbe es keine Kritik der politischen Ökonomie. Und es brauchte auch keine! Dann nämlich wäre der Materialismus nicht blamiert, sondern befriedigt. Das Geld wäre eine feine Einrichtung zur Befriedigung der Bedürfnisse und das Kapital eine Erfindung zur Vermehrung der Gebrauchsartikel. Dann läge freilich auch das blöde Mitmachertum nicht vor, das Du statt der Ausbeutung gerne kritisiert hättest, und niemand verdiente die Beschimpfung Leistungsidiot
– weil Aufwand und Ertrag des Einsatzes ja offenbar zusammenpassen.
Für Deine Empfehlung, man solle nicht an Armut und Ausbeutung der kapitalistischen Gesellschaft herumkritisieren, sondern sie jenseits „des Materiellen“ insgesamt fremd finden und als Heimat des vernünftig zu sich selbst stehenden Menschen
ablehnen, haben wir nichts übrig. Der neue Klassengegensatz von Mensch und Mitmacher ist uns zugleich zu bescheiden und zu elitär.
Die Linken zwischen Anbiederung und Absage an das „revolutionäre Subjekt“
Was der Leserbrief als Verdacht äußert, dessen sind sich die Quellen seiner Inspiration längst sicher: Robert Kurz und die „Krisis“-Redaktion, die Zeitschrift „Bahamas“ und nun Auerbach erkennen die Marxistische Gruppe, das „ausgefuchsteste“ ihnen bekannte „Klassenkampfprojekt“, als einen Fall für die „Revisionismuskritik“, die die MG vor 20 Jahren in die Linke eingeführt und gegen DKP und K-Gruppen, die damaligen Organisationen obiger Autoren, gerichtet hatte. Unsere Vorwürfe gegen die Arbeiterfreunde werden uns heute zurückgegeben – bisweilen verbunden mit dem Lob früherer Verdienste und der Kritik, hinter erreichte Einsichten zurückgefallen zu sein. Leute, die heute das marxistische Lager heißen, fordern unser Geständnis, daß das Bemühen, Arbeiter zur Revolution zu bewegen, eine fruchtlose Anbiederei an ihre kapitalistischen Interessen ist und von echten Systemkritikern unterlassen gehört. Die Autoren verstehen sich unüberholbar radikal: Ihre Absage gilt dem Kapitalismus mitsamt seinen Insassen. Der „wertförmigen Vergesellschaftung“, dem „Arbeitsfetisch“ und innerkapitalistischer Verteilungsgerechtigkeit ist dagegen verhaftet, wer sich mit den Opfern des Systems anlegt, um ihren Willen zum Mitmachen zu demontieren.
Anders als der Autor des Leserbriefs sich erinnern will, war es kein Fehler der „Revis“, den Materialismus der Arbeiter, d.h. deren geschädigte Interessen zum Ausgangspunkt der Kritik zu nehmen. Im Gegenteil. Was sollte auch krumm daran sein, daß Leute ärgerlich werden, weil ihre Interessen nicht zum Zuge kommen, und sich nach den Gründen dafür fragen? Der „Revisionismusvorwurf“ der MG hatte etwa den entgegengesetzten Inhalt: Parteien, die sich den Sozialismus auf die Fahnen geschrieben hatten, revidierten in ihrer Politik die Notwendigkeit der Schädigung der Arbeiterinteressen in diesem System, von der sie in ihrem Parteinamen immerhin ausgingen. Noch den affirmativsten proletarischen Beschwerden lauschten diese Parteien, die sich mit der Arbeiterschaft „verbünden“ wollten, den Willen zum Widerstand ab. Rufe nach Gerechtigkeit kritisierten sie nicht als Fehler, sondern münzten sie in einen politischen „Kampf für Rechte“ um und gaben das alles für den ersten Schritt zur Revolution aus. Mit Polemik gegen die „unsoziale“ oder „neoliberale“ Politik der Herrschenden suchten sie sich beliebt zu machen, forderten „Bildung statt Raketen“ und niedrige Mieten, machten mit „Preisbrecher-Aktionen“ der proletarischen Hausfrau billige Kartoffeln zugänglich, empfahlen sich also ihren Adressaten als Beistand bei deren Bemühen, unter den gegebenen Verhältnissen zurechtzukommen. Sogar den DGB, dem die Verträglichkeit seiner Forderungen mit dem Erfolg des Modells Deutschland oberste Maxime ist, haben sie als Bündnispartner und Massenorganisation im Vorfeld ihrer revolutionären Umtriebe hofiert. Nie haben sie ihm die Aufgabe der Arbeiterinteressen, die in einer gewerkschaftlichen „Vernunft“ liegt, angekreidet. Sie stellten sich hinter jeden noch so albernen Tarif-Zirkus, um ihm nachträglich eine „systemtranszendierende“ Qualität anzuhängen. Bei den obligaten Solidaritätsadressen an die verehrte Arbeiterschaft blieb es nämlich nicht, jede Lohnforderung radikalisierten sie um einen weiteren, von der Gewerkschaft nicht vorgesehenen Prozentpunkt und propagierten äußerste Entschlossenheit beim Kampf um die „gerechte Forderung“, die sich die DGB-Politiker als Verhandlungsmasse für ihre Kompromiß- und Lohnfindung zurechtgelegt hatten. Die Belegschaften ließen sich von dieser Kampfeslust in der Regel nicht anstecken. Sie wußten, wie die DGB-Forderungen gemeint waren, und meinten sie selbst so. Kritik an diesem „Realismus“ aber war nicht vorgesehen. Im Gegenteil, der heißeste Kampf der DKP fand statt, wenn es galt, echte Arbeiter gegen Kritik in Schutz zu nehmen. Wer Arbeiter kritisiert, hieß es, erklärt sie für dumm; wer die kreuzbraven Methoden der deutschen Lohnfindung verächtlich macht, entmutigt die kämpfenden Kollegen und betreibt das Geschäft der Fabrikherren, denen die – und sei es schwache – Gegenmacht der Gewerkschaften erspart werden soll.
Der gegen den GegenStandpunkt erhobene Vorwurf, sich „affirmativ“ auf die „Lohninteressen“ zu beziehen, hält sich nicht damit auf, uns ein falsches Hofieren der Arbeiter nachzuweisen; es genügt den Anklägern, daß wir überhaupt noch von Ausbeutung reden und es der Mühe wert finden, den Lohnarbeitern ihre schlechten Erfahrungen in diesem Sinne zu erklären. Haben die alten Realsozialisten samt Umfeld uns vorgeworfen, wir würden den Arbeitern, die gerade im Aufbruch seien, die Fähigkeit absprechen, selbst den Ausweg aus der bürgerlichen Ausbeutungsgesellschaft zu finden, so beharren die Heutigen darauf, daß es so einen Ausweg für Lohnarbeiter mit ihren unvermeidlich kapitalistischen, also „wertförmigen“ Privatinteressen sowieso nicht gibt.
Die alten und die neuen Anwürfe – so sehr sie entgegengesetzte politische Absichten verfolgen – verbindet ein theoretischer Fehler: Sie haben das Verhältnis der von Marx erläuterten Gesetze des Kapitalismus – Wert und Mehrwert – zur „Oberfläche der Gesellschaft“[1] nicht verstanden. Methodischer Erläuterungen dieses Typs hat Marx sich bedient, um den Unterschied auszudrücken zwischen den Gesetzen des Kapitalismus und ihrer Durchsetzung in der Konkurrenz der Privateigentümer. In dieser Konkurrenz kommt der Tauschwert nur als Preis von Waren vor, der Mehrwert nur als Kaufpreis der Arbeit und als ihre Anwendung in der Fabrik, der Fall der Profitrate nur als ein Hin-und-Her diverser Wachstumsziffern.
Die alten Realsozialisten und einige Heutige haben von einer Differenz der inneren Gesetze und der Weise, wie sie sich in der Konkurrenz durchsetzen, noch nichts gehört und tun so, als seien die Erklärungen des Kapitals im Geschehen der bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig präsent. Als wüßten die Leute aus purer Anschauung alles Nötige über den Mehrwert, als wäre die Mehrwertrate an Unternehmensbilanzen oder Aktienkursen abzulesen, als wäre die Diagnose ‚Ausbeutung‘ Allgemeingut. Wären die gesellschaftlichen Verhältnisse so einfach und durchsichtig wie die zwischen Herr und Knecht, dann wäre eine Wissenschaft von der politischen Ökonomie freilich überflüssig. Dann wäre es allerdings rätselhaft, warum die lohnarbeitende Mehrheit sich nicht ausgebeutet vorkommt, sondern sich ihre reichlich vorhandene Unzufriedenheit lieber damit erklärt, daß der Anständige halt immer der Dumme ist und daß dem Arbeitsmann die gleichberechtigte Teilhabe an der nationalen Zugewinn-Gemeinschaft noch immer unfair vorenthalten wird.
Die anderen wollen von besagter Differenz in umgekehrter Weise nichts wissen. Sie lassen die Menschen als bewußtlose und zugleich selbstbewußte Verkörperungen der ökonomischen Kategorien des „Kapital“ in der Welt herumlaufen. Sie tun so, als würde, wer seine Miete bezahlt, den Wert anbeten, und wer für Lohn arbeiten geht, sich den „Selbstzweck der Kapitalakkumulation“ zum Vorsatz machen. Auf ihre Weise bestehen auch sie darauf, daß es nichts zu erklären und aufzuklären gibt. Ihre Kritik an der Unvernunft der „wertförmigen Vergesellschaftung“ kennt keine Adressaten, die sich über irgendetwas täuschen. Die Vertreter des „wertkritischen Ansatzes“ verraten, daß sie gar nicht wissen, daß die großkalibrigen Kategorien der Systemkritik, die sie im Mund führen, in so Banalitäten wirklich sind wie in Armut, Aldi und Flexibilisierung der Arbeit. Sie hacken wild auf die „sinnlose Selbstzweckmaschine“ ein und stellen sich ignorant dagegen, daß die maßlose Akkumulation des Kapitals Kritik nur verdient, weil sie der Produktion der Lebensmittel einen konsumfeindlichen Zweck aufzwingt.
I. Kurz, Auerbach u.a.: Kritik der „fetischistischen Vergesellschaftung“
1. Zwei Welten
Wolfram Auerbach widmet der Kritik der Marxistischen Gruppe bzw. der Zeitschrift GegenStandpunkt ein ganzes Buch und bemüht sich darin viel um den überflüssigen Beweis, daß wir Marx verfälschen. Überflüssig erstens deshalb, weil er selbst Marx-Zitate nur gelten läßt, wo sie ihm passen, und zum Marxkritiker wird, wo er dessen Äußerungen nicht als Beleg für seine Ansichten zitieren kann. Er hätte sich also gleich ohne positiven und negativen Bezug auf die große Autorität mit seinen Gedanken auf die unseren stürzen können. Überflüssig vor allem aber zweitens, weil das Plädoyer, das seine Ausführungen konsequent abschließt, auf die Absage an den Umsturz der ökonomischen und politischen Verhältnisse hinausläuft und in den Schrei nach der Befreiung eines jeden von seinem „Subjektsein“ mündet:
„Es geht um unser Leben … wen das alles (Geld, Staat, Armut und Reichtum, Werbung, Subjektsein, Recht usw.) noch abstößt – der fange JETZT bei SICH an! Die revolutionären Linken haben die Welt nur verschieden interpretiert, um sie zu verändern. Es kommt aber darauf an, sie abzustoßen. Es kommt darauf an, sich abzustoßen. Es kommt darauf an, es anders zu machen. FÜR EIN LEBEN OHNE ARBEIT, GELD, STAAT UND MORAL! Stoßen wir uns ab. ABFLUG. EVOLATION.“ (S.193 u. 195)
Relativ zu dieser programmatischen Erklärung ist der sehr „Kapital“-geschulte Beweis unserer Verfälschung Marxscher Theorien reichlich luxuriös. Wer den Abflug in die psychologische Selbstverwirklichung machen will, braucht nicht unbedingt darzulegen, daß der alte Ökonom und Revolutionär ihn auf die Idee gebracht habe. Aber der Autor hat sich offenbar eine langjährige Anhänglichkeit an den grundverkehrten Standpunkt von der Seele schreiben müssen – mit Verve, Spott und einigem Gift. Das alles geht uns nichts an. Seine Argumente jedoch sind repräsentativ für die oben angedeutete Richtung, und sein Plädoyer für den Abgang aus dem Feld von Politik und Ökonomie ist konsequent.
Den Gegensatz zwischen unseren Aussagen und den Lehren von Marx gewinnt Auerbach an zahllosen Stellen über folgendes Verfahren:
„Gegenstandpünktlicher Meinung nach kaufen die Privateigentümer nicht die Arbeitskraft von Menschen für eine bestimmte Zeit, sondern die Arbeit. Konsequenterweise macht sich der GegenStandpunkt (hier immer GSP) den Preis der Arbeit zum Thema. Mit Bomben und Granaten – durchgefallen.“ (S.141)
Im Marx-Examen! Daß in der wirklichen Welt Arbeitsverträge über Geld und Zeit abgeschlossen werden, daß Arbeit also einen Preis hat, dürfen echte Marxisten gar nicht erst glauben. Selbst wenn sie von Marx wissen, daß sich gerade so auf der einen Seite der Mehrwert sammelt und auf der anderen für die Arbeiter nur der Wert der Ware Arbeitskraft übrig bleibt – und meistens nicht einmal der. Die Bezahlung von Arbeit ist das Mittel des Kapitalisten, unbezahlte Arbeit anzueignen. Es ist gerade eine der Schönheiten des Kapitalismus, daß ein freier Austausch zwischen Privateigentümern ein Ausbeutungsverhältnis einschließt. Dagegen verlangt Auerbach ein Entweder-Oder. Er konstruiert eine Opposition zwischen dem wesentlichen Gehalt der Transaktion – Kauf von Arbeitskraft – und ihrer Erscheinung – Tausch von Arbeit gegen Geld – und bestreitet die Erscheinungsweise. Den Widerspruch zwischen beiden, den er bemerkt, will er tilgen, weil dieser eine Quelle der Täuschung, aber auch der Springpunkt ihrer Auflösung sein könnte. Er sieht es eben so, daß Marxisten allen Ernstes in einer anderen Welt leben, als die in den kapitalistischen Verhältnissen Befangenen. Marxisten, meint er, sollen gefälligst in ihrer Welt der erklärten Gegenstände bleiben, wo Arbeitskraft gekauft wird – und die anderen in der ihren, wo Arbeit bezahlt wird.
Dieselbe Trennung zweier Welten bekommen wir auch umgekehrt angetragen bzw. die Verletzung dieser Trennung zum Vorwurf gemacht: Den Umstand, daß die lohnarbeitende Bevölkerung durch die Eigentumsordnung vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen ist und sich dieser Ausschluß durch den Tausch von Lohn gegen Arbeit stets reproduziert und erweitert, widerlegt Auerbach so:
„Wenn die zahlreichen Leute wirklich von allen Produkten ausgeschlossen wären – könnten sie nicht leben! Sie hätten schon längst dahingerafft worden sein müssen. … Von wegen Ausschluß, systematischer zumal, der zahlreichen Leute vom gesellschaftlichen Reichtum! Kein Kapitalismus ohne Lohnarbeiter! Lohnarbeiter wollen ständig reproduziert sein, um arbeiten zu können. Ihre Arbeitskraft hat einen Wert und auch einen Preis. In der Form des Lohns bzw. mit dem, was sie sich davon kaufen können, partizipieren die Lohnarbeiter am gesellschaftlichen Reichtum.“ „Die arbeitende Mehrheit ist NICHT vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen.“ (S.67, 70, 129)
Hier stellt sich Auerbach auf den Standpunkt der Banalität, die jeder sieht: Mit Verweis auf die Form der Transaktion zwischen Arbeiter und Kapitalist, den Tausch von Geld und Arbeit, bestreitet er ihren Gehalt. Weil sie sich überhaupt etwas kaufen können und nicht verhungern, werden die Arbeiter zu Teilhabern am kapitalistischen Reichtum ernannt. Der Gedanke, daß die Art und Weise der Beteiligung den Ausschluß des Arbeiters von seinem Produkt organisiert, ist unserem Kritiker zu undialektisch. Sein gewolltes Mißverständnis lebt von der alternativen Einordnung der Arbeiter in zwei falsche Schubladen: Sind sie Teil der kapitalistischen Gesellschaft, oder stehen sie außerhalb? „Ausgeschlossen“ wären sie, wenn sie gar nichts bekommen würden. Solange sie in dieser Gesellschaft leben – folgert er –, leben sie von ihr, gehören also dazu.
Das ist die Quintessenz seines Wissens über Produktion und Verteilung des Reichtums im Kapitalismus: Die Lohnarbeiter kriegen nicht nichts, sie sind tatsächlich Teil der kapitalistischen Gesellschaft. Die Frage, was für ein Teil sie sind, ist im Lichte dieser Alternative uninteressant. Armut, an der man sich stören, der man deshalb auf den Grund gehen könnte, gibt es nicht – oder, was dasselbe ist, sie zählt nicht. Weil der Automatismus der Verwandlung schlechter Erfahrung in revolutionären Willen nicht vorliegt, den DKP und K-Gruppen immer nicht stören lassen wollten, erfindet der umgekehrte Revi
den Determinismus des notwendigen Dafür-Seins.
2. Handeln politische und ökonomische Subjekte, oder handelt das System? Unverständnis in Bezug auf „Fetisch“ und „Charaktermaske“
Einer Darstellung der Tätigkeit des kapitalistischen Staates, die Auerbach im GegenStandpunkt findet und gleich als Verriß referiert, hält er entgegen: Der Staat – immerhin die politische Gewalt, die der Gesellschaft die Regeln des Wirtschaftens aufzwingt – übe nur Funktionen des Systems aus, die auch dem Staat vorausgesetzt seien. Nimmt man seine Antikritik nur als theoretischen Irrtum, dann zeugt sie von Unverständnis des Verhältnisses von politisch-bewußter Herrschaft und der „Herrschaft des Wertgesetzes“. Auerbach klagt ein verkehrtes Entweder-Oder ein.
„Alles und jedes wird vom Staat Privatpersonen zugeordnet! Der Staat ist das Agens, die zugeordneten Dinge sind das Objekt, und die Privatpersonen, denen zugeordnet wird, sind die Günstlinge. … wodurch das Eigentum in die Welt kommt. … In Wahrheit impliziert das kapitalistische Produktionsverhältnis selbst schon die Verteilung der Menschen auf die verschiedenen Positionen, die es in ihm gibt, womit auch über den Anteil des Einzelnen am Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft entschieden ist. Und umgekehrt kann dieser Reichtum a priori in keiner anderen Form als der des Privateigentums existieren. Diese Form muß nicht erst von außen in die Gesellschaft und das ihr zugeordnete Produktionsverhältnis hineingetragen werden, sondern sie ist Teil ihres Wesens. … Ganz ohne Zutun des Staates sind Besitz und Besitzer einander schon ‚zugeordnet‘. Der Staat verleiht Verhältnissen, die er in der Gesellschaft vorfindet, den Status der Rechtmäßigkeit und sichert sie dadurch ab. … Ohne den Staat läuft die Chose nicht, aber er setzt sie nicht in die Welt.!“ (S.15-17)
Der Autor weiß nicht, daß Wert und Eigentum dasselbe sind: Ausschließende Verfügung über Elemente des materiellen Reichtums. Privateigentum ist das Rechts- also Gewaltverhältnis, das Produkte zu Waren und Wertdingen macht. Wert ist die aus der ausschließlichen Verfügung erwachsende Eigenschaft der Waren, in bestimmter Proportion das Produkt fremder Arbeit verfügbar zu machen. Ohne gewaltsame Zuteilung der ausschließenden Verfügung bzw. den Ausschluß davon würde kein Produkt zu Ware und Wert – und ohne die dauerhafte Kontrolle der Untertanen durch Schutz und Aufrechterhaltung der Rechtsordnung würden sie es nicht lange bleiben. Die Vorstellung, „das Produktionsverhältnis würde selbst schon“ und „ganz ohne Zutun des Staates“ die Verteilung des Reichtums und der Menschen auf die Positionen der Klassengesellschaft vornehmen, der Staat würde erst nachträglich und äußerlich hinzutreten und die fertige Gesellschaft „in den Status der Rechtmäßigkeit versetzen“, tilgt den Gewaltcharakter des Werts. Gegen wen muß die Ordnung überhaupt „gesichert“ werden, wenn das System subjektlos herrscht und seine menschlichen Elemente je schon funktionieren?
Das scheinbar gewaltarme Funktionieren der fertigen Klassengesellschaft, der berühmte „stumme Zwang der Verhältnisse“, auf den Auerbach anspielt, ist Resultat der durchgesetzten und anerkannten Gewalt und ihrer Eigentumsordnung, die die überaus produktive Verwiesenheit der beiden sozialen Charaktere aufeinander ins Leben ruft und aufrechterhält. Von der „ursprünglichen Akkumulation“ hat unser Marx-Kenner doch wohl gehört, die der Staat, der älter ist als der Kapitalismus, mit jeder Menge Gewalt durchsetzte – Vertreibung der Bauern von dem Land, das sie bebaut hatten, politische Zuordnung der Ländereien und übrigen Reichtümer an Eigentümer, durch Steuern eingeführter Zwang, das Leben über Geld abzuwickeln –, ehe der Imperativ des Geldmachens die Form einer vorgegebenen und unpersönlichen Ordnung annahm, in der nur noch Rechtspersonen aufeinandertreffen. Im einst realsozialistischen Osten kann dieser Prozeß heute besichtigt werden: Dort führt der Staat Kapitalismus ein, zerstört jede hergebrachte Form von Arbeit und Leben, um dem neuen Prinzip die alternativlose Geltung erst zu verschaffen, die den fertigen kapitalistischen Staaten den Anschein befriedeter Gesellschaften verleiht. Gewalt ist aber nicht nur bei der Einrichtung der Verhältnisse, sozusagen einmalig, nötig, um einen Selbstlauf des Systems ins Werk zu setzen. Gewalt ist die bleibende Basis der wunderbaren „Sachzwänge“, die nur wirken, wenn die Unantastbarkeit des Eigentums und dadurch der Vorrang der Kapitalinteressen vor anderen Ansprüchen feststeht. Und es bleibt noch nicht einmal bei dieser Sicherung der „Rahmenbedingungen“, dem Schutz von Rechtsordnung und Eigentum. Die Regierung wartet nicht darauf, daß „Marktkräfte“ den Preis der Arbeit kapitalförderlich gestalten, sondern bestimmt im Interesse des Wachstums politisch über gewaltige Lohnbestandteile, die das „historische und moralische Element des Lohnes“ ausmachen, d.h. Lebensstandard und soziale Sicherung, die den Arbeitern von der Nation zugestanden waren. Heute gelten diese Standards als zu hoch für Deutschlands Standortkonkurrenz und werden politisch gesenkt. So „stumm“ ist der Zwang also nicht einmal in den fertig eingerichteten kapitalistischen Nationen!
Umgekehrt. Mit seiner Garantie des Eigentums begründet der Staat das Monopol der Kapitalisten auf den Gebrauch der gesellschaftlichen Arbeitskraft. Damit überantwortet er die nationale Reproduktion den Geschäften und Konjunkturen des Kapitals. Die wird dann selbstverständlich in ihrem Verlauf nicht durch die Wünsche und Vorstellungen der Politiker reguliert, sondern läuft – gesetzlich geschützt – als freie Konkurrenz privat entscheidender Kapitalisten. Und das Wertgesetz, das diese Konkurrenz in letzter Instanz reguliert, hat sich erst recht nie eine Staatsgewalt ausgedacht. Der Staat bezieht sich pragmatisch, aber auch sehr zielbewußt auf die Anarchie der Konkurrenz, die er getrennt von sich institutionliaisert hat: Aus den allgemeinen Bedürfnissen seiner kapitalistischen Gesellschaft leitet er seinen Aufgabenkatalog ab.
Soweit die Richtigstellung des Verhältnisses von staatlicher Gewalt und Wertgesetz. Das Zitat ist aber nicht bloß und nicht einmal hauptsächlich ein theoretischer Irrtum. Fragt man danach, über welchen Gegenstand der Autor spricht und wem er was erklären will, so ist die Antwort: GegenStandpunkt. Er will nichts Neues über die bürgerliche Herrschaft, ihre Aufgaben und Funktionsweise mitteilen – alles, was er darüber weiß, hat er aus dieser Zeitschrift; dem will er in der Sache nichts hinzufügen und davon nichts zurücknehmen. Seine Auskünfte sind Produkt einer rein methodischen Negation; das Gegenbild dessen, was er uns als Fehler vorrechnen will. Überall, wo er eine Tätigkeit – des Staates, der Kapitalisten, Arbeiter, Gewerkschaften – kritisiert findet, entdeckt er „Versubjektivierung“, eine Auflösung ökonomischer Zwänge in den Willen von Menschen. Dieser Sünde setzt er sein Bild des totalen Systemzwangs entgegen, den niemand kritisieren, gegen den sich niemand wehren kann, weil alle Zwecke und Interessen schon vorweg Produkt des vorausgesetzten Systems sind. Unseren Erklärungen dessen, was Politiker, Arbeiter oder Kapitalisten tun, kommt es auf das Was und Warum dieses Tuns an. Diese bestimmten Gründe bezieht Auerbach auf seinen Gegensatz von Systemzwang oder Mutwillen, um immer dort, wo er die von ihm geforderte eintönige Botschaft nicht vernimmt, seinen Vorwurf der Auflösung des vorgeordneten Systems in freien Willen loszuwerden.
„Da der GSP behauptet, daß es kein anderes Mittel für die materiellen Bedürfnisse der arbeitenden Mehrheit gebe denn die Abhängigkeit vom freien Unternehmertum, geht er davon aus, daß diese ein Mittel ist. … Warum soll ausgerechnet die Abhängigkeit, derentwegen man seine Bedürfnisse nicht befriedigen kann, ein Mittel ihrer Saturierung sein? … Der GSP stellt auch das Geld als Mittel dar, dessen sich die Privateigentümer bedienen, um ihren Reichtum zu vermehren. Das Privateigentum schlüpft in die Maske des Geldes. Marx dagegen führt aus, daß das in verschiedenen Aggregatzuständen existierende Kapital eine Wert-Größe darstellt, die sich im Geld als dem universellen Wert ausdrückt. Die Verwertung des Wertes und damit die Vermehrung des Geldes sind Selbstzweck!“ (S.126 und 142)
Es ist schwer, unsere Artikel in solchen Zitaten wiederzuerkennen. Auerbach verfälscht die Stellen, um die Sünde deutlich zu machen, die er geißeln will: Daß die Abhängigkeit der Arbeiter vom Unternehmer ihr Mittel sei, wird er im GegenStandpunkt kaum gefunden haben: Arbeit für Geld ist das Lebensmittel der Arbeiter; die Abhängigkeit vom entgegenstehenden Interesse jedoch ist das Problem dieser Erwerbsquelle; daß die Leute diesen Erwerb brauchen, weil sie keinen anderen haben, wird er bei uns finden; daß er Mittel der Saturierung, also der vollständigen Befriedigung ist, muß er hinzuerfinden, damit aus dem Widerspruch der Lohnarbeit ein Widerspruch wird, von dem er loswerden will, daß es so etwas nicht geben kann. Von Mitteln, die nichts taugen, hat er wohl noch nie gehört. Und davon, daß man sie kritisieren und abschaffen kann, weil sie nichts taugen, auch nicht. Alle Berechnung und Aktivität, durch die die Leute sich zur „abhängigen Variablen der Akkumulation“ machen, läßt bei Auerbach die Alarmglocke klingeln: Da wird von Subjekten geredet, dabei herrscht doch der Wert. Dito beim Thema Geld: Es geht dem Autor um die Entgegensetzung von Geld als Mittel der Geldbesitzer und Geld bzw. Kapital als Selbstzweck. Es interessiert ihn nicht, daß Geld nun einmal der Stoff des Privateigentums ist, daß Eigentümer es zum Kaufen und Investieren benutzen. Er läßt Marx sein interessantes „Dagegen“ aussprechen. Alles was die Leute tun und wodurch sie die Vermehrung des Werts zum Selbstzweck machen, wird als Versündigung gegen dieses Resultat zurückgewiesen. „Selbstzweck“ als wesentliches Prädikat der Wirtschaftsweise verliert dann aber auch allen erklärenden und kritischen Gehalt: Man möchte nämlich schon gerne wissen, bei welcher Beschäftigung die Menschen, die sie verrichten, welche Zwecke auf eine Weise verfolgen, daß sie ihre Ziele nicht erreichen, d.h. von ihrer Arbeit nichts haben, sondern sich einer ökonomischen Zielsetzung unterordnen, die niemands Zweck ist. Auerbach zeichnet ein Bild vom Menschen, der sich dem „System“ ohne Täuschung und ohne Berechnung unterordnet, weil er gar nicht anders kann.
Diese Schablone vor die kapitalistische Realität gehalten, ergibt auch ein Bild: Bürgerliche Herrschaft gibt es nicht, eine herrschende Klasse auch nicht; ihr gegenüber stehen keine geschädigten Subjekte mehr; alle Menschen im System üben unvermeidliche Systemfunktionen aus. Alle sind unter diesem merkwürdigen Verhängnis zugleich Objekte einer Herrschaft, die keiner ausübt, und Agenten dieser Herrschaft über sich: Als Charaktermasken des Kapitalverhältnisses, die vorgegebene Rollen spielen, werden Kapitalist und Arbeiter gleich. Armut ist kein Grund zur Kritik, der Reiche ist ja auch nicht frei! Die Klassen stehen in keinem Gegensatz mehr, sondern bilden zusammen das Kollektiv der uneigentlichen Subjekte:
„Die Ziele, die die Menschen als Arbeiter, als Kapitalist verfolgen, scheinen ihnen ihre ureigenen zu sein. In Wirklichkeit aber exekutieren sie Zwecke, die außerhalb von ihnen liegen. … Beider (des Kapitalisten und des Arbeiters) Existenz und beider Wollen, Können und Müssen leiten sich ab aus einem beiden vorausgesetzten Ganzen – dem kapitalistischen Produktionsverhältnis und dem Verwertungsprozeß des Kapitals. … Der Klasse der Kapitalbesitzer stehen eben keine ‚nackten‘ Menschen gegenüber, sondern Individuen, die aufgrund der bestehenden ökonomischen Verhältnisse als Lohnabhängige ihr Leben bestreiten. Diese Menschen sind mit einem Bewußtsein und einer psychischen Ausstattung ausgestattet, die zu den äußeren Lebensbedingungen passen wie der Schlüssel ins Schloß!“ (S.41-43. Nahezu identisch Robert Kurz, Subjektlose Herrschaft, in: Krisis 13, S.30.)
Wenn Leute Zwecke für die ihren halten, dann sind sie es auch. Denn mehr ist dafür, daß ein Inhalt einem Menschen Zweck wird, nicht verlangt, als daß er ihn will. Handelt es sich vielleicht um Zwecke, die sie sich nicht zu eigen machen sollten? Tun die Resultate dieser Zweckverfolgung den Leuten nicht gut, so daß sie Gründe hätten, sie fallen zu lassen? Von all dem ist nicht die Rede. Ihre Zwecke sollen den Menschen fremd sein, weil sie sich aus einem vorausgesetzten Ganzen ableiten. Das System bestimmt sie, aber sie merken es nicht, weil sie vom System ja ganz bestimmt, psychisch und bewußtseinsmäßig voll an es angepaßt sind. Das Rätsel dieser paradoxen Stellungnahme liegt weniger in der Frage, wie Menschen fremde Zwecke irrtümlich mit eigenen verwechseln können, als vielmehr darin, woher der Autor die Gewißheit beziehen will, daß Zwecke, die so vollständig zu denen passen, die sie betätigen – Schlüssel und Schloß! –, ihnen fremde, sie unterordnende sein sollen. Die ganze Grausamkeit des Kapitalismus reduziert sich darauf, daß das System schon vor den Leuten da ist. Das Bild vom total integrierten Systemelement will nichts mehr wissen davon, ob die Leute in diesem System gut fahren; es ist nicht einmal mehr eine falsche Darstellung ihrer Unterordnung, sondern gar keine Bestimmung dessen, was im Kopf kapitalistischer Menschen vor sich geht. Die transzendentale Unfreiheit, die kein Mensch bekämpfen kann, aber auch nicht zu bekämpfen braucht, weil er sie nicht merkt, ist nur noch geeignet, die Größe des Individuums, das an so einer Unfreiheit zu leiden vermag, und seinen wahrhaft unstillbaren Freiheitsdrang auszudrücken.
Mit den Charaktermasken des Kapitals
, von denen Marx verschiedentlich spricht, haben diese konstruierten Funktionselemente des Systems nichts zu tun. Bei Marx sind die Menschen nämlich nicht durch einen bösen Zauber des Systems oder durch Prägung Charaktermasken, sie machen sich zu Trägern der diversen Kapitalfunktionen, und zwar dadurch, daß sie sich berechnend auf die jeweils vorgefundenen ökonomischen Erwerbsquellen beziehen, um sie zu nutzen. Wer Vermögen besitzt, macht sich zur Verkörperung des Kapitals, wenn er Arbeiter anstellt und sie mit Gewinn verkaufbare Ware herstellen läßt. Dann betätigt er gegen seine Arbeitskräfte den Zweck und die Gesetze des Kapitals als seine Sache, gibt ihnen eine leibhaftige Gestalt. Daß er eine objektive ökonomische Kategorie verkörpert, deren Bestimmungen nicht aus seinen Ansichten und Absichten herrührt, merkt der Kapitalist daran, daß er die Gesetze des Kapitals auch gegen sich zu spüren kriegt – und zwar von seiten seiner Konkurrenten. Was er mit seinem Vermögen anstellt, das tun viele, und sie machen sich wechselseitig den Markt streitig. Um sich mit dem eigenen Angebot zu behaupten, muß der Kapitalist die Preise seiner Waren senken. Um bei fallenden Preisen zu bestehen, muß er „rationalisieren“, d.h. die Produktivkraft steigern, bessere maschinelle Ausstattung anschaffen und dafür die erzielten Gewinne immer von neuem reinvestieren. Die Akkumulation wird so zu einem Zwang, dem er bei Strafe des Untergangs gehorchen muß. Durch ihre allgemein und gegeneinander betriebene Bereicherung, d.h. durch ihre Konkurrenz, machen die Kapitalisten ihre Absicht zu einem Gesetz gegen sich und zwingen sich wechselseitig Bestimmungen des Kapitals auf, die in ihren Absichten nicht aufgehen. Der gegen jedes, und sei es noch so luxuriöse, Bedürfnis rücksichtslose Akkumulationstrieb ist kein subjektives Motiv. Auch ein Kapitalist ist nicht Dagobert Duck, dessen Genuß im Fühlen des abstrakten Reichtum selbst und im Nachzählen seines Zuwachses besteht.
Die Kapitalismustheorie von Auerbach und ebenso von Kurz besteht aus etwa fünf Metaphern, die sich bei Marx finden. Daß sich der Selbstzweck
des automatischen Subjekts
hinter dem Rücken der Beteiligten abspielt
, die deshalb Charaktermasken
sind, ist ihre ganze Mitteilung. Der Fetisch
oder noch schöner: die Fetisch-Konstitution der Gesellschaft
ist ihr Gegenstand. Sie nehmen die kritischen Attribute, die Marx Wert, Geld und Kapital gibt, für die Sache selber, vergessen die Ökonomie und machen den Fetisch, das automatische Subjekt, zum Schöpfer einer ganzen Welt von Marionetten. Zur Abgrenzung noch ein Wort zum Fetisch bei Marx. Der alte Autor macht hier einen polemischen Vergleich: Im Kapitalismus erlauben die Menschen, daß Geldzettel oder einen Stück Naturstoff – Gold – Macht über sie ausübt. Sie verhalten sich zum Geld wie die Wilden zu ihrem Fetisch, einem selbstgeschnitzten Götterbild, das seinem Inhaber Macht über andere verleiht. Dieser Vergleich ist eine Kritik, nicht aber der Begriff des Geldes! Damit die Modernen vor dem Geld in die Knie gehen, braucht es – um noch einmal daran zu erinnern – die Staatsgewalt. Ohne daß diese dem „Ding“ den nötigen Respekt verschafft, übt es keine Macht über Menschen aus. So weit geht Marx’ Vergleich mit den Wilden denn doch nicht.
3. Wenn Charaktermasken denken – um so schlimmer! Wie man vom „notwendig falschen Bewußtsein“ ein Wort nach dem anderen durchstreicht.
Die „gesellschaftlichen Beziehungen der Sachen“, die Macht, die das Geld dem verschafft, der es hat, ist ein Faktum und kein Fall von Ideologie oder falschem Bewußtsein. Es lohnt sich, dies ausdrücklich festzustellen, denn die erwähnten Autoren verwechseln beides nach Kräften. Der Zwang der Verhältnisse und das falsche Bewußtsein derer, die sich zu ihrem Schaden damit arrangieren, wird von ihnen vorwärts und rückwärts identifiziert – im Interesse ihres Befundes, daß die Menschen zu den falschen Verhältnissen passen wie ein Schlüssel zum Schloß. Einerseits gilt ihnen das Bewußtsein als eine passive Folie, auf der sich das System mit seinen Funktionsimperativen einprägt und eine „psychische Ausstattung“ hinterläßt, deren einzige Bestimmung Angepaßtheit ist. Verstand und Wille bekommen die Eigenschaften eines Apparats, der Verhaltensweisen produziert. Der Befund totaler Angepaßtheit läßt keinen Raum für richtige oder falsche Gedanken. Nach dieser Seite vollenden die Fetischkritiker den alten Fehler des „dialektisch materialistischen“ Dogmas, das Sein bestimme das Bewußtsein – als ob das Objekt der Erkenntnis es vermöchte, Gedanken über es zu determinieren. Sie selbst sind das Gegenbeispiel. Was anderen wegen wertförmiger Vergesellschaftung unmöglich sein soll, muß den Kritikern irgendwie gelungen sein: das Verhängnis zu durchschauen. Andererseits werden – schön zirkulär – dann wieder die fetischistischen Interessen und Einstellungen der Charaktermasken zum Grund der gesellschaftlichen Objektivität erklärt. Weil das Geld ihnen als allgemeines Aneignungs- und Verfügungsmittel gilt
, meint der Autor des Leserbriefs, würde es dazu. Das Geld gilt den Leuten aber nicht als Mittel des Zugriffs auf Gebrauchsgüter, es ist dieses Mittel. Unter dem negativen Systemgedanken – „totale Integration ist das Grauen“ (Adorno) – werden die entgegengesetzten falschen Determinationen identisch: die Determination des Bewußtseins durch das Sein und die Entstehung der Objektivität aus dem falschen Meinen und Wollen.
Das „notwendig falsche Bewußtsein“ im Kapitalismus ist etwas vom Determinationsgedanken Grundverschiedenes. Zunächst ist es einiges nicht, was die besprochenen Autoren damit vermischen. Erstens sind die Menschen im Kapitalismus alternativlos auf die ökonomischen Einrichtungen verwiesen, die es gibt. Sie müssen sich – gleichgültig, was sie denken – des Geldes bedienen, um an die Dinge des Bedarfs heranzukommen. Sie müssen – gleichgültig, was sie von der Ausbeutung halten – sehen, wie sie ihre Arbeitsbereitschaft zu Geld machen. Zweitens müssen sie sich deshalb das Geldverdienen zum Interesse machen, sich um eine Qualifikation, eine Arbeitsstelle kümmern, sehen, wie sich das Einkommen steigern läßt. Schlimm genug, daß auch dies erst einmal nötig ist. Leider wird drittens auch das Denken den praktischen Notwendigkeiten angepaßt – und dann wird es falsch: Der kalkulatorische Umgang mit Arbeit, Geld, Kapital, zu dem man genötigt ist, wird für die Bestimmung dieser Sachen genommen. Dann halten die Leute die ökonomischen Einrichtungen, auf die sie sich als Mittel einlassen müssen, für genau die Mittel, deren Bestimmung der Nutzen ist, den sie brauchen. Dieser Schritt ist nur in praktischer, nicht in theoretischer Hinsicht notwendig: Es steht dem Menschen jederzeit frei, sich zu erklären, woran sein Scheitern liegt, wenn er bei der Benutzung der vorgegebenen Mittel nicht weit kommt. Wer aber trotz schlechter Erfahrung mit ihnen zurechtkommen will, richtet sein Denken so ein, wie er zu handeln gezwungen ist, und entwickelt einen Dogmatismus der Nützlichkeit: Er stellt nicht mehr nüchtern fest, daß er sich Arbeit suchen muß, sondern hält den Arbeitsmarkt für eine Chance und den Gewinn für eine positive Bedingung nicht nur für die Investition, sondern auch für seinen Arbeitsplatz und Lohn. Das ist verkehrt: Gewinn wird nicht gemacht, um Lohn und Arbeitsplatz zu ermöglichen; sie sind noch nicht einmal Nebenwirkungen der Gewinne, auf die man sich verlassen könnte. Das für konstruktives Mitmachen erforderliche Bewußtsein hegt Illusionen über Funktionsweisen und Zwecke der kapitalistischen Einrichtungen – und es wird oft genug auf die Unwahrheit der eigenen Sicht gestoßen. Die Enttäuschung dessen, was man sich ausgerechnet und worauf man sich ein Recht zugemessen hatte, ist tägliche Erfahrung und das Fertigwerden mit Enttäuschungen die geistige Hauptarbeit. Zusatzanstrengungen sind nötig, um den Willen zum Mitmachen und den Schein der Vernunft dabei aufrechtzuerhalten. Wenn das falsche Bewußtsein dessen innewird, daß es illusorisch ist, hält es an seinem guten Glauben gegen die Erfahrung in der Form des „eigentlich“ fest: Eigentlich gehört die Fabrik doch allen, die sie aufgebaut haben und als Erwerbsquelle brauchen, eigentlich müßten Lohn und Leistung zusammenpassen und nicht, wie so oft, skandalös voneinander abweichen. Der praktische Zwang, sich weiter um einen Arbeitsplatz etc. kümmern zu müssen, und der falsche Schein von Vernunft stützen sich wechselseitig: Die falsche Theorie gibt dem erzwungenen Handeln recht, und der Wille zum Weitermachen gibt dem Denken den Leitfaden vor und ertränkt Zweifel. Das „notwendig falsche Bewußtsein“ ist also keine passive „Widerspiegelung“ eines sonstwo existierenden Selbstzwecks – und schon gleich keine gegebene psychische Ausstattung, sondern eine recht verbissene Aktivität.
Das falsche Bewußtsein und seine Kritik sind bei Kurz und Auerbach kein Thema, weil sie die in den Verhältnissen befangenen Leute ganz und gar in ihren Rollen aufgehen lassen. Eine Nötigung kennen sie ebensowenig wie das Verhältnis von subjektivem Zweck und den dazu nicht passenden ökonomischen Mitteln, an dem sich die Leute abarbeiten. Dadurch wird das Notwendig
des falschen Bewußtseins so absolut gesetzt, daß nichts Falsches mehr übrig bleibt: Die Träger der „durch den Wert konstituierten Rollen“ haben kein richtiges oder falsches Bewußtsein, sondern eine funktional angemessene psychische Ausstattung, wenn überhaupt. Auerbach geht nämlich noch einen Schritt weiter und nimmt sein Wahngebilde von der Entsubjektivierung so ernst, daß er die Welt des Werts wahrhaftig mit handelnden Masken bevölkert, die eigentlich gar kein Bewußtsein haben:
„Können überhaupt Arbeiter scheitern? Nein, da Arbeiter zu sein eine dem Menschen äußerliche Bestimmung ist! Ökonomische Masken können sich keine Ziele setzen und folglich auch nicht scheitern. Sofern aber Individuen wissentlich mit Arbeiter-Interessen in den Ring steigen, verfolgen sie a priori falsche Zwecke! … Statt der Destruktion des falschen Bewußtseins von Arbeitern müßte man sich die Zerstörung ihres Bewußtseins vornehmen. Wenn Arbeiter ein Bewußtsein haben, ist alles zu spät! Denn die ökonomische Existenzweise kann nicht über solch ein Ding verfügen, sondern nur jemand, der Arbeiter sein will.“ (Auerbach, S. 134 und 182f.)
Würden es die Menschen doch dabei belassen, die Masken zu sein, die dieser Marx-Kenner ihnen zugeschrieben hat. Daß sie, wie auch Auerbach bemerkt, doch ein Bewußtsein haben, macht die Sache nur schlimmer! Sie wollen die Masken sein, die sie sind! Sie bekennen sich zum Begriff der Ware Arbeitskraft. Als ob sie den wüßten! Und als ob sie ihre Rolle billigen würden, wenn sie wie Marxisten darüber dächten! Das Falsche, das er den Leuten nachsagt, läßt er schon bei dem Bemühen beginnen, sich in der Geldwirtschaft zu ernähren. Falsch ist da keine Meinung über Lohnarbeit und Kapital, falsch ist der Wille – und eine Täuschung über sein Instrument ist kein Thema mehr, wenn das Verwerfliche schon der Zweck ist. Im falschen Zweck, Geld zu verdienen, ist das passive Produkt der Verhältnisse voll identisch mit ihnen, ja ihr Protagonist: Man müßte das Bewußtsein der Menschen zerstören, wollte man sie von ihrer Parteinahme für ihre Ausbeutung abbringen!
Die Wert-Kritiker der „Krisis“-Redaktion drücken diesen Gedanken weniger blutrünstig aus. Sie machen daraus eine ganze Philosophie vom modernen Menschen als ein sich selbst, d.h. seine höhere Bestimmung verfehlendes Wesen: „Fetisch-Konstitution und Subjektivität“ nennen sie das. Ausgangspunkt ist auch bei ihnen der Entschluß, Vorteilsrechnungen, die Lohnarbeiter wegen und mit ihrer Abhängigkeit anstellen, gleich gar nicht als irrige Rechnungen, sondern als Fälle von Unzurechnungsfähigkeit aufzufassen:
„Menschen, die nicht mehr nach Bedürfnisbefriedigung, sondern nur noch nach ‚Arbeitsplätzen‘ schreien, muß eine Art von Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt werden, die ihren sogenannten Eigennutzen als bloßen Vollzug eines säkularisierten religiösen Prinzips denunziert. … (Es geht darum,) den Skandal der völligen Bewußtlosigkeit auf der Ebene gesellschaftlicher Formbestimmungen zu erkennen. … Der Mensch entsteht als Subjekt gegenüber der ersten Natur, weiß aber notwendigerweise selber nicht, wer er ist, weiß und hat sich nicht bewußt als das, was er geworden ist, nämlich gesellschaftliches Wesen.“ (Kurz, Subjektlose Herrschaft, S.19, 30, 52)
Wer den Leuten Bewußtlosigkeit attestiert, ist weit hinaus über die Frage, worin sie sich täuschen. Der Gesellschaftskritiker richtet sich auch nicht mehr an die Leute, über deren Bewußtlosigkeit er sich ausläßt. Wie ein Psychiater unter Kollegen definiert er für sein Publikum die Bezirke der Unbewußtheit dritter – und was für welche! Der heutige Mensch weiß nicht, wer er ist! Und wer ist er unbekannterweise? Ein gesellschaftliches Wesen! Diesen billigen Soziologen-Spruch, den vor Gericht noch jeder Taschendieb zu seiner Entschuldigung vorbringen kann, sollen die Leute angeblich nicht wissen. Dies nicht zu wissen, macht den einzigen Fehler, das Fetischistische ihres Bewußtsein aus: Sie bekommen den Ehrentitel des eigentlichen Subjekts abgesprochen. Formblinde Massenmenschen gehen ihren Angelegenheiten nach und bedenken gar nicht, daß ihr „Subjektsein“ gesellschaftlich produziert ist. Wenn sie sich sonst über nichts täuschen …
„Das Subjekt der Moderne ist sich ebensowenig wie alle früheren Gestalten des Subjekts seiner eigenen Form bewußt: Es repräsentiert sozusagen die höchste Form der Form-Bewußtlosigkeit. Damit läßt sich die allgemeine Bestimmung angeben: Ein Subjekt ist ein bewußter Aktor, der sich seiner eigenen Form nicht bewußt ist. Genau diese Form-Bewußtlosigkeit aber ist es, die den bewußten Handlungen … gegenüber den anderen Subjekten einen unsichtbaren objektiven Zwangscharakter auferlegt. … Ein Subjekt ist ein Aktor, der strukurell männlich bestimmt ist. In diesem Bezug werden Natur und andere Subjekte zu Objekten herabgesetzt, aber eben nicht aus der Willens-Subjektivität des erscheinenden Ich-Bewußtseins heraus, sondern aus der Bewußtlosigkeit der eigenen Form. … Das Unbewußte als allgemeine Bewußtseinsform, allgemeine Subjektform und allgemeine Reproduktionsform der Gesellschaft objektiviert sich in Gestalt gesellschaftlicher Kategorien (Ware, Geld) ausnahmslos allen Gesellschaftsmitgliedern gegenüber, ist aber gleichzeitig gerade deshalb die bewußtlose Einheit der Subjekte selbst. … Die Revolution gegen die Fetisch-Konstitution ist identisch mit der Aufhebung des Subjekts.“ (S.68, 69, 75, 77, 94)
Wir dachten zwar, daß nach Adorno ein kritisches Interpretieren des Kapitalismus nicht mehr möglich ist; aber offenbar ist das Bedürfnis, vom „Subjekt der Moderne“ zu schwadronieren, einfach nicht totzukriegen. Nur ein wenig hölzerner und noch unverständlicher als bei dessen Schöpfer kommt hier die Vorstellung daher, daß es im total falschen „Verblendungszusammenhang“ kein wahres Ich gibt – nicht erstaunlich angesichts des den Einfall leitenden Bemühens, dem so einfach gestrickten und so billig zu befriedigenden moralischen Drangsal, sich mit seiner Welt eins und sich in ihr heimisch zu fühlen, sein notorisches Scheitern als „allgemeine Bestimmung“ anzuhängen. So kommt das „Subjekt“ aus der philosophischen Werkstatt ziemlich fremd heraus: Wenn es tut und macht, was es will, geht bei allem recht uneigentlich es selbst zur Sache; es ist „bewußtlos“, weil nämlich in den Sachen, mit denen es verfährt, gar nicht es selbst steckt, sondern das vielmehr seine „Objekte“ sind, ihm also äußerlich – und fertig ist der Skandal, und die „bewußten Handlungen“ sind ihren „Objekten“ gegenüber eine einzige Nötigung. Objektiv, versteht sich, denn so einfach lassen sich Subjekte, die bewußtlos bewußt handeln, auch nicht moralisch zur Raison bringen. Daher werden sie erstmal zum „Aktor“ umgetauft, auf den dann die passenden moralischen Vergehen das schlechte Licht werfen, in dem sich die ganze philosophische Kritik bündelt: „Natur“ ist der erste hohe Wert, an dem sich vergriffen wird, der Mitmensch, die „anderen Subjekte“, der Nächste, und schließlich ist der „Aktor“ auch noch „männlich“, womit der Kritiker auch noch seinen Tribut an den Wert „Frau“ entrichtet hätte. „Ware, Geld“ – in Klammern – machen dann deutlich, daß mit diesem moralischen Verhängnis allen Ernstes der Kapitalismus gemeint sein soll, und weisen auch schon darauf hin, wie der auf philosophisch abzuschaffen geht: Kampf dem Vergreifen an den Objekten! Nieder mit dem Haben-Wollen!
Die Predigt gegen jeden Zweck und jedes Mittel, einmal aufs Maß des gesunden Menschenverstands hinuntergerechnet, verwirft nicht den mißratenen und darin giftigen bürgerlichen Materialismus, sondern den Materialismus schlechthin – und das im Namen der Moral des Kapitalismus. Sie will in Fragen der Behandlung des Menschen nicht unterscheiden, worauf es einzig und allein ankommt, nämlich ob es ihnen gut oder schlecht bekommt – Objekt eines gescheiten Versorgungswesens, von Zuwendung oder Begierde ganz zu schweigen, ist der Mensch ja durchaus gerne, Objekt von Gewalt und Ausbeutung dagegen weniger. Diese einzig rationale Unterscheidung wird ersetzt ausgerechnet durch den blöden Vorbehalt gegenüber jeglicher Benutzung von Menschen, den der Kapitalismus in der Tat respektiert: Als Person anerkannt zu werden, darauf hat der Mensch noch inmitten seiner schlechtesten Behandlung ein unveräußerliches Recht. Man könnte Kurz ja sogar das – gar nicht geheime – Geheimnis verraten, daß die laute und freudige Begrüßung der Menschen als Subjekte unveräußerlicher Menschenrechte immer nur der Auftakt dazu ist, es bei der Rücksicht auf ihr materielles Wohlergehen nicht so genau zu nehmen – und auch zu gar nichts anderem taugt. Jedenfalls hat es keines Marx-Exegeten zur Verkündung des gar nicht neuen Imperativs bedurft: „Gebrauche andere Menschen niemals nur als Mittel, sondern stets auch als Zweck in ihnen selbst!“ Dieser Appell stammt vom alten Kant, und der führt eine schlechte alte Tradition fort. Seit Jesus Christus wollen alle Moralapostel den neuen Menschen schaffen, der sich zu seinen egoistischen Interessen ein schlechtes Gewissen macht. Kurz’ Unterschied zu diversen Bußpredigern besteht nur darin, daß man ihn garantiert nicht versteht. Aber das ist auch gar nicht nötig. Die Unmoral, die er geißelt, ist ein notwendiges Produkt der Fetisch-Konstitution und kein vermeidbarer Fehltritt der „Willens-Subjektivität“ – als zu beherzigender Vorwurf ist die totale Verurteilung der kapitalistischen Menschen nicht gemeint. Fetisch-Produkte, die sie sind, könnten sie damit ohnehin nichts anfangen. Sie haben keinen Grund, ihre „Willens-Subjektivität“ suspekt zu finden – sie sind einfach so! Die menschlichen Bestandteile dieser „Fetisch-Konstitution“ sind ihrem besseren Menschsein so gründlich entfremdet, daß sie in den entfremdeten Verhältnissen vollkommen zu Hause sind.
Von diesem Standpunkt aus besehen erscheint so manches in anderem Licht: Die Leute wollen Geld verdienen, also sind sie Geldgeier, wie die Kapitalisten, nur schlechtere.
„Der Zankapfel heißt ‚Geld‘! Die eine Seite möchte mehr Geld machen, die andere Seite will es nur für mehr Geld tun. Von solchem Zwist sollte man sich, so man unerbittlicher Fundamentalkritiker der Verhältnisse zu sein beliebt, fernhalten. Denn: Pecunia olet! Erst wenn die Mehrheit die Nase rümpft und von Arbeitgebern ausgegebene Dukaten als Eselsäpfel betrachtet, ist an die Aufhebung der bestehenden Verhältnisse zu denken.“ (Auerbach, S. 132)
„Es ist für den verstockten alten Linksradikalismus einfach nicht nachvollziehbar, daß der Klassenkampf seinem Begriff nach in der bürgerlichen Formhülle verbleiben muß. Denn auch die Ware Arbeitskraft ist eine Ware, in deren Begriff die ‚Privatheit‘ enthalten ist. Das bedeutet nichts anderes als daß auch die ‚Arbeiterklasse‘ in der Form des Geldlohns ‚privat aneignet‘. … Jeder, der ‚sein Geld verdient‘, muß immer schon alltagspraktisch mitmachen, und dieses Mitmachen endet genau dort, wo das Geldverdienen aufhört.“ (Kurz, Die letzten Gefechte, Krisis 18, S.44, 48)
Nicht ein Irrtum über ihre untauglichen ökonomischen Mittel, sondern ihr Materialismus kettet sie an das System. Der Vernunft zugänglich wären sie nur, sofern sie ihre materiellen Interessen verachten würden. Vom System bleibt seinerseits nichts Kritikwürdiges stehen – außer eben, daß es diese totale Integration seiner Elemente ist: Die Unvernunft der gesellschaftlichen Verhältnisse besteht in dieser Integration, ja Konstitution ihres Menschenmaterials, sie wandern derart in ihre menschlichen Elemente ein, daß nur noch an denen, an deren schlechtem Charakter, an ihrer Raffgier und ihrem „Haben-Wollen“ die Kritik der Gesellschaft zu führen geht – für einen „unerbittlichen Fundamentalkritiker“ jedenfalls.
Anders als Auerbach verspricht sich Kurz die Befreiung der Menschen nicht von der Zerstörung ihres unkorrigierbaren Bewußtseins, sondern von der Selbstzerstörung des Selbstzweck-Systems, an das sie so unbedingt angepaßt sind. Kurz wendet sich nicht an diese, will ihnen nicht die Anpassung an die lebhaft verurteilte Unvernunft ausreden – den entfremdeten Subjekten ist der Wahnsinn ja Heimat. Er setzt darauf, daß ihre Anpassung bei aller Anstrengung scheitern wird, wenn wegbricht, woran die Leute angepaßt sind: Der finalen Krise des Kapitalismus ist die Rolle des Aufklärers – richtiger: des Zerstörers der Angepaßtheit zugewiesen. Der Aufgabe, diese Endkrise von Jahr zu Jahr aktualisiert anzusagen, widmet Kurz die andere Hälfte seiner Veröffentlichungen.[2]
„Wie es scheint, werden nun die nicht mehr hinausschiebbaren historischen Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise erreicht. Die Zwickel-Gewerkschaften haben sich offenbar entschlossen, lieber zusammen mit dem Kapitalismus aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen als eine neue, andere Systemalternative zu entwickeln und soziale Gegenwehr zu leisten. Die Politik der ‚radikalen Anpassung‘ ist naiv, weil es sich nur um die Anpassung an den Untergang des Systems der Lohnarbeit selber handeln kann. Dieser Untergang wird auch dann ratifiziert, wenn ihn die gesellschaftlichen Institutionen nicht wahrhaben wollen.“ (Kurz, Die letzten Gefechte, S. 42)
Kurz verwahrt sich dagegen, daß seine Absage an den Klassenkampf als unpolitische Sinnstiftung für Ex-Linke aufgefaßt wird. Dieser Zirkus von Subjekt, Objekt und Form-Bewußtlosigkeit will allen Ernstes als Revolutionstheorie verstanden werden. Im Scheitern der Anpassung durch den Untergang dessen, woran sich angepaßt wird, sieht Kurz die Vernunft aufscheinen. Das Riesenwerk – Der zweite Mensch kann im Gegensatz zum ersten nicht ‚entstehen‘, er muß sich selbst bewußt schaffen.
– erscheint ungeheuerlich und fast unlösbar
(Subjektlose Herrschaft S. 82f). Denn „was bisher dem blinden Regelmechanismus folgte, muß in das bewußte Bewußtsein der Menschen, in die Selbst-Bewußtheit überführt werden.“. Das kaum Denkbare kann jedoch denkbar einfach ins Werk gesetzt werden – durch Verweigerung gegenüber dem Geldverdienen: Ein bißchen nachbarschaftliches Netzwerk, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich verbunden mit einem Einstieg in kommunale und soziale Tätigkeiten jenseits des Erwerbs schaffen lauter Inseln der Vernunft im Meer des Falschen. Kurz hält alles dies für einen ganz guten Anfang. So gesehen ist die Selbstbefreiung gar nicht so schwierig. Die großen Kirchen bieten Starthilfen. Wenn Philosophen halt praktisch werden …
II. Trampert und Ebermann: Argumente für die Sichtbarkeit des Kapitalismus und der Unarten seiner herrschenden Klasse
Schon im Titel „Die Offenbarung der Propheten“ stellen Trampert und Ebermann ihr Buch als einen „Anti-Kurz“ vor. Ihre Absage an Zusammenbruchshoffnungen und ihr Beharren darauf, daß entweder seine Opfer den Kapitalismus abschaffen, wenn sie ihn nicht mehr für nötig halten, oder keiner, ist sympathisch; ebenso ihre Zurückweisung der Manie, dem Kapitalismus immer neue Stadien nachzusagen. Für die beiden ist der Kapitalismus im wesentlichen immer derselbe geblieben. Da haben sie recht.
Nicht so erfreulich ist die Art und Weise, wie sie Kurz’ Ansichten verwerfen. Sie haben sich auf die abstrakte Negation von all dem verlegt, was dieser vertritt. Die beiden kritisieren nicht dessen Gedanken, sie rücken nicht die Deutungen zurecht, die dieser den in Betracht gezogenen Krisenphänomenen gibt, sondern behaupten jeweils genau das Gegenteil von dem, was bei Kurz steht. Als ob ihre Opposition zu seiner Philosophie die Wahrheit über die Sache wäre. Sie und ihr Gegner ergänzen sich geradezu in konträren Einseitigkeiten.
1. Zitate aus der Wirklichkeit zur Widerlegung des Philosophen Kurz
Kurz sagt, der Kapitalismus befinde sich in seiner finalen Krise und werde tendenziell ausbeutungsunfähig. Die Hamburger bescheinigen dem System beste Gesundheit, wenigstens im Weltmaßstab. Kurz stellt fest, daß aus dem wirtschaftlichen Zuwachs, den sich die BRD von der Annexion der DDR versprochen hatte, wohl nichts geworden sei, und sieht darin wieder ein Indiz für das nahe Ende des Westens. Die Hamburger halten voll dagegen: Nie seien die Bedingungen für das deutsche Kapital so günstig gewesen wie seit dem Sieg über den Ostblock. Kurz spricht von einer für das produktive Kapital nicht mehr funktionalen Akkumulation von Finanztiteln, die sich aus Mangel an produktiver Anlage im Finanzsektor selbst herumtreiben und nach seinen Regeln vermehren, ohne daß der materielle Reichtum, auf den sie Anspruchstitel sind, entsprechend oder auch nur überhaupt wachsen würde. Ebermann und Trampert wissen dagegen aus dem statistischen Jahrbuch der Bundesregierung zu berichten, daß das meiste Geld nach wie vor in der Produktion verdient werde. Es kümmert sie nicht, daß den Ziffern des Bruttosozialprodukts ihre ökonomische Herkunft nicht mehr anzusehen ist, daß dort also Einkünfte ohne Rücksicht darauf zusammengezählt werden, ob sie aus einer Vermehrung des kapitalistischen Reichtums oder aus der Abwicklung unproduktiver Funktionen resultieren. Beim Thema des „fiktiven Kapitals“ lassen sich die beiden von Kurz’ wolkigem Metaphernunwesen dazu verleiten, diese Form des Kapitals eventuell für reine Einbildung zu halten, um diese alberne Vermutung dann zu dementieren:
„Ein gewaltiger, nicht ausrechenbarer Anteil des voluminösen Geldkapitals ist grundsätzlich keineswegs fiktiv, sondern Ausfluß der realen Kapitalakkumulation.“ (S.70)
Das ist nicht einmal eine falsche Bestimmung dessen, was fiktives Kapital ist, sondern gar keine. Das Erklären ist eben nicht die Sache der beiden. Ihre Mitteilung erschöpft sich im Dementi der Krisenphänomene, die Kurz zu seinem Katastrophengemälde zusammenfügt – als ob der aus ihnen gefolgerte Zusammenbruch des „Fetischsystems“ wirklich folgen würde, wenn man die Phänomene gelten ließe. Überakkumulation, die Phase der Depression, in der kein Wachstum zustandekommt, die prekäre Lage des Geld- und Schuldenwesens, dem der materielle Reichtum geopfert wird – Maastricht-Deflation in Europa, „balanced budget“ in den USA, „Absturz Ost“, Standortkonkurrenz: Soll es das alles nicht oder fast nicht geben, damit nicht folgt, was Kurz daraus folgen läßt? Sein Fehler besteht in der Umdeutung der Krise zur „Aufhebungsschwelle des Systems“; das ist verkehrt, nicht weil die Krise eine längst überwundene Kleinigkeit wäre, sondern weil sich da nichts von selbst aufhebt.
So sehr Kurz, theoretisch gesehen, die Krise liebt – er benennt seine Zeitschrift nach ihr! –, so wenig paßt den Hamburgern diese Phase der Akkumulation ins Bild. Kurz entnimmt ihr den Beweis seines „automatischen Subjekts“: Nie wird so manifest, daß auch die Kapitalisten bei ihrer Profitmacherei Gesetze betätigen, die in den Zwecken der Akteure nicht nur nicht aufgehen, sondern diese vereiteln, als dann, wenn Gewinne sinken und das Wachstum ausbleibt. Alle Anstrengungen, den Gewinn zu steigern und ihn gegen den Markt zu sichern, führen zum Gegenteil. Aus der Krise macht Kurz den Beweis, daß das Denken und Wollen der Menschen in diesem System des Fetischs keine Rolle spielen; zugleich eröffnet die Krise ihm die tröstliche Aussicht, der Fetisch werde an seinen inneren Widersprüchen zerbrechen. Ebermann und Trampert hören die Botschaft und mögen sie nicht. Zuzugeben, daß die Geschäfte nicht gehen und die Kapitalisten trotz aller Ausbeutung nicht auf ihre Kosten kommen, hielten sie für eine Verharmlosung dieser Subjekte. Was sie zur Krise zu sagen haben, ergibt sich daraus, was sie meinen, sagen zu müssen, um Kurz’ Ohnmachtstheorie der Herrschenden zurückzuweisen. Wie vorher Auerbach haben auch sie, wenigstens im ökonomischen Teil ihres Buches, nicht die Wirklichkeit zum Gegenstand ihrer Aussagen, sondern die angefeindete Position. Die kapitalistische Realität führen sie als Beweismittel gegen ihren Opponenten an, wo und wie sie sich ihrer Meinung nach dafür eignet. Diesem Konzept folgend geben sie erstens zu, daß es Krisen wirklich gibt, bestimmen diese zweitens, wegen der Beweisabsicht, daß es bloß Krisen sind, grundfalsch und lenken drittens das Augenmerk auf die Krisenbewältigung, die längst unterwegs und erfolgreich ist:
„Der Zwang zur permanenten Anhäufung von Werten dehnt den Kapitalstock im Verhältnis zur lebendigen Arbeit so lange aus, bis die angeschwollene Kapitalmasse die Grenzprofitabilität sinken läßt. Das fixe Kapital wirft immer mühsamer die angestrebte Profitrate ab, es kann sich nicht mehr ausreichend verzinsen. Solange aber der aus den Arbeitskräften durch Rationalisierungen und technische Verfeinerungen herausgepreßte Mehrwert so hoch gehalten werden kann, daß er die Verzinsung des Gesamtkapitals kompensiert, ist die Produktion gesichert. Erst jenseits dieser Grenze unterbleiben Investitionen oder dienen überwiegend der weiteren Rationalisierung. … Die jüngsten Krisenerscheinungen kündigten sich seit etwa zwanzig Jahren an. Dies drückte sich in abgeflachten Wachstumsraten, in Akkumulationsstockungen und in einer wachsenden Geldanlage aus. Da Prosperitätsphasen zugleich konsumfördernd sind, belastete ein gestiegener privater und staatlicher Konsum zusätzlich die sinkende Profitabilität der Wirtschaft. Die Sanierung der Profitrate erfolgt jedoch nicht erst Mitte der 90er Jahre mit Hilfe der Apologie einer ‚Risikogemeinschaft‘, sondern begleitete diesen Prozeß von Anfang an.“ (S.23f. u. 55)
Was ist Gegenstand und Thema dieser Darstellung? Marx’ Erklärung des Krisengrundes – Senkung der angewandten Arbeit relativ zur Größe des Gesamtkapitals – wird im Ton der Selbstverständlichkeit erwähnt. Zugleich wird dem Leser das Verständnis des schnell hinzitierten Zusammenhangs gar nicht abverlangt; in VWL-Fehlern zuhause, wie ihn die Autoren voraussetzen, bekommt er ein Angebot der plausiblen Art gemacht: permanente Anhäufung – angeschwollenes Kapital – sinkende Grenzprofitabilität. Soll es doch bloß das „Immer-Mehr“ sein, das nicht gut gehen kann? Sinkt die Grenzprofitabilität des Kapitals wie der Grenznutzen des sechsten Bieres? Im zweiten Satz wird dem fixen Kapital abverlangt, es solle eine Profitrate abwerfen, was es tatsächlich aber nicht immer mühsamer
, sondern überhaupt nicht schafft. Diese Weisheit haben die Autoren weder von Marx noch von der Volkswirtschaftslehre; bei Marx ist das fixe Kapital weder Quelle noch Bezugsgröße des Profits, die VWL aber kennt die Kategorie des fixen Kapitals gar nicht. Die Profitrate ist auch noch eine angestrebte
. Hier reden die Autoren also von Wünschen der Kapitalisten.Die haben aber wiederum mit der Profitrate, die Marx abhandelt, sicher nichts im Sinn. Im dritten Satz wird der durch Rationalisierungen gesteigerte Mehrwert als Gegenmittel gegen die Krise und als Instrument zur Rettung der Produktion angeführt. Geht es um die? Wir dachten immer, die kapitalistische Produktion sei Mittel des Profits und nicht der Profit das Mittel, die „Produktion zu sichern“. Vor allen Dingen aber sind die Rationalisierungen, die den Mehrwert steigern, nicht etwa ein Gegenmittel gegen den Fall der Profitrate, sondern haargenau dieselben Methoden, die ihren Fall herbeiführen. Aber das ist wieder Marx. Die Hamburger sind, wenn sie im nächsten Satz wieder Rationalisierungen anführen, schon bei Konkurrenzstrategien, mit denen Kapitalisten in der Krise ihren Marktanteil verteidigen. Schließlich wollen sie nicht einmal auf die erzbürgerliche Idee verzichten, daß wachsender Konsum die Profite belastet hätte, weil ihnen diese Auffassung den Gegensatz der Kapitalisten zum Leben der Menschen so schön auszudrücken scheint. Bei Marx hat die Krise ihren Grund umgekehrt darin, daß das Kapital sein Warenprodukt grenzenlos ausdehnt und zugleich die Konsumtionskraft der Gesellschaft beschränkt, die es ihm versilbern müßte. Zu guter Letzt reden sie von einer Sanierung der Profitrate, die schon eine ganze Weile mit einer Apologie vorangetrieben wird. Überflüssig, daran zu erinnern, daß die Profitrate sowieso von niemandem saniert werden kann: Sie „saniert“ sich durch Entwertung von Kapital, und diese Sanierung ist die Katastrophe für den Kapitalisten, den es trifft. Alle Veränderungen, die Kapitalisten vornehmen und vornehmen können, um ihren individuellen Profit zu „sanieren“, sind eben die Methoden, die den Fall der Profitrate herbeiführen.
Darüber, was Krise ist, wollen wir mit den beiden lieber nicht weiter streiten. Denn ihr vermischtes Zitieren von Marx-Wörtern und bürgerlichen Konjunkturtheoretikern läßt von beiden nichts übrig. Von Marx nicht, weil ein Wille, den Grund der Krise ausfindig zu machen, ihren Aussagen nicht zu entnehmen ist; von den Konjunkturforschern nicht, weil auch ihre wirtschaftspolitischen Strategien und Schuldzuweisungen weder beurteilt noch kritisiert, sondern eben nur zitiert werden – als Belege dafür, daß es die Krisen, von denen Marx redet, wirklich gibt. Und schließlich und endlich dient dieser Beweis ihrer linken Orthodoxie, bei dem alles wie Kraut und Rüben durcheinandergeht, nur der Vorbereitung der Mitteilung, daß Krisen nichts Ungewöhnliches sind, daß die aktuelle schon länger dauert und die Kapitalisten, die Schweine, sich auf Kosten der Lohnabhängigen sanieren.
2. „Sachzwangideologien bestreiten und Schuldige benennen!“
Ebermann und Trampert haben deutlich gemacht, daß sie das ideologische Argument Krise
nicht leiden können; zurückgewiesen haben sie es durch eine tendenzielle Leugnung des Phänomens. Dasselbe Verfahren wiederholen sie an der anderen Neuigkeit, die aus der Welt des Kapitals vermeldet wird, um die Unmöglichkeit oder Überholtheit des Klassenkampfs zu beweisen, der These von der „Globalisierung“. Sie wissen um die ideologische Funktion der Standortdebatte, nach der die Nationalstaaten immer weniger selbst bestimmen könnten, weil sie ihre ganze innere Ausstattung – Löhne, Sozialsysteme, Steuern etc. – den Ansprüchen internationaler Anleger gemäß machen müßten. Mit der Konkurrenz der Nationen um Kapitalanlage befassen sich die beiden ausschließlich unter der Vorgabe, den globalisierenden Unsinn
zu entkräften; besonders natürlich Kurz’ Radikalisierung davon, die den Staat entwirklicht
sieht. Ihre Urteilsbildung über den heutigen Imperialismus findet nur wegen und gegen Kurz und Konsorten statt und folgt dem Auftrag, Gegenbehauptungen gegen das „Standortargument“ zu produzieren. Sie wissen nicht, daß man Argumente nicht durch ein Deuten auf Fakten widerlegen kann, und kontern die falschen Theorien ihrer Gegner durch eigene Falschmeldungen aus der Wirklichkeit. Die „Argumente“ suchen sie sich nach der Leistung heraus, die sie für diesen Zweck zu leisten versprechen. Ob sie untereinander zusammenpassen, ist zweitrangig.
Damit die „Globaltheoretiker“ nicht Recht behalten, bestreiten die Hamburger an einer Stelle einfach die Allgemeinheit der heutigen Standortkonkurrenz. Kapitalistische Staaten haben kein prinzipielles Interesse daran, aus dem ‚reißenden Strom‘ (des den Weltmarkt bevölkernden Kapitals) Kapital für ihr Land abzuziehen.
, weil sie dann auch Gewinntransfer ins Ausland zulassen müßten. Doch, dieses Interesse haben Nationen! Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als um ihren nationalen Anteil am Weltgeschäft dadurch zu konkurrieren, daß sie ihren Standort für internationales Kapital attraktiv machen. Sie müssen dann eben erstens darauf achten, viel Produktion im Inland zu konzentrieren und zweitens eine positive Bilanz transferierter und aus dem Ausland eingehender Gewinne der einheimischen Multis zu erwirtschaften. Im nächsten Moment taugt ihnen ein dem ersten widersprechendes Argument, das in der Sache den Standortvergleich der Multis unterstellt, aber die Gefahr halb so schlimm erscheinen läßt. Wenn es gar nicht mehr um die Erklärung der weltwirtschaftlichen Verhältnisse, sondern nur mehr um eine Gegenposition zur „Standortideologie“ zu tun ist, dann „leistet“ das zweite Argument dasselbe wie das erste.
„Unbestritten üben Kapital- und Warenverkehr einen Zwang auf Nationalstaaten aus. … Viele industrielle und dienstleistende Kernbereiche sind allerdings so ortsgebunden wie die chinesische Mauer. … Das Ausmaß, in dem Produktionsstätten mit ihrem Drumherum räumlich gebunden sind, entlarvt das Standortargument der Kapitalverbände als Propaganda, die nur noch von den linken Globaltheoretikern übertroffen wird.“ (S.72f)
Ganz stofflich genommen, soll also das Kapital nicht so mobil sein, wie die Angstmacher suggerieren. Als ob Kapitalisten nicht stets mit beidem befaßt wären; mit der Bewährung der Fabriken, die sie schon haben und die tatsächlich nicht mobil sind, und mit der zusätzlichen Anlage von neuem Kapital, das in Geldform allerdings sehr leicht über Grenzen zu bewegen ist. Aber was nützen solche Unterscheidungen Leuten, die absichtlich tendenziös argumentieren? Mit ein paar Behauptungen des Gegenteils vom Gegenteil machen sie die Befassung mit dem Imperialismus zum moralischen Gefecht:
„Die Behauptung, die mächtigen Staaten und die von ihnen ausgeplünderten armen Länder würden sich unter der Weltherrschaft des Geldes gleichermaßen auflösen bzw. sich aneinander anpassen, kommt einem historischen Freispruch des Imperialismus gleich. … Aus den Tätern Opfer einer alle in Mitleidenschaft ziehenden globalen Entwicklung zu machen, ist allerdings Ausdruck eines Zeitgeistes, der auch linke Theoretiker dazu veranlaßt, sich nur noch darum zu sorgen, ob das Kreditsystem der Reichen auch sicher genug ist oder womöglich das hiesige Bankensystem vor einem Zusammenbruch steht. Indem unter der Beschwörung der Globalität alles gleich wird, beerdigt die neue Theorie die auf Nationalstaaten beruhende imperialistische Wirklichkeit. … Alles im Lande folgt – heißt es diesmal von links – einem fremden Zwang. Statt deutsche Regierungen, Institutionen und gesellschaftliche Gruppen für das von ihnen zu verantwortende Übel auch verantwortlich zu machen, wird der Knebel ‚Finanzmarkt‘ oder irgend etwas anderes Fremdes beschworen, das in seiner Globalität bedrohlich genug erscheint.“ (S.86)
Ein historischer Freispruch liegt gar nicht vor! Die Hamburger hören von vornherein nur die ideologische Funktion heraus, die sie in Kurz’ Befunde hineinlesen. Sie weisen eine Entschuldigung der Imperialisten und eine parteiliche Sorge um den Bestand des Bankensystems zurück, wo Kurz frohlockend den Untergang beider weissagt. Kurz’ Unsinn, in die „Entsubjektivierung“ auch die Staaten einzubeziehen, um das „fetischistische Weltverhältnis“ immer reiner nach seinen eigenen Gesetzen funktionieren und daran zugrunde gehen zu lassen, liegt auf einem ganz anderen Feld als dort, wo die Hamburger ihn beim Entschuldigen ertappen wollen. Ihr moralisches Bedürfnis, Täter und Schuldige verantwortlich zu machen, läßt ihnen alle Theorie als Stellungnahme zu ihrem Thema erscheinen.
Ihre Kritik besteht darin, den Verantwortlichen die Maske des Biedermanns vom Gesicht zu reißen. Sachgesetze der Kapitalakkumulation entlarven sie als Entschuldigungsideologien und lösen sie in bösen Willen auf. Ausbeutung beweisen sie, indem sie Zeugen und Zeugnisse des Ausbeutungswillens präsentieren. Sie führen Kapitalisten vor, die das gewünschte Geständnis ablegen: Tyll Necker hat gesagt, man müsse die Krise nutzen, weil die Menschen bei 4 Millionen Arbeitslosen reif seien für Lohnsenkung und die Demontage des Sozialstaats. Insoweit Necker bekennt, daß er die Arbeiterklasse verarmen will, glauben die Autoren ihrem Zeugen jedes Wort. Es ist übrigens keine Kunst, Zeugnisse dieser Art ausfindig zu machen, sie stehen in jeder Zeitung. Umgekehrt wäre es eigenartig, daß die Absenkung von Lohn, Rente etc. denen unbekannt sein sollte, die dies organisieren. Sobald der glaubwürdige Zeuge seine Reformen jedoch mit der bedauerlichen aber unabweisbaren Notwendigkeit begründet, Produktion am Standort Deutschland zu halten und neue Kapitalanlage ins Land zu holen, glauben die beiden ihm kein Wort mehr. Der Sachzwang ist bei ihnen ein angeblicher, eine leere Drohung, die sich in nichts auflöst, wenn die damit bedrohten Belegschaften sich nicht bange machen lassen: Ihr braucht euch nicht erpressen zu lassen, so leicht hauen die schon nicht ab! Und wenn doch? Müssen sich die Beschäftigten dann erpressen lassen? Wer nie auf die Idee kommt, Sachzwänge zu kritisieren, sondern den Arbeitern Handlungsfreiheit zusichert, indem er die Zwänge leugnet, steht in diesem Dilemma. Sachzwänge abzustreiten, ist nur die andere Seite davon, daß man sie respektiert. Die Gewerkschaften z.B. sind ständig bemüht, die Grenze zwischen der Unternehmerpropaganda, die sie nicht glauben müssen, und dem echten Sachzwang zu ermitteln, dem sie um so strenger gehorchen. Dabei gibt Tyll Necker so schön Auskunft darüber, was ein Sachzwang ist – und warum die Belegschaften, die mit ihm konfrontiert werden, nicht in Gelächter ausbrechen: Wer ist es denn, der aus Deutschland wegzugehen oder gar nicht erst zu kommen droht? Genau die Kapitalisten, deren Sprecher der Herr Necker ist. Er beruft sich auf sein Interesse und sein Recht, Kapital dort anzulegen, wo es am meisten abwirft, und er verspricht im Namen aller einheimischen und internationalen Klassenbrüder, daß sie dieses Recht in ihrem Interesse ausüben werden. Die Allgemeinheit und Gültigkeit dieses Interesses, das allen anderen Interessen in der Gesellschaft vorausgesetzt ist, ist der Zwang, den es ausübt. Necker heuchelt, wenn er den Sachzwang vom Interesse der Kapitalisten abtrennt und behauptet, sie müßten leider einem Zwang gehorchen, der doch nur aus der konkurrierenden Betätigung ihres Interesses entspringt. Durch ihre Konkurrenz werden die Erfolgswege ihres Interesses allerdings zur Notwendigkeit, nicht nur gegenüber dem Rest der Gesellschaft, sondern auch für den Kapitalisten.
Der Irrtum der Arbeiter, die sich Sachzwänge einleuchten lassen, besteht nicht darin, daß es diese Zwänge etwa nicht gäbe. Der Fehler ihres Respekts besteht darin, daß sie die Zwänge der Konkurrenz als Gesetze anerkennen, die aus der Natur des Produzierens und Verteilens überhaupt folgen, und nicht als Zwänge erkennen, die zu ihrer proletarischen Einkommensquelle gehören; Zwänge, in denen sich bemerkbar macht, daß der objektive Zweck der Lohnarbeit – Mehrwert – sich nicht verträgt mit dem subjektiven Zweck – dem Lebensunterhalt –, für den Arbeiter arbeiten gehen. Notwendigkeiten gibt es in diesem System jede Menge, – aber als Zweck des Produzierens überhaupt ist die Profitmacherei gar nicht notwendig. Die Notwendigkeiten der Profitproduktion als Konsequenzen eines feindlichen, im Kapitalismus gültigen Interesses zu erkennen, das die Unterordnung der Arbeiterinteressen verlangt, aber nicht verdient, ist der erste Schritt der Befreiung aus dem Lohnsystem. Dann erst würden die Herren Arbeiter begreifen, unter welchen Zwang sie wirklich gestellt sind – es ist nicht die Raffgier oder Unfähigkeit eines Vorgesetzten; es sind nicht die Sachgesetze „des Wirtschaftens“, sondern es ist die Macht des Eigentums, für dessen Vermehrung die Gesellschaft so perfekt funktionalisiert ist, daß die Wahnwitizigkeiten ihrer Ökonomie wie ein zweckrationales, unpersönliches System aussehen.[3] Gegen diese Notwendigkeiten des Kapitalismus müssen Arbeiter, die auf ihrem Interesse bestehen, verstoßen – im Bewußtsein der Konsequenzen.
„Ein dramatischer Verfall von Massenbewußtsein“
Ebermann und Trampert wollen die Verwandlung des Marxismus in Philosophie nicht mitmachen. Die Vergeheimnissung der kapitalistischen Welt in ein unmerkliches, aber totales Verhängnis, in das alle bürgerlichen Menschen in gleicher Weise verstrickt sind, gilt ihnen als irrationaler Quark. Ihre Kritik daran besteht in der Behauptung des Gegenteils. Der subjektlosen Welt der Unbewußtheit setzen sie ihr Bild der Offensichtlichkeit des Kapitalismus entgegen: Täter und Opfer liegen auf der Hand. Täuschung ist bei den einen wie den anderen ausgeschlossen. Die Ausbeuter gestehen die Ausbeutung; die Ideologien, mit denen sie ihre Interessen verschleiern, braucht man ihnen nur nicht zu glauben. Noch nicht einmal beim universellen Unterordnungsargument der bürgerlichen Gesellschaft, dem Sachzwang, entdecken sie Aufklärungsbedarf und einen Irrtum derer, die es anerkennen und sich beugen. Wo alles offen zu Tage liegt und falsches Bewußtsein keinen Platz hat, da wird Kritik und ihre praktische Konsequenz, die Revolution, zu einer Frage der aufrechten Maßstäbe und ihrer konsequenten Anwendung. Beides vorzuführen und damit aufzurütteln, ist ihr Verständnis von Agitation.
Sie deuten auf das Schlechte, damit es sich entlarvt. Weil es an der Kenntnis der Fakten aber gar nicht fehlt, helfen sie der Entlarvung ein bißchen nach und fügen dem Deuten das Umdeuten hinzu. So reagieren sie darauf, daß sich diese Welt an den Maßstäben der gang und gäben Moral eben nicht überzeugend und vernichtend blamiert. Also heißt es steigern: Vielleicht muß man das Böse noch deutlicher herausstellen, vielleicht den Gesichtspunkt von Menschlichkeit und Solidarität noch nachdrücklicher in Erinnerung bringen? Damit das Urteil der vorhandenen Moral zu dem Schluß kommt, den sie fordern, ist Übertreibung das beste Argument:
– Der ökonomische Verkehr zwischen der ersten und der Dritten Welt heißt bei ihnen grundsätzlich nicht Tausch, sondern Raub – es handelt sich also um eine Form der Aneignung, die vom bürgerlichen Gesetzbuch verboten wird. Daß der Austausch von Wertäquivalenten die Härte ist, die den Weltmarkt in solche und solche Nationen scheidet, ist ihnen moralisch nicht eindeutig genug.
– An der Überbevölkerung – den auch in Deutschland fürs Kapital nicht nutzbaren Menschen, die eine Last darstellen – wird ihnen klar: Die Überzähligen umzubringen, ist das Sanierungsmittel der Wahl. Sogleich erkennen sie Rentensenkung, Obdachlosigkeit und Arbeitshetze als Maßnahmen einer Ausrottungspolitik.
„Die Hilflosigkeit der Armen drückt ihre Ahnung aus: Das Sinnvollste, was sie für das Gemeinwesen tun könnten, wäre ihr kollektiver Selbstmord.“ (S.42)
Es wäre nicht schwierig, die wirklichen Gründe der erwähnten Härten herauszufinden: Rentensenkung hat den Zweck, die Rentenkasse zu sanieren und die Kapitale von Lohnnebenkosten zu entlasten; die Alten müssen nicht gleich sterben, sondern mit weniger auskommen. Obdachlosigkeit hat gar nichts Finales an sich, sondern ist das zynische Resultat von Verhältnissen, in denen das grundsätzlichste Lebensbedürfnis nur über Geld zu regeln ist. Arbeitshetze dagegen ist final – sie zielt darauf, pro bezahlte Arbeitsstunde mehr Leistung aus den Beschäftigten herauszuholen, aber nicht auf deren Beseitigung. Der normale Zynismus dieser Gesellschaft genügt den beiden Autoren nicht, um zu der Sorte Verurteilung zu kommen, die sie anpeilen. Der Schutz des Lebens hat Verfassungsrang, der Lohn nicht. Deshalb brauchen die Ankläger ihre agitatorische Übertreibung und nehmen sie für bare Münze. Wenn Mord wirtschaftlich geboten ist, steht das Urteil fest: menschenfeindlich!
Die beiden, die zu anderer Gelegenheit auch mal über den modischen „Gutmenschen“ spotten konnten, entgleisen moralisch. Um ihrer Botschaft willen liefern sie ein flammendes Bekenntnis zur Präambel des Grundgesetzes ab und exkommunizieren andere aus der Gemeinde der linken Gutmenschen:
„In dem gemeinsamen Wunsch, einander zu helfen und zu schützen, Menschen nicht ihrer Herkunft und ihres Geschlechts wegen zu minderwertigen Subjekten zu machen, steckt mehr Kommunismus als im sozialrevolutionären Geschwätz.“ (S.99).
An diesem Wunsch aber fehlt es! Wenn alles auf der Hand liegt, wenn die Behandlung der Untergebenen den bescheidensten Ansprüchen der Menschenwürde ins Gesicht schlägt – dann müssen die Massen doch den Schluß ziehen, den Trampert und Ebermann ihnen vorgeführt haben. Müßten! Weil der moralisch und menschlich gebotene Aufstand ausbleibt, kippt ihre Zurückweisung von Kurz’ Entfremdungs-Philosophie um und gerät zu einem, dem seinen gar nicht unähnlichen Bild vom verdorbenen Menschen. Nach ein paar ökonomischen Kapiteln zur Einleitung widmen sie den weitaus größeren Teil ihres Buches der Darstellung des Menschen, der das System nicht umstürzt, obwohl ihm doch alles klar sein müßte. Mit einem Menschenbild erklären diese Leute, die an den offensichtlichen Bedarf nach Revolution glauben, ihr Ausbleiben zu einer Notwendigkeit. Es gibt die menschlichen Menschen nicht mehr, die das Werk zu verrichten hätten: Die Arbeiter haben Klassenbewußtsein und Persönlichkeit verloren.
(S.35)
„Alte soziale Klassenkollektive haben sich aufgelöst. … Es scheint, daß der marxistische Versuch, im entwickelten Kapitalismus ein revolutionäres Subjekt aus dessen sozialökonomischer Stellung abzuleiten, wenn nicht endgültig, so zumindest auf absehbare Zeit gescheitert ist. Natürlich haben sich die Klassengesellschaften deshalb nicht etwa in Luft aufgelöst, im Gegenteil: Die Ursache für das Verschwinden eines Klassenbewußtseins liegt gerade in deren Verfestigung durch die gelungene Identifikation der Ausgebeuteten mit dem Betriebszweck und den marktmäßigen Funktionen, die ihnen rund um die Uhr zugewiesen sind.“ (S.109)
Ein derart fortgeschrittenes Stadium der Auflösung des Klassenbewußtseins
können sich die Autoren nur dadurch erklären, daß es den Leuten zu gut geht: In der
„langen Prosperität nach dem Zweiten Weltkrieg … flogen dem Proletariat massenhaft Waren um die Ohren. … Der Kapitalismus hatte das Proletariat am Geld schnuppern lassen. … Reisen … sozialer Aufstieg … die Bekanntschaft mit Rentenpapieren und Aktien … das Umworben-Werden als Konsumenten erschienen den Bewußtlosen als Zeichen ihrer Freiheit und Anerkennung.“ (S.110-117)
Dasselbe System, dem sie vorher blanken Mord aus Profitgründen nachsagten, hat nun das Verbrechen begangen, die Ausgebeuteten so lange mit Glücksgütern zu bestechen, daß sie über ihre Ausbeutung hinwegsehen. Die Hamburger Moralisten lassen den Widerspruch der uralten Bestechungstheorie wieder aufleben, die einerseits „verstehen“ kann, daß sich Arbeiter wegen vorwiegend guter Erfahrungen mit dem System der Ausbeutung identifizieren, die sie nicht mehr merken. Andererseits aber will sie ihnen doch nicht den Vorwurf ersparen, sich ihre natürliche Bestimmung zur Revolution für ein paar Silberlinge abkaufen zu lassen.
Weil ihre Aufgabe bleibt und die Bestochenen sich ihr nur verweigern, muß den Integrierten dann doch Bewußtlosigkeit, Blindheit und Perversion nachgesagt werden. Aus der Abwesenheit des Klassenbewußtseins, das sich gehören würde, konstruieren sich die Autoren den schlechten Charakter, dem all das genau entspricht, was sie verabscheuen:
„In der postmodernen Blödwelt dringt fast nichts mehr so ins Bewußtsein, wie es wirklich ist. Das Unternehmensziel zu erreichen, wird von den Unfreien längst nicht mehr als Anstrengung verstanden, der man sich tunlichst entziehen sollte, sondern genauso als Chance zur Selbstverwirklichung wie das getriebene Dasein in der freien Zeit, dessen Streß dem des Berufsalltags immer ähnlicher wird.“ (S.110)
Dank ihrer Schubladen – revolutionäres oder nicht revolutionäres Bewußtsein – können sie einfach nichts normal darstellen. Wann war je die Erfüllung des Arbeitsauftrags, für den der Arbeiter sein Geld kriegt, eine Anstrengung, der er sich tunlichst entzieht? Und heute soll dasselbe gleich die Selbstverwirklichung sein, als die Motivationspsychologen die Ableistung der Arbeit gerne genommen sähen? Als Beitrag zu einer Charakterologie des modernen Blödmenschen, der sich voll mit dem identifiziert, was ihm feindlich entgegensteht, taugt der Verriß ebenso gut wie die anderen interessanten Befunde über diesen Kerl: Arbeit ist sein Leben, er kann gar nicht mehr aufhören damit; er bildet die Freizeit durch Aktivität und die Angst, nichts zu versäumen, nach Kräften dem Streß der Arbeitszeit nach; er ist ein autoritärer Charakter, der sich nur unterm Kommando oder im Einklang mit dem Geschmacksurteil von Millionen wohl fühlt usw.
Mit der Karikatur moderner Freizeitgestaltung beschreiten die Revolutionäre das Feld der Kulturkritik. Wie Generationen elitärer Kritiker des Massengeschmacks vor ihnen, machen sie den Leuten ihren Zeitvertreib madig. Wo es um nichts geht – um Unterhaltung eben –, spielen sie die strengen Richter und werfen den Massen vor, sie ließen sich falsch unterhalten. Ihrem Leiden an dem für die Revolution untauglichen Menschenschlag fügen sie nun die andere Seite der Moral hinzu: ihren Lohn. Der Genuß, nicht so zu sein wie diese, stellt sich beim Ausmalen der Arschlöcher, die Freizeitparks, Bodybuilding-Studios und Techno-Parties bevölkern, ganz von selber ein. Daß dies einer entwickelten Individualität unwürdige Beschäftigungen sind, leuchtet Leuten sofort ein, die gerne mal ein gutes Buch lesen, außer den Stones auch Miles Davis hören, ihr Bier mit Diskussion in verrauchten Buden trinken und Trimm-Dich auf den unentgeltlichen öffentlichen Parcours abwickeln.
„Der Verlust jeder gesellschaftspolitischen Utopie rückte den eigenen Körper in den Mittelpunkt des Daseins. Die ganze Tragik, die darin liegt, daß die narzistische Ausprägung des Arsches das Denken und Handeln absorbiert…“ (S.131),
müssen unsere Hamburger Lebenskünstler nicht erleiden, die sich auf dem Deckel ihres Buches sportlich präsentieren. Sie haben ihre Utopie ja noch. Gegen den Verlust der richtigen Werte und des korrekten autonomen Selbstverständnisses, setzen die Autoren das Vorbild ihrer Werte: echten Genuß, wirkliche Entspannung, tiefe Ruhe und Müßiggang.
Die übrigen Ergebnisse der Erkundung der menschlichen Abgründe sind schnell zusammengefaßt: Nach der Freizeit der Massen wendet sich das Buch dem Thema Nationalismus zu. Da wird „der Deutsche“ mehrere hundert Seiten lang an den Pranger gestellt. Mit ihrem Wust von Zeugnissen deutscher Verwerflichkeit, durch die Jahrhunderte gesammelt und zum Bestand einer verachtenden Tradition addiert, die den heutigen Lohnarbeiter prägt und ihn so unbrauchbar für revolutionäre Bemühungen macht, sind sie dann auch beim eigentlichen Gegenstand ihres Buches gelandet. Das bißchen Radebrechen über Ökonomie und Ausbeutung wird als Zutat kenntlich; es figuriert als Beweis dafür, daß ihnen bei allem Abscheu vor der vergeigten – insbesondere deutschen – Menschheit auch noch die Verhältnisse zuwider sind. Oder andersherum: Der aktuellen Mode enttäuschter Linker, „den Deutschen“ als einen ganz und gar verachtenswerten, unheilbar schlechten Volkscharakter zu identifizieren, verleihen sie mit ihren Fingerzeigen auf die Ausbeutungsinteressen, denen sich das Volk einfach nicht widersetzt, den Schein einer objektiven, ökonomischen Begründung.
III. Wie sich die Bilder gleichen … Die Absage an das unbrauchbare revolutionäre Subjekt
Die dem Anschein und ihrem Selbstverständnis nach so entgegengesetzten Vertreter linker Richtungen kommen zu einem übereinstimmenden Resultat: zum Bild eines verkorksten, sich selbst verfehlenden, für Vernunftunternehmungen untauglichen Menschengeschlechts. Ihr Marxismus, d.h. ihre Vorstellung von Gerechtigkeit oder Vernunft, taugt beiden gerade noch zu der Erkenntnis, daß die Menschen nicht so vernünftig sind wie sie. Kein Wunder, die verfeindeten Standpunkte machen denselben Fehler, wenn sie von verschiedenen Extremen her die Differenz tilgen zwischen dem, was die Leute wollen, zu dem, wofür sie sich damit hergeben und was sie sich gefallen lassen müssen. Beide Seiten landen bei einer notwendigen Zustimmung der Ausgebeuteten zu ihrer Ausbeutung. Die einen, weil sie die Arbeiter ohnehin nur als unbewußte Charaktermasken, ja als Geschöpfe des Kapitals gelten lassen, deren unverschuldetem Egoismus der Tanz ums goldene Kalb gerade recht ist. Die anderen, weil sie Ausbeutung und Unterwerfung als offensichtliche Tatsache besprechen und sich dann den korrumpierten, arbeitsgeilen, autoritären Charakter dazu basteln, der genau danach verlangt.
Ihr bemühter Beweis der notwendigen Identität der Leute mit den kapitalistischen Verhältnisse ist das Bekenntnis, daß bei ihnen kein theoretisches Mißverständnis von Marx vorliegt, sondern daß sich Anhänger des revolutionären Automatismus, die sie immer waren, nun umgekehrt auf den Weg machen. Es interessiert sie nicht, daß Arbeiter revolutionär oder brav, nationalistisch oder christlich sind, je nachdem, wie sie sich ihre schlechten Erfahrungen erklären. Kritik, d.h. Streit mit dem verehrten revolutionären Subjekt, das nicht die Schlüsse zieht, die sie gezogen sehen wollen, ist ihnen fremd. Jahrelang haben sie dieses Subjekt gesucht, als ob es irgendwo zu finden wäre; wollten sich mit ihm verbünden, sich an die Spitze seiner Bewegung stellen – wenn es sich nur gemeldet hätte. Da es sich aber nicht von selbst meldet, rächen sich seine enttäuschten Liebhaber an ihm und zeichnen ein groteskes Bild des sich selbst entfremdeten, herz- und kulturlosen Menschen, das ihre Absage an das für seine Bestimmung untaugliche revolutionäre Subjekt ins Recht setzt. Sie geben nicht auf und belassen es nicht bei einem: Dann eben nicht! Sie halten an ihrer Idee, daß die Arbeiter Revolution zu machen hätten und auch machen würden, wenn sie menschlich halbwegs intakt wären, fest mit Hilfe ihres Bildes von einem total verfehlten Menschen. Ein paar proletarische Irrtümer über die Wirtschaft und die eigene Rolle in ihr würden eben auch nicht den Beweis liefern, daß es ein für allemal unmöglich ist, die Arbeiter gegen das Kapital aufzubringen. Wenn sie zusammenfassend ihr Anliegen ausdrücken, formulieren sie den ausweglosen Zirkel, daß die Leute vorweg schon eine andere Gesellschaft im Kopf haben müßten, um auf Einwände gegen die jetzige zu verfallen. Die Hamburger halten es mit Adornos Farbenlehre – man müsse schon die Vorstellung anderer Farben haben, um über das Grau zu verzweifeln –; Kurz warnt vor Gegenwehr gegen die Senkung der Löhne, weil die Leute nur Löhne und nicht „eine neue Systemüberwindung“ wollen:
„In dieselbe Falle der historischen Ziellosigkeit würden spontane Massenaktionen für den Erhalt der sozialen Gratifikationen laufen, auf die manche radikale Linke hoffen … Aber auch im High-tech-Zeitalter gilt, daß der Knüppel nicht klüger sein kann als derjenige, der ihn schwingt. Ohne eine neue Idee der Systemüberwindung als Ferment sozialer Bewegungen wird es nur noch Strohfeuer der hoffnungslosen Gegenwehr geben.“ (Kurz, Konkret 11/96, S.37)
Der heftige Streit beider Lager definiert Linkssein heute: Sagt die eine Seite, die Arbeiter seien Opfer, beschimpft sie die andere als „verstockte Arbeiterbewegungs-Marxisten“, die nicht kapiert haben, daß, wer Wert und Geld kritisiert, sich mit Arbeitern nicht einlassen darf. Die anderen kontern: Wer das Kapital ein „Fetischverhältnis unter Einschluß aller Beteiligten“ nennt, ist ein kleinbürgerlicher Klassenversöhnler. Den alten kapitalistischen Feind gebe es doch noch – nur die alten Freunde seien verschwunden. Natürlich dürfen anständige Linke ein Bündnis mit dem heutigen Proletariat samt all seiner häßlichen Seiten
nicht mehr eingehen, seitdem Deutsche Ausländer angreifen. Wenn die Kurz-Fraktion dann Rassismus und Antisemitismus als Erscheinungsformen des Werts dechiffrieren
, ertränken sie die besondere Unart des Deutschtums im Wertbegriff … und so fort. Lauter Unsinn auf beiden Seiten und windschiefe Entgegnungen, die nichts kritisieren, sondern dem anderen Lager Anbiederei an die für Linke unbrauchbaren Normalmenschen vorrechnen. Sie richten unter sich einen Radikalismus-Wettbewerb aus um das schärfste Verdammungsurteil gegenüber dem Revolutions-faulen Proleten. Wie sich früher der radikalste Linke daran bewies, daß er den Kapitalisten und Imperialisten noch Schlechteres zugetraut hat als sein Nebenmann, so beweisen enttäuschte Linke heute ihren Radikalismus im Abscheu vor dem Proletariat: Das will seine Verhältnisse, also hat es sie auch verdient.[4]
Der Schreiber des Leserbriefs hat die entgegengesetzten Richtungen übrigens gleichermaßen anregend gefunden und uns zum Umdenken ans Herz gelegt. Er hat die Gemeinsamkeit der feindlichen Parteien bemerkt und sie darin lohnend gefunden. Das ist nicht gut, sondern schlecht.
[1] Alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen!
Die fertige Gestalt der ökonomischen Verhältnisse, wie sie sich auf der Oberfläche zeigt, in ihrer realen Existenz, und daher auch in den Vorstellungen, worin die Träger und Agenten dieser Verhältnisse sich über dieselben klarzuwerden suchen, sind sehr verschieden von, und in der Tat verkehrt, gegensätzlich zu ihrer inneren, wesentlichen, aber verhüllten Kerngestalt und dem ihr entsprechenden Begriff.
(Karl Marx, Das Kapital, Bd. III, S. 825 und 219)
[2] Kurz’ Übertreibung und Fehldeutung der periodischen Krisen in der Akkumulation des Kapitals zum Systembruch hat sich ein früherer Artikel gewidmet: Robert Kurz, Der Untergang des Abendlandes – linksherum, GegenStandpunkt 2-92, S.59.
[3] Noch einmal soll R. Kurz zu Wort kommen, weil er in Bezug auf den Sachzwang und seine Auflösung ausdrücklich das Gegenteil vertritt: Die Differenz könnte schärfer nicht sein: Für den gemeinen Marxismus ist die Selbstbewegung des Geldes, die Verwertung des Werts, gerade jener Schein, der auf die Zwecke, den Willen, das subjektive Handeln der Menschen zurückzuführen und also in (falsche, herrschaftliche) Subjektivität aufzulösen ist. Eine radikale, konsequente Fetischismuskritik müßte dagegen genau umgekehrt die empirische Subjektivität selber als den Schein denunzieren, d.h. die Zwecke, den Willen und das subjektive Handeln der warenproduzierenden Menschen in ihre wahre Subjektlosigkeit als bloße Exekution einer allen Subjekten vorausgesetzten Fetischform auflösen. Nicht etwa, um sich dem ‚automatischen Subjekt‘ zu unterwerfen, sondern im Gegenteil, um es als solches angreifen und überwinden zu können.
(Kurz, Subjektlose Herrschaft, S. 30) Verglichen mit seiner Aufgabenstellung muß es ein Leichtes für Arbeiter sein, zu bemerken, daß sie zu kurz kommen, und der Sache auf den Grund zu gehen. Kurz fordert von Wesen, die keine Subjekte sind, ihre Subjektlosigkeit zu erkennen, um zum Subjekt zu werden. Aber sie brauchen nicht zu verzweifeln. Genaugenommen meint Kurz ja nur, man „müßte“, wenn man „radikaler“ und „konsequenter“ Fetischismuskritiker sein wollte… Aber wer will das schon!
[4] Die radikalen Menschenkritiker bedienen sich einer Logik, mit der bürgerliche Apologeten tausendfach Marx widerlegt haben: Das Mitmachen der vom Kapital Geschädigten, der funktionierende soziale Friede samt seinen demokratischen Verlaufsformen, hat ja immer schon als schlagender Beweis gegolten, daß es die Klassengegensätze gar nicht geben kann, von denen Marxisten reden. Jetzt feiert diese Tour, den Kapitalismus für Volkes Wille, also gut, zu erklären, ihre Wiederauferstehung – im spiegelverkehrten Gewand: Die Massen fühlen sich aufgehoben in diesen Verhältnissen, also sind es auch die ihren – so schlecht, wie sie eben beide sind.