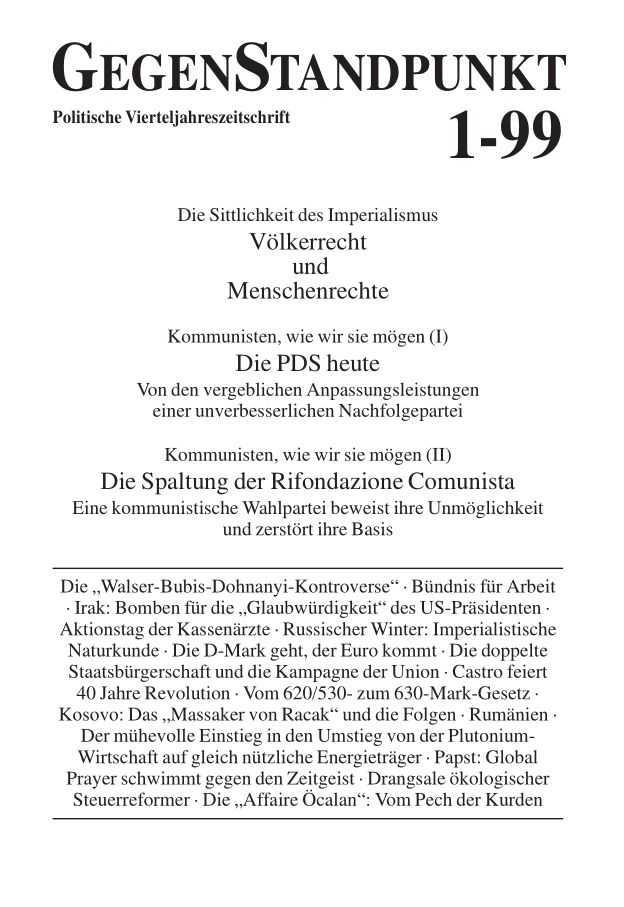Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Lafontaine kratzt am Stabilitätsfetischismus der Regierung Kohl
Der neue Finanzminister fordert eine Zinssenkung von der Bundesbank – und berührt damit einen Fetisch deutscher Finanzpolitik, denn die Unabhängigkeit der Bundesbank gilt als die Quelle und der Garant des nationalen Erfolgs. Eine Umorientierung der Politik durch den linken Super-Minister?
Aus der Zeitschrift
Teilen
Lafontaine kratzt am Stabilitätsfetischismus der Regierung Kohl
Kaum im Amt, macht die neue Regierung deutlich, daß sie nicht die alte ist. Den Herbst über fordert der neue Superminister für Finanzen und internationale Wirtschaft immer wieder von der Bundesbank, sie solle die Zinsen senken, und mahnt ihre gesamtwirtschaftliche Verantwortung an, die eben nicht nur die Stabilität des Geldwerts, sondern auch das Wachstum des Kapitals und – fürs Volk ausgedrückt – die Arbeitsplätze einschließt. Lafontaines Ansprüche lösen im Umkreis der Banken und der FAZ helles Entsetzen aus, bei den Gewerkschaften dagegen echte Freude: Da sehen rechte wie linke Bürger, daß es doch einen Unterschied macht, ob man rot oder schwarz wählt – und darauf kommt es schließlich an. Die berühmten „Kreise des Finanzkapitals“ – und die reichen weit in einem Land der Sparer – sind überzeugt, daß der Sozi Deutschland um sein Heiligstes bringen werde, sein gutes Geld. Ein deutscher Politiker, heißt es, gebe die Prinzipien erfolgreicher Geldpolitik preis, die Kohl den europäischen Partnern gegen deren Widerstände erfolgreich aufgezwungen hatte. Die linke Hälfte des Volkes dagegen sieht das Land von der neoliberalen Stabilitätsgeißel befreit, die viele Arbeitsplätze gekostet habe, und wähnt ausgerechnet das Feld der nationalen Geld- und Schuldenpolitik im Sinne des kleinen Mannes bestellt.
Die ungeheure Wirkung der Seitenhiebe auf die Führung der Bundesbank ist durch ihren Gehalt nicht gerechtfertigt. Wenn Lafontaine die Nationalbank zur Kooperation mit der Regierung auffordert, unterstreicht er lediglich eine Selbstverständlichkeit, die in jedem anderen Land auch als solche gesehen würde. Nur in Deutschland muß die Öffentlichkeit mit ungläubigem Staunen lernen, daß sich der Tabubrecher doch tatsächlich auf den Wortlaut des Bundesbankgesetzes berufen kann, wenn er von den „Hütern der Geldwertstabilität“ Hilfestellung für die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung verlangt. Hierzulande propagiert man es nämlich als das A und O guten Geldes, daß sich die Regierung in der Beschaffung ihrer Finanzmittel dem Geldmengen-Regime der Bundesbank unterzuordnen hat. Die Unabhängigkeit der Bundesbank gegenüber Weisungen des Finanzministeriums wird als institutionelle Garantie dafür gehandelt, daß die Bank alles Nötige für die Härte des Geldes unternehmen kann – und zwar gegen eine Regierung, die mit ihrem notorischen Hang zum Schuldenmachen die Stabilität des Geldes gefährdet. Man hat sich daran gewöhnt, dieses Institut dafür zu loben, daß es den Begehrlichkeiten des Finanzministers durch seine „restriktive“ Zinspolitik Schranken setzt. Die Wahrheit war das freilich noch nie. Der Erfolg der DM wird kaum dadurch zustandegekommen sein, daß die Bundesbank der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Regierung lauter Hindernisse in den Weg gelegt hat. Und davon, daß jemals irgendeine vom Finanzminister für nötig befundene Neuverschuldung wegen der Bundesbank nicht zustandegekommen wäre, hat man auch nichts gehört. Die Verdopplung der Staatsschuld innerhalb der wenigen Jahre seit der Eingemeindung der DDR ist jedenfalls nicht an einer unabhängigen Bundesbank gescheitert, sondern mit ihr über die Bühne gebracht worden. Die Bundesbank beschränkt nicht die Vermehrung des Geldes durch staatliche Kreditaufnahme. Wenn sie mit dem Finanzministerium darüber in Verhandlungen tritt, dann deswegen, weil es beiden arbeitsteilig um den Erfolg der Finanzmanöver zu tun ist: Sie achtet auf den Stand des Vertrauens der Geldmärkte, wenn der Finanzminister sich für die Staatsaufgaben die Mittel beschafft. Diese Zusammenarbeit ist also nichts, was der neue Minister erst ins Leben rufen müßte, sondern die schon immer geübte Praxis. Bei der haben allerdings bislang alle Beteiligten schwer auf den Schein einer über der Politik stehenden Bundesbank Wert gelegt; und zwar aus gutem Grund.
Dieses Märchen hat seine Wucht so richtig im im Jahrzehnt des Maastricht-Prozesses entfalten können. Geldpolitische Disziplin wurde zum alles entscheidenden Lebensmittel von Nationen ernannt, als es darum ging, ein Gemeinschaftsgeld in Euroland zu schaffen, in das Deutschland seine harte D-Mark einbrachte. Gegenüber den Nachbarländern wurde nämlich tatsächlich auf einer Unterordnung der Haushaltspolitik unter die Disziplin des harten Geldes bestanden – sie mußten Staatsschulden begrenzen und Stabilitätskriterien erfüllen, um bei der neuen europäischen Währung mitmachen zu dürfen. Dies wurde ihnen als Nachahmung deutscher Disziplin beim staatlichen Umgang mit Geld anempfohlen und mit der deutschen Gewohnheit, sich der unabhängigen Zentralbank unterzuordnen, begründet. Überzeugt hat die Nachbarn freilich nicht die wundersame Garantie harten Geldes durch eine Rechtsstellung der Zentralbank, sondern die D-Mark selbst. Weil sie an dem Kredit, den das deutsche Geld weltweit genoß, partizipieren wollten, ließen sie sich die Unterordnung unter deutsche Vorstellungen von korrekter Geldpolitik, die Ansiedlung der europäischen Zentralbank in Deutschland und die harten Eintrittsbedingungen gefallen. Und weil sie sich diese Bedingungen gefallen lassen wollten, akzeptierten sie deren Begründung durch einen unverdächtigen, übernationalen, scheinbar ökonomischen Sachzwang. Im Heimatland der D-Mark wurde der Fetisch Bundesbank dadurch nur immer höher gehandelt: Ihre „Stabilitätspolitik“ war nicht nur gut für die Rechtfertigung aller möglichen sozialen „Sparzwänge“ im Inland, sondern erwarb sich den Ruf, die Quelle des nationalen Ertrags zu sein, der die sozialen Opfer lohnend macht: die Geldmacht Deutschlands und seine darauf gegründete Vormacht in Europa.
Inzwischen gibt es den Euro; und die Ideologie, die seine Einführung begleitete, hat nach innen und außen ihre Schuldigkeit getan. Anläßlich des Personalwechsels hängt der neue Mann im Finanzministerium die alten Lügen niedriger und stellt klar, daß die Bundesbank der deutschen Politik dient, und nicht umgekehrt die Politik der Bank. Er ist es sich zu seinem Einstand einfach schuldig, so zu tun, als würde unter seiner Amtsführung ausgerechnet mit dem von einem Finanzminister nunmal zu verantwortenden Auftrag, die „finanzpolitische Handlungsfähigkeit der Regierung wiederherzustellen“, die Politik eine Umorientierung erfahren. Um dieses komplizierte Gerücht zu lancieren, pinkelt er die Führung der Bundesbank an – nicht ohne gleichzeitig verlautbaren zu lassen, deren prompt eintretende beleidigte Reaktion beruhte auf einem „Mißverständnis“, niemals habe er die Unabhängigkeit des heiligen Instituts in Frage stellen wollen. Die Beilegung des inszenierten Zerwürfnisses dauert dann ein paar Wochen. Unter öffentlicher Anteilnahme kommt es – Gottseidank – zu einem finanzpolitischen Gipfeltreffen, bei dem der Finanzminister Einigkeit mit dem Bundesbankpräsidenten demonstriert und der tatsächlich mit den anderen europäischen Zentralbanken gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten die Zinsen senkt – wobei in den Medien eifrig darüber spekuliert wird, ob er Lafontaine gefolgt ist; oder ob er extra spät reagiert hat, um zu demonstrieren, daß er ihm nicht folgt; oder ob der Finanzminister schon vorher wußte, was die Zentralbanken für nötig halten, und den sowieso anstehenden Schritt als Wirkung des neuen Windes hinstellen wollte, den er macht. Jedenfalls weiß die Öffentlichkeit nach diesem albernen Manöver, das sie wieder einmal in all seinen möglichen Winkelzügen durchschaut hat, daß der neue Finanzminister nicht der alte ist. Er wird als der „Keynesianer“ genommen, als der er sich eingeführt hat, und wenn so einer jetzt die alte Politik der Einsparungen an Sozialausgaben fortsetzt, dann jedenfalls mit nagelneuen Gründen. Unter dem Sozialdemokraten dient die hergebrachte „Haushaltsdisziplin“ mindestens zu so komplexen finanzstrategischen Zielsetzungen wie der, der Bundesbank „geldpolitische Spielräume“ zur zinspolitischen Beförderung des Wachstums, also zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu eröffnen. Und wenn er einen Haushaltsentwurf vorlegt, den Waigel nicht knapper hätte halten können; wenn er darin allen Ministerien eine Senkung ihrer Haushaltsansätze um einen halben Prozentpunkt verordnet und das mit ziemlich vertrauten Argumenten begründet – mit der Erblast, d.h. dem Schuldenberg, den die alte Regierung hinterlassen hat, mit der labilen Konjunktur, die keine Steuererhöhungen verträgt (außer Ökosteuern), und mit dem nach wie vor gültigen Stabilitätspakt in Euroland, der keine Ausweitung der Staatsschulden erlaubt (außer der notwendigen) – dann läßt sich die Presse davon nicht täuschen. Sie weiß – von ihm nämlich! –, daß hinter seiner offenkundig gar nicht anders gearteten Finanzpolitik ein ganz anderes Konzept steckt: „Lafontaine wird realistisch“, liest man im Januar, „Haushaltszwänge haben den Gesinnungskeynesianer eingeholt“. Die Kompetenz ausstrahlende Manier von Wirtschaftspolitikern, sich als Anhänger gegensätzlicher makroökonomischer Philosophien zu präsentieren, verfängt also und führt im Fernsehen prompt zu den abgehobenen Debatten, für die der neue Minister das Stichwort gegeben hat. Monetaristen und Keynesianer unter den Wirtschaftsjournalisten geraten so heftig in Streit, daß niemandem mehr auffallen will, wie einig sie sich darin sind, daß das Geld der Zweck aller Wirtschafts- und Finanzpolitik ist, und daß die Anhänger der Angebots- bzw. der Nachfragepolitik dieses Prinzip nur entgegengesetzt betonen, wenn die einen vom Staat fordern, er müsse durch Ausgabenbeschränkung für ein hartes Geld sorgen, das die Wirtschaft dann schon von selbst und nach ihrem Bedürfnis zur Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen animiere, und die anderen von ihm verlangen, er müsse seine Finanzmacht für Wachstumsimpulse einsetzen, weil es ohne Wachstum auf Dauer keine harte Währung gebe.
Insgesamt eine gelungene ideologische Veranstaltung zur Einführung eines neuen Finanzministers: Mit seinen neuen Tönen bietet Lafontaine der linken Volkshälfte, die den Erfolg der Wirtschaft in Arbeitsplätzen mißt, die Befreiung vom monetaristischen Fetisch seiner Vorgänger als neuen Fetisch an und mit ihm neue wirtschaftspolitische Hoffnungsgründe auf Wachstum. „Die Wirtschaft“ und die Oppositionsparteien tun ihm den Gefallen und beglaubigen den enormen Umbruch, für den er stehen will, indem sie Zeter und Mordio schreien und das Vaterland untergehen sehen.