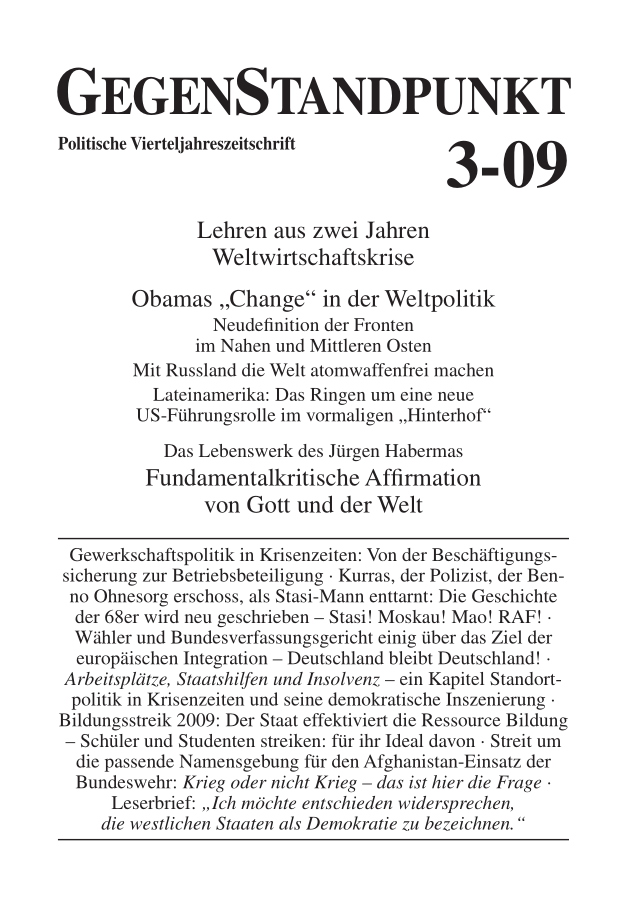Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Streit um die passende Namensgebung für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr:
Krieg oder nicht Krieg – das ist hier die Frage
Würde Deutschland Krieg führen, wäre die eigene Militärpräsenz in Afghanistan als Besatzung zu bezeichnen – aber das kann unmöglich sein: „Verteidigungsminister Jung vermied diesen Begriff, ‚weil das kein Krieg ist‘. ‚Das wäre falsch, das so zu formulieren‘, sagte Jung. Er verwies darauf, dass Deutschland nicht als ‚Besatzer‘ in Afghanistan sei.“ „Man befinde sich mit Afghanistan nicht im Krieg, sondern kooperiere mit der legitimen Regierung.“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Streit um die passende Namensgebung für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr:
Krieg oder nicht Krieg – das ist hier die Frage
Anlässlich des Todes dreier deutscher Soldaten – laut offizieller Statistik Nr. 33 bis 35 – treiben sich Politiker und Macher der öffentlichen Meinung einige Wochen lang in der Frage umher, ob der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan denn wohl als „Krieg“ bezeichnet werden darf. Eine einigermaßen merkwürdige Fragestellung, möchte man meinen. Denn dass die deutsche Regierung wild entschlossen ist, dem wachsenden Widerstand der Taliban nicht aus dem Weg zu gehen, die militärische Konfrontation für sich zu entscheiden und dabei keine Opfer zu scheuen – Der Einsatz müsse trotz der Opfer weitergehen, um den Terroristen entgegenzutreten.
(Verteidigungsminister Jung, SZ, 24.6.09) –, steht fest; und dass dieser politische Beschluss bereits in die Tat umgesetzt worden ist, die Truppe längst die Instruktionen für einen Kampfeinsatz
erhalten hat, ebenso:
„Auch die Bundeswehr hat ihre Taktik geändert. Galt bisher die Devise ‚Durchstoßen‘, wenn eine Patrouille in brenzlige Situationen geriet, so nehmen die Soldaten jetzt den Kampf an. Dann werden schnellstmöglich zusätzliche Kräfte zur Hilfe herangeführt … Auch Luftunterstützung durch amerikanische Kampfflugzeuge wird immer öfter angefordert.“ (SZ, 24.6.).
Dass die deutsche Armee im Ausland unterwegs und mit Töten und Sterben beschäftigt ist, ist der selbstverständliche Ausgangspunkt einer munteren Erörterung der Gesichtspunkte, die bei der Namensgebung eines solchen Militär-Engagements zu berücksichtigen sind.
*
Der wirkliche Grund der Bundesregierung, ihre Beteiligung am Afghanistan-Krieg nicht beim Namen nennen zu wollen, ist so alt wie der Krieg selbst und so grundsätzlich, dass er über zwei Legislaturperioden und wechselnde Koalitionen hinweg Bestand hat:
„Am Anfang legte die damalige Bundesregierung Wert auf eine strikte Trennung der Unterstützungs- und Sicherungsaufgaben der Internationalen Schutztruppe (Isaf) vom Kampfauftrag des ‚Unternehmens Nachhaltige Freiheit‘ unter amerikanischem Befehl. Sie lehnte insbesondere eine gemeinsame Kommandostruktur für beide ab. Diese wurde dann später von der Nato mit deutscher Zustimmung aus praktischen Gründen geschaffen, weil die Lage es erzwang.“ (Rühl, FAZ, 22.7.)
Deutschland will in diesem Fall, im Unterschied zum Irak-Krieg, an der Einrichtung einer dem Westen genehmen neuen Ordnung beteiligt sein und seinen Einfluss auf diesem Schauplatz geltend machen. Dies allerdings nicht als Befehlsempfänger und Erfüllungsgehilfe des großen Alliierten, wie es dessen Administration vorschwebt. Man widersetzt sich zunächst dem amerikanischen Antrag auf ein gemeinsames Oberkommando der Streitkräfte, legt Wert auf die Betonung, dass ein Nato-Mandat etwas ganz anderes ist als die amerikanische Operation „enduring freedom“, macht gegenüber jeder Forderung nach Truppen und Militärgerät seinen „Souveränitätsvorbehalt“ geltend und setzt lauter eigene Bedingungen für den deutschen Kriegsbeitrag. Der konzentriert sich auf die Besetzung und Sicherung des afghanischen Nordens und wird in unablässig betonter Absetzung von der amerikanischen Vormacht und ihrer Kriegsführung als reine, militärisch abgesicherte Aufbauhilfe definiert.
Die Entwicklung der Kämpfe hat aber im Lauf der Jahre dieser schönen Unterscheidung die Grundlage entzogen: Während zunächst die US-Streitmacht mit ihren verbündeten Truppen bei ihrer Jagd auf die Taliban das Land in Schutt und Asche legt, das deutsche Militär dagegen in seiner vergleichsweise ruhigen Besatzungszone quasi Polizeiaufgaben ausübt, eskaliert der Krieg nach und nach und die deutschen Truppen werden zunehmend in Kämpfe verwickelt.
Einen Anlass, von ihren alten Sprachregelungen Abschied zu nehmen, sieht die deutsche Regierung darin – bislang – nicht. Schon gleich nicht so kurz vor der Bundestagswahl. Im Gegenteil: Das leicht paradoxe Bemühen um eine Distanzierung von dem Krieg, den man dermaßen zur nationalen Sache gemacht hat, dass bereits der nächste Zehn-Jahres-Einsatzplan vorliegt, treibt seine Blüten:
- Würde Deutschland Krieg führen, wäre die eigene Militärpräsenz in Afghanistan als Besatzung zu bezeichnen – aber das kann unmöglich sein:
Verteidigungsminister Jung vermied diesen Begriff, ‚weil das kein Krieg ist‘. ‚Das wäre falsch, das so zu formulieren‘, sagte Jung. Er verwies darauf, dass Deutschland nicht als ‚Besatzer‘ in Afghanistan sei.
(FAZ, 25.6.)Man befinde sich mit Afghanistan nicht im Krieg, sondern kooperiere mit der legitimen Regierung.
(Ministeriumssprecher, SZ, 25.6.)Deutschland leistet gewissermaßen nur Amtshilfe zu Gunsten der afghanischen Regierung, die – im Unterschied zur Vorgängerregierung, die mit einem Bombenhagel der Nato-Vormacht in einem Akt der ‚Selbstverteidigung‘ gerechterweise aus dem Amt gejagt werden musste – echte Legitimität für sich beanspruchen kann – jedenfalls bei ihren mächtigen Geburtshelfern und Paten. Bedauerlicherweise ist diese Auffassung im Land außerhalb des Kabuler Präsidentenpalastes nicht sehr populär, weswegen die Interventionsmächte quasi gar nicht umhin kommen, der von ihnen legitimierten Regierung unter Beachtung völkerrechtlicher Grundsätze militärisch zur Kommandogewalt über das Land zu verhelfen und deren Gegnern den Garaus zu machen.
- Vom Krieg als Krieg zu sprechen, käme glatt einer Geringschätzung des wichtigsten Kriegszieles gleich:
„Es gehe um den zivilen Aufbau, um ‚vernetzte Sicherheit‘. Das Wort ‚Krieg‘ setze da einen völlig falschen Akzent.“ (Jung, Spiegel, 29.6.)
Mit der Erledigung des Gegners ist die Mission längst nicht beendet. Gelungene Weltordnung, wie man sie in Deutschland buchstabiert, vollendet sich erst im Aufbau „ziviler Strukturen“, vorrangig der Schaffung einer loyalen afghanischen Polizei und Armee, um dem Ziel einer „selbsttragenden Sicherheit“ näher zu kommen. Die „Sicherheit“, die „Deutschland am Hindukusch verteidigt“, verlangt ein Regime, das auch ohne die dauerhafte Präsenz auswärtiger Truppen dafür einsteht, dass Afghanistan wunschgemäß regiert wird.
- Außerdem soll es in Afghanistan, wie ein der Regierung zur Seite springender Oppositioneller zu berichten weiß, sogar Ecken geben, in denen keine Kriegshandlungen stattfinden, weswegen – ohne „Pauschalurteil“ – nun wirklich nicht von einem Krieg gesprochen werden kann:
„Es gibt kein passendes Wort für die Situation in Afghanistan. Es ist eine Gemengelage verschiedener Konfliktsituationen: vom Guerillakrieg in einzelnen Distrikten über Schwerstkriminalität bis hin zu Boomregionen … Das Etikett ‚Krieg‘ daranzuhängen hat sozusagen den Vorteil: Es klingt ehrlich. Aber als Pauschalurteil ist das auch falsch.“ (Nachtwei, Grüne, FAZ, 25.6.)
- Die Kennzeichnung des deutschen Einsatzes als Krieg könnte sogar unerwünschte Wirkungen zeitigen:
„Krieg würde auch betonen, dass den Taliban Kombattantenstatus zustünde. Tatsächlich aber seien sie ‚Verbrecher, Terroristen und Kriminelle‘.“ (Ministeriumssprecher, SZ, 25.6.)
Es ist zwar nicht ganz einzusehen, welchen Vorteil sich der Kriegsgegner von einem Aufstieg zum „Kombattanten“ versprechen sollte; Amerika jedenfalls hat kein Vermittlungsproblem zwischen seiner Rede vom „war in Afghanistan“ und der Definition seiner Feinde als „Terroristen“. In Deutschland hält man die säuberliche Unterscheidung zwischen der eigenen legitimen Erledigung von „Verbrechern“ und deren höchst illegitimer Gewalt hoch. Schließlich ist man per UNO-Mandat zur Kontrolle anderer Nationen befugt. Die Bezeichnung „Krieg“ für den eigenen Einsatz könnte eine ungewollte völkerrechtliche Aufwertung der Taliban mit sich bringen und die eigene Herabstufung zu einem gleichrangigen Kriegsgegner. Derlei Unschärfen müssen vermieden werden!
- Wer denen Vorschub leistet, muss wohl selber irgendwie „Taliban“ sein, wenn er auf deutschem Boden diese unselige Namensdebatte entfesselt:
„Krieg? Das hätten die Taliban gern ... Deshalb schüren die Taliban diese Diskussion bei uns.“ (Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Naumann, SZ, 1.8.)
Weswegen feststeht, dass diejenigen, die von „Krieg“ in Afghanistan reden, dem Feind als ideelle Kollaborateure in die Hände arbeiten:
„Ihnen ist auch völlig egal, dass ihr Beharren auf dem Wort Krieg für die Menschen in Afghanistan noch mehr Leid und für unsere Soldaten zusätzliche Gefahr bedeuten.“ (ebd.)
- Schließlich gebietet auch noch ein ganz ziviler Gesichtspunkt der Fürsorge für die eigenen Soldaten die Umgehung des umstrittenen Ausdrucks: Lebensversicherungen verweisen in Erwartung größerer Opferzahlen bereits aufs „Kleingedruckte“ in ihren Policen, in denen beispielsweise zwischen „passivem“ und „aktivem Kriegsrisiko“ unterschieden wird, und auf ihren Unwillen, in einem wirklichen Kriegsfall die bislang „kulant“ gehandelte Abwicklung von Schadensfällen fortzusetzen.
In konsequenter Umschiffung ihres wirklichen Motivs präsentiert die Regierung an lauter Nebenfronten gute Gründe, warum das „K-Wort“ zu vermeiden ist, während sie mit überwältigender parlamentarischer Rückendeckung – eine Ausnahme bilden die Linken – gleichzeitig und mit aller Entschlossenheit der Truppe ihren „Kampfauftrag“ erteilt.
*
Dieser berechnenden regierungsamtlichen Zurückhaltung in der Wortwahl kann die Öffentlichkeit überhaupt nichts abgewinnen. Wie besessen klären Rundfunkanstalten und Presse wochenlang von morgens bis spät in die Nacht hinein darüber auf, warum der deutsche Afghanistan-Krieg schnörkellos das Attribut „Krieg“ verdient.
Bild widmet gleich am Tag nach der Verkündung der jüngsten Todesfälle die Titelseite unter dem Motto Schon 35 Soldaten starben für Deutschland
(24.6.) einer ausführlichen Kriegsberichterstattung, nach deren Lektüre an der Einsatzbereitschaft und dem Opfermut deutscher Soldaten einerseits, an der Bestialität des Feindes andererseits kein Zweifel mehr bestehen kann. Dennoch fällt die Bilanz für Bild erschreckend aus:
„Insgesamt sind damit bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 81 deutsche Soldaten und Bundespolizisten ums Leben gekommen. Davon 35 in Afghanistan, wo die Bundeswehr in einem Krieg ist, den noch immer kaum ein Politiker so nennen will.“
Im Namen des Volkes und der kämpfenden Truppe nimmt die Zeitung die Politiker, die den Krieg gerade angeordnet haben, in die Pflicht. Sie schulden ihren Soldaten Anerkennung für deren Hingabe fürs Vaterland. Und diese Anerkennung realisiert sich in erster Instanz darin, die Größe der Aufgabe, vor der die Bundeswehr steht, beim Namen zu nennen: Krieg! Nicht nur in der Politik, im ganzen Land stellt Bild einen entscheidenden Mangel fest: Es fehlt an ein bisschen mehr Begeisterung für unsere Helden vor Ort. Stellvertretend der Wehrbeauftragte des Bundestages:
„Ich frage mich: Wo bleibt das klare Wort der Kirchen, der Gewerkschaften, der Wirtschaft? Das Bekenntnis: Unsere Truppe steht in Afghanistan in einem schweren Kampf – und wir stehen als Bürger und Staatsbürger fest zu ihnen. Das wäre ein Zeichen menschlicher Zuwendung.“ (Robbe im Interview mit Bild)
Der ganz normale Nationalismus des Volkes, der darin besteht, periodisch eine Regierung zu ermächtigen, ansonsten, meist unzufrieden, seinen Alltagspflichten nachzukommen und auch um einen Krieg kein weiteres Aufhebens zu machen, ist Bild einfach nicht genug. Im Krieg ist Bekenntnis zur Nation und ihrer kämpfenden Armee verlangt. Grußadressen und Beten für die Frontsoldaten, die sich treu und berechnungslos für Deutschland aufopfern, sind eine moralische Pflicht für jedermann in der modernen Zivilgesellschaft, mehr ideelle Anteilnahme am Krieg ein Gebot „menschlicher Zuwendung“. Bild arbeitet daran.
Auch bei der Süddeutschen hält man es für einen Skandal, dass nicht längst vom „Krieg“ gesprochen wird. Ihre Botschaft liest sie den Soldaten geradezu von den Lippen ab:
„In der Truppe wird die gestiegene Kampfbereitschaft der Bundeswehr überwiegend begrüßt, auch wenn es jetzt vermehrt Opfer geben sollte. Andererseits wünschen die Soldaten auch, dass nun allmählich in der deutschen Öffentlichkeit anerkannt wird, dass sie kein ‚bewaffnetes Technisches Hilfswerk‘ sind, wie häufig gespottet wurde, sondern dass sie sich in einem veritablen Krieg befinden.“ (SZ, 24.6.)
Weil die alten Titel, mit denen der Einsatz hierzulande jahrelang gerechtfertigt wurde, jetzt in Zweifel gezogen werden, sollen sie in der nunmehr ernsteren Lage der Truppe geradezu als ehrenrührig gelten. Krieg ist eben eine viel höhere Aufgabe, die durch die bis gestern gültige Sprachregelung einer „militärisch abgesicherten Aufbauhilfe“ heute ins Lächerliche gezogen und herabgewürdigt wird. Klar muss sein: Die Armee führt Krieg, ihre Kampfbereitschaft ist durch vermehrte Opfer nicht zu erschüttern, die Moral der Truppe steht also wie eine Eins. Dafür darf sie mit Fug und Recht die Anerkennung „der deutschen Öffentlichkeit“ beanspruchen.
Kritik an der Führung wegen ihrer Verweigerungshaltung gegenüber dem „K-Wort“ ist daher an der Tagesordnung. Anwürfen derart, sie ließe es gegenüber der Truppe an Würdigung ihrer Leistungen mangeln, will die Regierung – bei weiterer konsequenter Vermeidung des umstrittenen Terminus – nicht auf sich sitzen lassen: Den ums Leben gekommenen Bundeswehrsoldaten wird schon seit geraumer Zeit die Ehre zuteil, „gefallen“ zu sein; und als Symbol der Ehrerbietung gegenüber dem soldatischen Heldenmut im Kampf für Deutschland wird eigens ein neuer Orden spendiert.
Mit der demonstrativen Anerkennung der Leistungen ihrer Streitmacht auf dem Feld der Ehre ist die Bundesregierung allerdings noch lange nicht aus dem Schneider. Einige Stimmen versteigen sich glatt zu der Befürchtung, sie würde ihren Krieg, bloß weil sie nicht Krieg dazu sagt, im politischen Blindflug
(taz, 1.7.), jedenfalls nicht ernsthaft und professionell genug führen. Im Eifer des Gefechts hält der Spiegel einen Moment lang glatt den ganzen Streit um Worte selbst für schädlich:
„Für Soldaten, die in stundenlangen Gefechten um ihr Leben kämpfen, klingt diese Debatte ohnehin hohl. Sie schießen, töten, sterben. Etwas anderes als das Wort Krieg würde ihnen dazu nicht einfallen … Die Deutschen dürfen erst schießen, wenn ihr Leben bedroht ist. Mussten sie warten, bis die Taliban sie angreifen? Oder gar auf sich aufmerksam machen, damit der Gegner angreift und das Gefecht endlich beginnen kann? Wurden die Soldaten also aufgrund juristischer Bedenken der Einsatzleitung zu Zielscheiben? … Das völkerrechtliche Mandat eröffnet einen größeren Spielraum. … Die Deutschen unterwerfen sich strengeren Regeln … Für amerikanische und britische Truppen gehören Töten und Sterben selbstverständlich zum Einsatz in Afghanistan.“ (Spiegel)
Da lassen sich erst einmal alle möglichen Gesichtspunkte ausmalen, unter denen der Erfolg der deutschen Kriegführung leiden könnte, von der Behinderung der Kampfkraft der Truppe durch überzogene juristische Auflagen, über die falsche Auslegung des eigenen Mandats bis hin zu unangemessener Zurückhaltung beim „Töten und Sterben“, bevor nach einer Erörterung der Vor- und Nachteile eines Einsatzes von Haubitzen, schweren Panzern und Fluggerät aller Art Entwarnung gegeben werden kann:
„Am Ende könnte der bessere Schutz der Soldaten ins Gegenteil umschlagen, weil der Rückhalt in der Bevölkerung verloren geht … Die ausländischen Truppen sollten lieber einmal darauf verzichten, Bombardements durch Kampfflugzeuge anzufordern, und sich zurückziehen, wenn Kollateralschäden drohten. Eine Strategie, mit der die Deutschen bislang gute Erfahrungen gemacht haben.“ (Spiegel)
Letztlich versteht die Bundesregierung ihr Kriegshandwerk also doch!
Damit ist für den Spiegel allerdings die Debatte um die passende Sprachregelung keineswegs beendet. In dem Bemühen, das K-Wort zu vermeiden, entdeckt er, was er gar nicht leiden kann: Feigheit vor dem Volk.
„Die deutschen Politiker, die die Soldaten nach Afghanistan schicken, tun lieber so, als wäre dies ein Polizei- und Entwicklungshilfeeinsatz. Denn sie wissen, dass das Mandat in der Bevölkerung unpopulär ist. Gleichwohl sind sich alle Parteien im Bundestag, mit Ausnahme der Linken, bislang einig, Afghanistan aus dem Wahlkampf herauszuhalten.“ (Spiegel)
Dass das Volk zu mehr Einsicht ins Notwendige hin erzogen werden muss, hat auch die FAZ entdeckt:
„Die wachsende Abneigung der deutschen Bevölkerung gegen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan lässt sich im Kern auf einen Grund und auf eine Ursache zurückführen. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben sich bei den Deutschen in einer pazifistischen – oder antimilitärischen – Grundhaltung niedergeschlagen; sie lehnen ‚Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln‘ geradezu instinktiv ab. Die militärische Intervention in Afghanistan hat nach dem Sturz der Taliban die Illusion genährt – nicht nur in Deutschland, auch in Amerika –, die Terrornester von Al Kaida könnten in einem Blitzkrieg ausgeräuchert werden, und der Neuaufbau des Landes sei dann eine friedliche Aufgabe … Unter diesen Voraussetzungen hat sich auch die Bundeswehr am Hindukusch engagiert.“ (FAZ, 4.7.)
Da müssen die Frankfurter Experten für Meinungsbildung aber einmal hart mit ihrem Volk ins Gericht gehen: Es ist vollkommen verweichlicht, hält es gar nicht gut aus, dass man ihm eine klare Kriegsansage präsentiert, ist bestenfalls für einen Blitzkrieg zu haben und prompt mies gestimmt, wenn er ein bisschen länger dauert als geplant. Mitschuld daran trägt die Regierung selbst: Bei der Halbherzigkeit, mit der sie selbst in den Krieg eingestiegen und ihn entsprechend verkauft hat, braucht man sich über kriegsuntaugliche „Grundhaltungen“ nicht zu wundern; wenn man dem Volk etwas Verkehrtes erzählt, dann reagiert es auch verkehrt. Dass aber Deutschlands Sicherheit weiterhin am Hindukusch verteidigt werden
muss (a.a.O.), steht fest. Also ist das Volk entsprechend darauf einzustimmen.
Wie man das macht, weiß auch die Süddeutsche Zeitung:
„Nur wenn die Regierung ihre Afghanistan-Politik offensiver vertritt, bleibt sie unangreifbar … Die neue Aggressivität der Taliban ist seit Monaten zu beobachten. Doch der Bundesregierung fehlte der Mut, ihre Afghanistan-Politik trotz aller Wahlkampf-Gefahren offensiver zu vertreten. Nun bleibt ihr nicht viel anderes übrig als die Flucht nach vorne. Dies ist manchmal die letzte, sinnvolle militärische Bewegung.“ (SZ, 6.7.)
In Kriegsfragen ist nicht Verdruckstheit, sondern Ehrlichkeit geboten. Das Volk ist nämlich an und für sich vernünftig und für die Großtaten der Nation zu gewinnen, wenn man ihm nur reinen Wein einschenkt, ihm den Krieg, dessen Risiken und Erfolgsperspektiven offen erläutert, ein wenig Feindbildpflege betreibt und es darauf vorbereitet, dass vor der Wahl mit Terrorangriffen zu rechnen ist. Dann ist wenigstens die Regierung „unangreifbar“ und der Wahlkampf für die Führung und ihre Militärmission keine „Gefahr“ mehr. Wer seinen Krieg daheim so „offensiv vertritt“, der kann dann auch die Offensive gegen die Feinde der Freiheit am Hindukusch munter in Angriff nehmen.