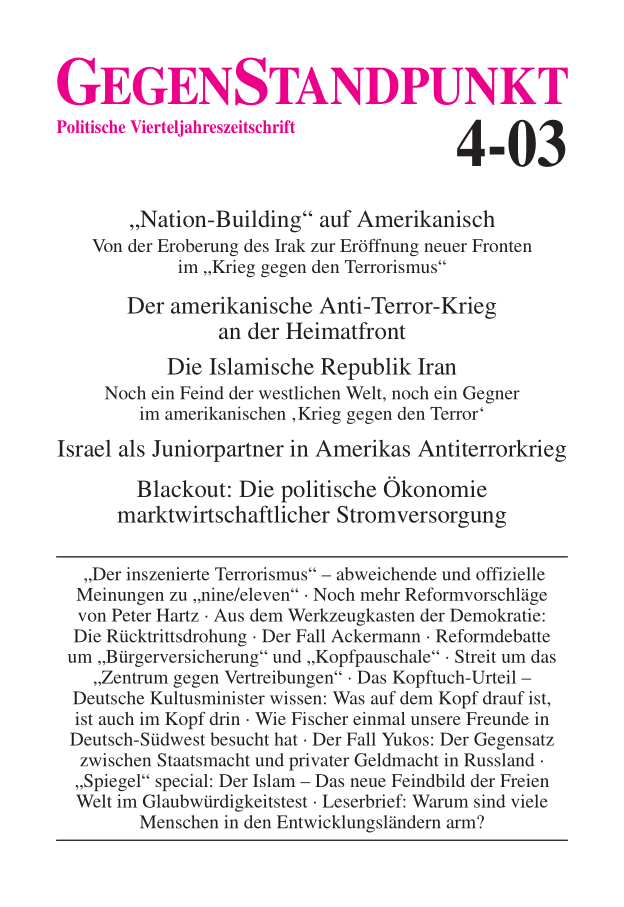Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Das Kopftuch-Urteil:
Deutsche Kultusminister wissen: Was auf dem Kopf drauf ist, ist auch im Kopf drin
Der Staat verpflichtet sich zwar zur Neutralität in weltanschaulichen Fragen und gewährt Religionsfreiheit, aber er weiß den Wert der abendländisch-christlichen Religion als Ausdruck der gewünschten öffentlichen Moral und Sittlichkeit zu schätzen. Andere Religionen stehen zumindest im Verdacht, einer „fremden“ höheren Gemeinschaft zu dienen. Die deutschen Schulen stellen als Hort der Bildung von richtiger staatsbürgerlicher Gesinnung besondere Anforderungen an die Prinzipienfestigkeit und Loyalität ihres Lehrkörpers. Deshalb gilt ein Bekenntnis zu nichtkonformer Religion und Landestracht als Bekenntnis zu einer politischen Gesinnung, die gegen die freiheitliche Grundordnung gerichtet ist und ein Berufsverbot rechtfertigt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Das Kopftuch-Urteil:
Deutsche Kultusminister wissen: Was
auf dem Kopf drauf ist, ist auch im Kopf drin
Die „Neutralitätspflicht“ des Staates in „religiösen und weltanschaulichen Fragen“ geht deutschen Schulpolitikern über alles. Frei von „gezielter Beeinflussung“ im Sinne einer „bestimmten weltanschaulichen Richtung“ habe die Schule ihrem „Erziehungsauftrag“ zu folgen. Darum verweigert das Stuttgarter Schulamt einer deutschen Pädagogin afghanischer Herkunft die Aufnahme in den Schuldienst. Die Lehrerin in spe Fereshta Ludin besteht ihres muslimischen Glaubens wegen darauf, auch während des Unterrichts ein Kopftuch zu tragen und verstößt damit nach Ansicht der Schulbehörde gleich mehrfach gegen die ihr aufgetragene Dienstpflicht. Nicht nur sei die Kleiderordnung, die Ludin aus religiöser Überzeugung so am Herzen liegt, „Zeichen für das Festhalten an Traditionen der Herkunftsgesellschaft“ und damit Ausdruck einer „kulturellen Desintegration“. Das Kopftuch – unübersehbares Attribut eines von den sonst üblichen religiösen Gebräuchen abweichenden Bekenntnisses – steht darüber hinaus im Verdacht, der „Versuch einer Beeinflussung oder gar Missionierung der anvertrauten Schulkinder“ zu sein. Grund genug für das Baden-Württembergische Kultusministerium, Ludins „persönliche Eignung“ für das Lehramt zu bezweifeln.
Dankenswerter Weise geben die Hüter des staatlichen Erziehungsmonopols damit über die Grundsätze ihres Erziehungsauftrags in schöner Klarheit Auskunft: Deutsche Schulen haben dem Nachwuchs zuvörderst die geistige Identität des deutschen Volkes zu vermitteln. Abweichende Bekleidung, einem fremden Kulturkreis geschuldet und sichtbare Darstellung einer fremdartigen Gesinnung, ist mit ordentlicher Nationalerziehung unverträglich; eine Lehrerin, die auf ein fremdartiges Erscheinungsbild so großen Wert legt, ist damit „ungeeignet“ für eine solche „identitätsstiftende“ Erziehung. So bringt der Staat auch auf den Begriff, was ihn an Ausländern aller Herren Länder schon immer stört: Sie stehen im generellen Verdacht einer zumindest gespaltenen Loyalität, wenn nicht sogar im Verdacht der Parteinahme für eine fremde, nämlich ihre ursprüngliche Herrschaft. Wer sich den Ehrentitel eines deutschen Staatsbürgers verdienen will, hat zu aller erst einmal seinen „Integrationswillen“ unter Beweis zu stellen, statt bis hinein in Kleiderfragen eine Parteinahme für ein „Herkunftsland“ und damit „Abgrenzung“ zu demonstrieren. Wenn es dann gar noch um seine staatlichen Lehrbeauftragten geht, darf die ausreichende Loyalitätsbekundung zur Herrschaft made in Germany erst recht nicht bloßes „Lippenbekenntnis“ sein. Als Hort der Bildung von richtiger staatsbürgerlicher Gesinnung stellt die Schule besondere Anforderungen an ihren Lehrkörper: Der hat in seinem Auftreten und Lehren eben die Prinzipienfestigkeit zu unserer einheimisch deutschen Sittlichkeit zu vermitteln, die man vom deutschen Nachwuchs erwartet und zu der man ihn erziehen will. Wo fremde Sitten walten ist deutsche Gesinnung in Gefahr – und wo Lehrer sich zu fremder Sitte bekennen wollen, beschleicht den Staat ein hässlicher Verdacht.
Denn es ist schon auffällig, dass das baden-württembergische Schulamt der Muslimin Ludin genau das unterstellt, was es von ihr als Lehrerin – nur mit anderem Vorzeichen – erwartet: „Indoktrination“. Ihr Bekenntnis zur fremdartigen Moralität und die Hartnäckigkeit, mit der sie auf ihrer korantreuen Gewandung besteht, beweisen dem argwöhnischen Auge des Wächters über die Gesinnungsproduktionsanstalt Schule, dass sie als „Missionar“ in falscher Sache unterwegs ist. „Ohne weltanschauliche Überzeugung“ sollen die unschuldigen Kindlein ja ganz und gar nicht aufwachsen – aber es hat schon die Sittlichkeit „unseres“ abendländischen Wertekanons und freiheitlicher Grundordnung zu sein, für die jeder loyale Lehrer die ihm „anvertrauten Schulkinder“ zu „missionieren“ hat. Dass eine kopftuchtragende Lehrerin diese einschlägige Gesinnungsfestigkeit nicht nur nicht vermitteln kann, sondern ganz sicher auch nicht vermitteln will, gilt schon allein deswegen als ausgemachte Sache, weil sie sich der eindeutigen Dienstanweisung, kopftuchlos im Unterricht zu erscheinen, so „intolerant“ widersetzt.
Die Pädagogin Ludin, obwohl ansonsten völlig „unauffällig“ in ihrer bisherigen Schulkarriere, beharrt auf ihrem halben Quadratmeter Stoff, beschreitet ebenso ausdauernd einen jahrelangen Klageweg durch sämtliche Instanzen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht und beweist damit dem von ihr gewünschten Dienstherren nur eines: Wie nahe bei solchem Starrsinn sein Verdacht liegt, ihr ginge es doch wohl ganz sicher nicht bloß um ein „privat gelebtes Symbol“, sondern wohl eher um unerlaubte Beeinflussung der Schulkinder mit einer Lehre, die hier eigentlich ausgegrenzt ist, und – wenn sie sich so „intolerant“ wie Ludin zeigt – auch geradezu ausgegrenzt gehört.
Das aber ist gerade rechtlich umstritten und soll vom Verfassungsgericht geklärt werden: In ihrem Kopftuch sieht Fereshta Ludin einen „unverzichtbaren Teil ihrer persönlichen Glaubensidentität“. Sie nimmt für sich also das Privileg der Religionsfreiheit in Anspruch; ein Verbot „verletze“ demnach ihr „Persönlichkeitsrecht auf freie Religionsausübung“. Ludin stellt ihrem zukünftigen Arbeitgeber also die Gretchenfrage: „Wie hältst du’s mit der Religion?“ Und damit wird die Sache kompliziert.
Die Demokratie hat nämlich nichts gegen den Herrgott und auch Allah ist zuallererst einmal eine durchaus ehrbare Form des Glaubens an eine fiktive Allmacht. Gläubige Menschen, denen der Allerhöchste persönlich die Notwendigkeit des Opfers und der Willfährigkeit gegenüber der Obrigkeit aus der Menschennatur der Gotteskinder weismacht, geben keine schlechten Untertanen ab. Die Vorstellung eines höchsten Richters über Himmel und Erde und die Deutung all der mittelprächtigen Erfahrungen des irdischen Daseins als dessen Werk und Wille, die alle „großen monotheistischen Weltreligionen“ eint, leisten einen durchaus funktionalen Beitrag zur rechten Gesinnung der Staatsbürger. Auf diese allerhöchste Sittlichkeit soll auch in modernsten Zeiten und in der Schule schon gleich nicht verzichtet werden. Als Ausdruck von öffentlicher Moral und Übereinstimmung der Person mit einer höheren Gemeinschaft bekommt die Religion vom Staat eine durchaus gewichtige Rolle eingeräumt. Doch jedes höchstpersönlich gewählte Glaubensgebäude nebst seinen Imperativen und Techniken eines hochanständigen Lebenswandels hat Privatsache zu bleiben. Als begleitende Deutung, die bei aller frommen Weltsicht nicht aus den Augen verliert, wo die Pflichten und Loyalitäten der Gläubigen außerhalb des Gottesdienstes zu liegen haben; als relativiertes Bekenntnis also, dem man in seiner Privatsphäre Folge leistet, ansonsten aber „die Kirche im Dorf“ lässt, bekommt religiöse Sinnstiftung, in all ihrer schillernden Vielfalt, ihre staatlich verbürgte Überlebensgarantie.
Dies freilich ist ein gewisser Widerspruch zur Religion. Ihrer Natur nach ist jede Religion das ziemliche Gegenteil von Privatsache: Da hat man schon mal einen allein selig machenden Glauben, einen einzigen und wahren Herrgott, bekennt sich zu einem Kollektiv der Glaubensbrüder und -schwestern, tritt demnach auch in aller Öffentlichkeit als Kollektiv auf, singt, betet, veranstaltet Umzüge und macht bei jeder sich bietenden Gelegenheit (unter Zuhilfenahme von Kirchenglocken also jede Viertelstunde) ideologischen Lärm. Und daneben soll eben dieser Glaube sich trotzdem als einer begreifen, der letztlich nur im stillen Kämmerlein zu Haus ist? Der über die persönliche Überzeugung hinaus kein Recht für sich beansprucht, alle anderen und abweichenden Götter neben sich duldet und bei Meinungsverschiedenheiten z.B. zwischen Altem Testament und Bundesgesetzgebung, im Zweifelsfalle nicht darauf beharrt, was der Herr sagt?
Es ist schon eine ziemliche Zumutung, die der demokratische Staat einem von der Glaubenswahrheit durchdrungenen Menschen da auferlegt. Gleichwohl hat er mit seinen beiden christlichen Kirchen dabei gute Erfahrungen gemacht. Es hat zwar ein paar Jahrhunderte und ebenso viele „Glaubenskriege“ gebraucht. Dann aber hatten die Vertreter der Christenheit die Kröte geschluckt, Religion als Privatvergnügen zu handhaben. Sie haben sich in der modernen Welt aufs Trefflichste eingenistet, handhaben ihren Glauben entsprechend berechnend und betätigen sich als Hüter der öffentlichen Moral, die alle Herrschaftsdienste, für die ein braver Gläubiger in seinem Erdenleben so vorgesehen ist, nicht nur nicht behindert, sondern wundersam ergänzt. Dafür haben sie ja schließlich auch als „irdischen Lohn“ ein paar handfeste Privilegien, nicht zuletzt kassieren sie die staatlicherseits großzügig eingetriebene Kirchensteuer. Was in einem angeblich „agnostischen Zeitalter“, in Zeiten der frei flottierenden Sinnsuche und -angebote auch nicht gerade gering zu schätzen ist.
Und darum ist es dann natürlich andererseits auch mit der „Neutralität“ des Staates in Sachen Religion nicht so weit her, wie gern behauptet wird. Im immer wiederholten Bekenntnis zur „abendländisch-christlichen Tradition“ gibt der demokratische Staat kund, dass er sehr genau weiß, was er an seinen Kirchen hat: Bei uns „einheimisch“ ist die Religion, die sicher, zuverlässig und erprobt die hier erwünschte Sittlichkeit anerkennt, dann aber auch repräsentiert und verkörpert; der Glaube, der eine Überhöhung des Nationalismus darstellt und als schmückendes Beiwerk der demokratisch regierten Verhältnisse fungiert. Was der Staat an seinen Muslimen hat, ist derzeit – höflich ausgedrückt – noch nicht erprobt, sondern unterliegt ganz im Gegenteil einem Verdacht nach Logik des Verfassungsschutzes. Zwar will niemand den 3,7 Millionen Gläubigen, die sich auf deutschem Boden tummeln und dabei zum Islam bekennen, das Recht absprechen, sich nach ihrer Fasson einer höheren Gemeinschaft im Glauben zuzurechnen. Nur ist es eben nicht „unsere“ höhere Gemeinschaft und das macht sie per se verdächtig.
So verbietet der Staat zwar niemandem, in einem freigewählten Manitu sein höchstpersönliches „Weiß warum“ zu finden, hat aber schwer etwas dagegen, wenn abweichende Religionsbekenntnisse, die er erlaubt, an falscher Position demonstriert werden. Die im Christentum verobjektivierte Sittlichkeit, die hierzulande gelten und zu der in der Schule erzogen werden soll, verträgt keine Relativierung durch nichtetablierte Wertekataloge. Wie soll die Schule „moralisch gefestigte Individuen“ ins staatsbürgerliche Leben entlassen, wenn jeder Schulmeister mit einem anderen Wert auf dem Haupte herumläuft? Die Gefahr abweichender Indoktrination durch solche „fremden Glaubensbekundungen“ muss von den Schulkindern zur „Wahrung ihrer Glaubensfreiheit“ abgewendet werden. Wer zur „Toleranz erziehen“ wolle, und dies sei nun einmal die Aufgabe eines Lehrers, müsse sie „vorleben“, also auf sein religiöses Symbol verzichten können – so das Baden-Württembergische Schulamt, das den kleinen aber feinen Unterschied zwischen Kopftuch und Nonnenschleier kennt und schätzt.
Und ganz ins Leere geht dieser Unterscheidungswille ja tatsächlich nicht. Denn auch Fereshta Ludin, die gegen diese „Diskriminierung ihres Religionsbekenntnisses“ bis zur allerhöchsten Rechtsinstanz kämpft, kommt es ja auf ein wenig mehr an als auf die Verteidigung eines farbenfrohen Accessoires. Ihr liegt an der grundsätzlichen Berechtigung ihrer Glaubens- und Wertewelt in einer Gesellschaft, die doch immerhin das Privileg der Religionsfreiheit an hohe Stelle gesetzt hat. Im jahrelangen Rechtsstreit stellt sie den Antrag auf die prinzipielle rechtliche Anerkennung ihres öffentlich demonstrierten Glaubensbekenntnisses als zulässige und gewürdigte Sittlichkeit, mit Vorbilds- und Verbindlichkeitscharakter – eine Probe aufs Exempel also, an deren Ende im Idealfall eine Gleichstellung des muslimischen Glaubens mit der Dauerpräsenz der christlichen Kirchen in der Nation stünde.
Beide Seiten bestehen also darauf, dass das Kopftuch eine Demonstration ist: Für den Staat ist es eine Proklamation falscher sittlicher Imperative, für Ludin und die sie unterstützende muslimische Gemeinde, der praktizierte Antrag auf Gleichberechtigung ihres religiösen Gebäudes und dessen politischer Anerkennung als Institution – ganz nach dem Vorbild der christlichen Propagandainstanzen und ihres ersprießlich guten Verhältnisses zur politischen Gewalt.
Das Bundesverfassungsgericht schließlich entscheidet salomonisch: „Ohne Rechtsgrundlage“ kann der muslimischen Beschwerdeführerin das Tragen ihres Kopftuches im Schuldienst nicht untersagt werden. „Dem zuständigen Landesgesetzgeber steht es jedoch frei, die bislang fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen, etwa indem er im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben das zulässige Maß religiöser Bezüge in der Schule neu bestimmt.“ (BVerfG 24.9.03)
Damit bestreitet das Oberstes Gericht also keineswegs, dass ein Verdacht gegen bekennend andersgläubige Lehrer begründet sei: Nur vermisst es die für seine Vollstreckung, sprich für die Verweigerung der Aufnahme der Kopftuchträgerin in den Schuldienst, eindeutige Rechtsgrundlage. Ein geeignetes Gesetz zur Einschränkung der Religionsfreiheit von Lehrern und sonstigen Beamten gibt es derzeit noch nicht – es muss erst noch geschaffen werden. Zum gegenwärtigen Stand der Rechtsdinge ist ein Kopftuch noch nicht notwendig ein Bekenntnis zur falschen Ordnung – ob es das ist, muss erst die zukünftige Gesetzeslage entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht spielt den Ball also zurück ins Lager der Bundesländer und erteilt deren Juristen den Auftrag zu definieren, wann ein religiöses Symbol nur der Ausdruck eines subjektiven Bekenntnisses ist und wann Indiz des Willens zu religiös-moralischer Indoktrination. Die Schule hat die Wahrung der Sittlichkeit zu gewährleisten – wie viel an Religion und ihren Symbolen dabei sein darf, wie viel Persönlichkeitsrechte in Sachen „religiöser Überzeugung“ die Länder ihren Lehrern zugestehen oder einschränken wollen, bedarf einer rechtlichen Neudefinition. Das Gericht billigt das Bedürfnis der Bundesländer fremdartige Glaubensbekundungen aus dem Lehramt zu verbannen also voll und ganz und erteilt ihnen den Auftrag, ihr Bekenntnis zur Parteilichkeit in geeignete Gesetzesform zu gießen. Selbstverständlich unter Wahrung der „Neutralitätspflicht des Staates“: Es gilt, unter Anerkennung der „Gleichheit der Religionen“ nur die falschen Symbole zugunsten der richtigen zu verbieten, ohne dabei jemanden zu „diskriminieren“.
Die Bundesländer melden sich schlagartig zurück. Schon kurze Zeit später macht Baden-Württemberg die einstweilige Lösung der „Kopftuchfrage“ vorstellig:
„Das Kopftuch steht nicht nur für Religion, sondern ist auch Zeichen der politischen Unterdrückung im Islam. Das gilt nicht für christlich-abendländische Bildungs- und Kulturwerte, die vom Schulgesetz ausdrücklich gedeckt sind.“ (Schavan)
„Unpolitisch“ und damit vom grundgesetzlich verbürgten Recht auf Religionsfreiheit gedeckt, ist nur die Religion, die auch Propaganda für unsere einheimischen Werte ist. Alle anderen, davon abweichenden Bekenntnisse zeugen demnach von einer Distanz zu diesem Wertekanon, bekommen den Bonus der privaten Glaubenssache also gar nicht erst zugesprochen, sondern werden gleich als politische Aufwiegelung gegen unsere „freiheitlichen Grundordnung“ ins Visier genommen.
Mit der Definition des Kopftuchs als vorrangig nicht religiöser, sondern politischer Stellungnahme schreitet Baden-Württemberg zur neuesten Auflage des Radikalenerlasses. Nach Maßgabe seines Beamtenrechts hat dem Staat ja schon immer ein Eingreifen in die Privatsphäre und Grundrechte seiner Staatsdiener zugestanden: „Der Grundrechtsausübung des Beamten im Dienst können Grenzen gesetzt werden, die sich aus allgemeinen Anforderungen an den öffentlichen Dienst oder aus besonderen Erfordernissen des jeweiligen öffentlichen Amtes ergeben“ (BVerwGE 56, 227, 228f.). Der Staat hat Anspruch auf die ungeteilte Loyalität seiner verbeamteten Diener – wegen des besonderen „Näheverhältnisses“ zu ihm. Lehrer sind zur Parteilichkeit für die von ihrem Dienstherrn gewünschte Indoktrination verpflichtet. Daraus folgt umgekehrt, dass jede andere als die fällige Indoktrination einen Fall von Amtsmissbrauch darstellt. In Ausübung einer staatlichen Tätigkeit, die ihrer Substanz nach für die Vermittlung der hohen und allerhöchsten Werte steht, gilt deswegen ein Bekenntnis zu nichtkonformer Religion und Landestracht als Bekenntnis zu einer politischen Gesinnung, die den „Boden der freiheitlichen Grundordnung“ verlässt – und ist damit alle Mal Grund genug für ein Berufsverbot.
So gelingt es dem Landesgesetzgeber, am Kopftuch entlang zu definieren, was man der Textilie an sich gar nicht anzusehen vermag: Es ist ein Statement gegen „Menschenwürde, Gleichberechtigung und Freiheitsgrundrechte“ und damit die Brutstätte verfassungsfeindlicher Ambitionen. Das Kopftuch – ein antidemokratischer Umtrieb: „Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrkraft gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt.“ Wer als störend empfunden werden kann – stört! Und dass ein fremdartiger Kopfputz „Konflikte stiften“ kann, dafür ist dann im Zweifelsfalle ja noch jeder randalierende Neo-Nazi der leibhaftigste Beleg.