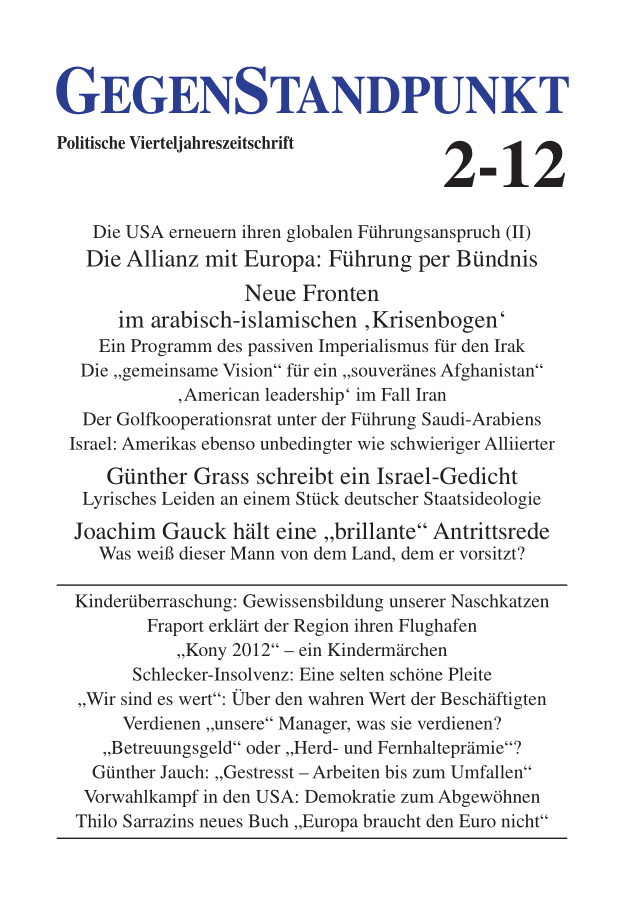Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
„Kony 2012“ ein Kindermärchen – oder:
Wie die Internet-Community gegen das Böse kämpft und was die offizielle vierte Gewalt daran auszusetzen hat
„Invisible Children“ (IC), eine Non-Profit-Organisation aus den USA unter der Leitung von Jason Russell, stellt einen Film ins Internet über sich und ihre Kampagne, die darauf zielt, dem Treiben des ugandischen Milizen- und Sektenführers Joseph Kony ein Ende zu machen. Nach wenigen Tagen wird „Kony 2012“ zum „viralsten Video“ aller Zeiten (NZZ) mit mehreren Millionen „Views“ in Facebook, Youtube und Vimeo. Es herrscht weitverbreitetes Erstaunen darüber, dass ein politisches Thema solche Aufmerksamkeit im Internet erregt, vor allem unter den jüngeren Usern. Schüler drängen ihre PoWi-Lehrer zu Diskussionen über den Fall Kony; die Lehrer freuen sich über so viel Interesse von ihrer ansonsten politisch desinteressierten Schüler-Klientel.
Doch kurz nach dem Erscheinen des Films im Netz hagelt es von allen Seiten Kritik – sowohl an dem Video als auch an den Absichten und der Organisationsweise von Invisible Children. Weltweit sieht die Presse darin eine eher unverantwortliche Kampagne, Lehrer in deutschen Klassenzimmern reden sogar von „Manipulation“ und einem neuen, besorgniserregenden Teenie-Trend.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Gliederung
„Kony 2012“ ein Kindermärchen – oder:
Wie die Internet-Community gegen das Böse kämpft und was die offizielle vierte Gewalt daran auszusetzen hat
„Invisible Children“ (IC), eine Non-Profit-Organisation aus den USA unter der Leitung von Jason Russell, stellt einen Film ins Internet über sich und ihre Kampagne, die darauf zielt, dem Treiben des ugandischen Milizen- und Sektenführers Joseph Kony ein Ende zu machen. Nach wenigen Tagen wird „Kony 2012“ zum „viralsten Video“ aller Zeiten (NZZ) mit mehreren Millionen „Views“ in Facebook, Youtube und Vimeo. Es herrscht weitverbreitetes Erstaunen darüber, dass ein politisches Thema solche Aufmerksamkeit im Internet erregt, vor allem unter den jüngeren Usern. Schüler drängen ihre PoWi-Lehrer zu Diskussionen über den Fall Kony; die Lehrer freuen sich über so viel Interesse von ihrer ansonsten politisch desinteressierten Schüler-Klientel.
Doch kurz nach dem Erscheinen des Films im Netz hagelt es von allen Seiten Kritik – sowohl an dem Video als auch an den Absichten und der Organisationsweise von Invisible Children. Weltweit sieht die Presse darin eine eher unverantwortliche Kampagne, Lehrer in deutschen Klassenzimmern reden sogar von „Manipulation“ und einem neuen, besorgniserregenden Teenie-Trend.
I. Der Film
dauert 30 Minuten – „für ein Internetvideo ein Epos“ (Zeit-Online) – und stellt die Entstehungsgeschichte von IC, ihrem Kampf gegen Kony und dem Film selber dar. Laut Russell geht es bei dieser Öffentlichkeitskampagne gegen den Milizenführer im Busch um nichts weniger als eine Bewährungsprobe für die Menschheit, um ein Experiment,
ob die vielen kleinen Leute, die den Film sehen und „sharen“, den Verlauf der Geschichte der Menschheit verändern
können. Aber
, so ermahnt Russell sein Netz-Publikum, damit es funktioniert, muss man die nächsten 27 Minuten lang aufpassen.
Der Film beginnt mit einer sehr interessierten Lesart dessen, was die Menschen eigentlich sind und tun, wenn sie sich im Internet – vor allem bei Facebook – herumtreiben: Sie sind die Mitglieder einer weltweiten Community, deren Größe jede Nation und die gesamte Weltbevölkerung von vor 200 Jahren übersteigt. Den Filmemachern ist es egal, was diese Menschen sonst noch sind und treiben, was sie von der Welt und voneinander halten, ob sie in der wirklichen Welt tatsächlich gemeinsame Interessen verfolgen oder eher in Konkurrenz zueinander stehen bzw. gestellt werden. Ganz getrennt davon und ob sie es wissen oder nicht: Laut IC pflegen sie mit ihrer Mitgliedschaft bei Facebook und ihrer Präsenz in der Online-Welt eine Gemeinschaft, die viel tiefer gründet, und zwar auf das größte Bedürfnis der Menschheit
, nämlich dazuzugehören und miteinander verknüpft zu sein.
Die Menschen mögen denken, sie würden miteinander bloß lustige Bilder, rührende Videos und Nachrichten austauschen, die sie gerade interessant finden – der Film klärt sie auf: Indem sie das tun, indem sie sich für alles Mögliche und Menschliche mehr oder weniger flüchtig interessieren und es andere wissen lassen, teilen und verfolgen sie ein echtes gemeinsames Interesse, überhaupt das Interesse, das den Menschen auszeichnet: zusammen und im Kontakt mit anderen Menschen Mensch zu sein. Das ist zwar eine alberne Abstraktion davon, wie die Menschen es innerhalb und außerhalb der virtuellen Realität des Internets miteinander zu tun haben. Doch der Sinn dieser fiktiven Gemeinschaft liegt in dem Auftrag, den die Filmemacher ihr zugedacht haben: Als eine Gemeinschaft von Menschen für Menschen teilen sie einen gemeinsamen Willen zur Bekämpfung des Unmenschlichen auf der Welt. Und dass die Menschen, die in der virtuellen Welt des Internets täglich über was auch immer kommunizieren, in der reellen Welt eine wirkliche Macht sind, mit der man zu rechnen hat – das zeigen Bilder von den sogenannten „Facebook-Revolutionen“ in Nordafrika: Wir teilen, was wir lieben, und es erinnert uns daran, was wir gemeinsam haben. Und diese Verbindung verändert die Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Regierungen geben sich Mühe mitzuhalten...Das Spiel hat neue Regeln.
Mit dieser ansehnlichen Macht kommt allerdings größte Verantwortung; so fordert Russell sein Publikum heraus: „Ihr fragt euch vielleicht: Wer seid ihr schon, dass ihr einen Krieg beenden könntet? Ich bin hier, um euch zu sagen: Wer seid ihr, dass ihr es nicht könntet?“
*
Der Krieg, den Russell meint, findet in einer weit abgelegenen Ecke von Afrika statt. Der Film führt uns Bilder aus dem Norden Ugandas vor: Kinder, die nachts aus ihren Dörfern in die Städte fliehen, weil sie sich vor nächtlichen Angriffen von Joseph Kony und seiner „Lord’s Resistance Army“ (LRA) fürchten; dort schlafen sie zu Hunderten auf engstem Raum und kehren jeden Morgen in ihre Dörfer zurück. Man erfährt, dass Kony und die LRA seit gut 26 Jahren recht häufig Dörfer überfallen und die dort lebenden Kinder zwangsrekrutieren – die Mädchen als Sexsklaven und die Jungen als Soldaten. Man sieht die verstümmelten Gesichter von Dorfbewohnern und lernt, dass die LRA die entführten Kinder dazu zwingt, ihre eigenen Eltern umzubringen. Wir lernen Jacob kennen, einen ehemaligen Kindersoldaten Konys, dessen Bruder von der LRA vor seinen Augen ermordet wurde. Er sagt, er würde lieber selber sterben, als weiterhin so leben zu müssen.
Die Verhältnisse, in denen so etwas zum Alltag gehört; was in diesen Ländern los ist, wenn solche Figuren sich dort herumtreiben – das sind für die Macher von „Kony 2012“ keine relevanten Fragen, jedenfalls keine, die sie ihrem Publikum zumuten möchten. Es dürfte ihnen schon bekannt sein, dass Kony kein so einzigartiger Fall ist und dass solche Kleinarmeen in ganz Zentralafrika und nicht nur dort unterwegs sind, in aller Regel mit Kindersoldaten. Aber für das, worauf es ihnen ankommt, ist die Frage nach dem Grund dieser Sorte Gewalt fehl am Platz; für ihr Anliegen ist die ahnungslose Perspektive eines kleinen Kindes viel geeigneter. Russell setzt seinen fünfjährigen Sohn an den Tisch und fragt ihn, ob er denn weiß, was sein Vater eigentlich beruflich macht; die Antwort des Kindes, Papa würde die Bösewichte aus Star Wars bekämpfen, erfordert keine große Korrektur, nur einen anderen Namen und ein Gesicht. Russell schiebt dem Kind, stellvertretend für das Internet-Publikum, ein Bild von Joseph Kony unter die Nase und damit ist alles geklärt: Kony ist der Böse – mehr braucht der Zuschauer über die dortigen Verhältnisse nicht zu wissen. Was an den scheußlichen Umständen interessiert, ist die Scheußlichkeit einer Figur, die daraus hervorgeht und sich darin herumtreibt.
*
Grauenhaft ist er allemal, der Kony. Aber es ist schon komisch: Mitten in einer Welt, die von Staatsgewalten zugepflastert ist, mit ihren stehenden Heeren und ihrem Kriegsgerät der zerstörerischsten Art, soll gerade die Sorte Gewalt, die von einem Schurken im afrikanischen Busch ausgeht, der untrügliche Beweis des Bösen sein. Man täte sich nämlich schwer, die zerstörten Dörfer und deren tote bzw. verstümmelte Insassen von den Kollateralschäden eines amerikanischen Drohnenangriffs zu unterscheiden, von denen eines Bombardements à la „Shock and Awe“ ganz zu schweigen. Nicht, dass sich die Filmemacher an solchen Opfern nicht stören würden – dass aber in dem Fall die Opfer nicht für die Bösartigkeit des Täters sprechen, macht deutlich, wie wenig die Opfer eine solche Unterscheidung hergeben. Das gestehen die Filmemacher auf ihre Weise selber ein, wenn sie ihrem Publikum mit folgenden knappen Klarstellungen erläutern, was den entscheidenden Unterschied ausmacht: Was Kony zu einem unerträglichen Bösewicht qualifiziert, ist nämlich die besondere Perversität seiner Verbrechen.
Was ihn so pervers macht, ergibt ein einfacher Vergleich mit daheim, wo es so etwas nicht gibt:
„Wenn jemand meinen Sohn kidnappen und zum Morden zwingen würde, wäre das überall in den Nachrichten.“ Und „als ob Konys Verbrechen nicht schlimm genug wären, kämpft er für keine politische Sache, sondern nur für den eigenen Machterhalt. Er wird von niemandem unterstützt.“
Endlich einmal bekommt man klare Auskünfte darüber, warum hierzulande die Aussage „Soldaten sind Mörder!“ eine unzulässige Beleidigung ist. Wenn diese volljährigen und ordentlich gemusterten Soldaten mit ihren hochmodernen Waffen in den Krieg geschickt werden, dann im Dienste eines Zwecks, der weit darüber hinausgeht, den Machterhalt eines Befehlshabers zu sichern, der von Dorfüberfällen lebt. Da geht es vielmehr um die Schaffung und Aufrechterhaltung einer kompletten politischen Ordnung. Hinter dieser politischen „Sache“ steht ein ganzes Volk, das von den bewaffneten Agenten seiner Herrschaft weder terrorisiert noch ausgeplündert wird; es darf seinen Materialismus nach gesetzlichen Vorgaben verfolgen und darüber die Machtmittel liefern, die der Staat auf ordentlichem Weg bezieht. Unter dieser Ordnung lebt das Volk nicht in Angst und Schrecken, es gibt ihr seine Unterstützung. Das alles ehrt seine bewaffneten Beschützer als Helden. Im Verhältnis zur kriegerischen und polizeilichen Gewalt, die nötig ist, solche Verhältnisse daheim und auswärts zu einer fest etablierten und anerkannten Weltordnung zu machen, ist Kony zwar weniger als eine Fußnote, aber an dem Maßstab einer erfolgreich durchgesetzten Ordnungsgewalt blamiert er sich eben vollkommen. In den Kontext gestellt, legen Konys Opfer beredtes Zeugnis von der Abartigkeit seiner Gewalt ab. Und damit steht für Russell und seinen Verein die zweite Figur im Kampf zwischen Gut und Böse fest, nämlich die ordentliche Gewalt, die zur Beseitigung des Bösen beauftragt werden muss.
*
So führt uns der Film in die Hauptstadt der Supermacht. Zurückgekehrt von seiner ersten Reise nach Uganda und überzeugt, dass die US-Regierung gegen Kony vorgehen müsste, wenn sie nur über ihn Bescheid wüsste, bittet Russell um eine Audienz mit Abgeordneten des Kongresses, um sie über die Gräueltaten der LRA aufzuklären und zum Handeln zu drängen.
Und in einer Hinsicht ist Invisible Children da an der richtigen Adresse. Denn die USA beziehen tatsächlich alle Gewaltaffären der Welt auf sich und die eigene Ordnungsmacht, auch im afrikanischen Busch. Es ist ja ihre Weltordnung, in der Kony und seine LRA sich herumtreiben – was sich auch an der üblichen Bezeichnung dieser Länder ablesen lässt: Das sind Schuldenstaaten, „HIPCs“ (Highly Indepted Poor Countries), „Fässer ohne Boden“, Verlierer der Weltmarktkonkurrenz, in der sie bzw. ihre Rohstoffe von den Gewinnern dieser Konkurrenz ausgiebig benutzt werden, aber ohne dass darüber eine nationale Ökonomie mit einer flächendeckenden Benutzung der Bevölkerung zustande kommt, aus der der Staat die nötigen Mittel bezieht, eine für die kapitalistisch produktive Inanspruchnahme seiner Untertanen nützliche Ordnung zu stiften und zu befördern. Sehr früh und sehr umfassend haben die Gewinnerstaaten dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beteiligung an der Konkurrenz auf dem Weltmarkt viele der beteiligten Staaten ruiniert – von ihren Insassen ganz zu schweigen, die sowieso nichts zu bestellen haben. Mit politischem Kredit in großem Stil, mit periodischen Umschuldungen und dem einen oder anderen Schuldenerlass hat man jahrelang für eine mehr schlecht als recht funktionierende Staatlichkeit gesorgt, sodass trotz und mit der fortgesetzten Ruinierung dieser Länder ihre weitere Benutzung durch die maßgeblichen Akteure des kapitalistischen Weltmarkts gesichert wurde. Nachdem Afrika als Ressourcenreservoir fertig erschlossen worden ist und die sowjetische Systemalternative abgedankt hat, hat das Interesse an den Kosten einer funktionierenden Staatlichkeit in Afrika allerdings erheblich abgenommen – den Zugriff auf die begehrten einheimischen Ressourcen kriegt man auch anders organisiert. So geht zwar das Geschäft mit den ökonomischen Ressourcen dieser Länder weiter, aber ohne eine staatlich betreute Nationalökonomie und mit einer neuen, „scheiternden“ bzw. „gescheiterten“ Abteilung der Staatenwelt.
In dieser Verwüstungsspur der Weltmarktkonkurrenz und ihrer staatlichen Paten nistet sich schon seit Jahrzehnten eine wachsende Anzahl an subnationalen „Armeen“ ein. Nicht selten haben diese ihren Ausgangspunkt in der Verteidigung einer verfolgten Ethnie – so wie im Fall Kony, dessen LRA ursprünglich als eine Schutzmacht der Acholi im Norden Ugandas und im Süden Sudans gegen die Übergriffe der ugandischen Regierung unter Yoweri Museveni lokale Anerkennung genossen hatte. Vor allem in Afrika konkurrieren solche Verbände über die Grenzen hinweg um die unmittelbare Kontrolle über vom Ausland begehrte, weil dort als Geschäftsmittel benutzte Rohstoffe; sie überfallen die entsprechenden Gebiete und die darin liegenden Dörfer mit aller Entschlossenheit und Brutalität und reißen die Herrschaft über die dort lagernden Bodenschätze an sich. Von auswärtigen Regierungen in der näheren Nachbarschaft werden sie mit modernen Waffen ausgestattet – die aus Waffenschmieden in Ländern stammen, in denen man weiß, wie viele Gewaltmittel eine friedliche Weltmarktordnung braucht – und bisweilen als Mittel zur Destabilisierung einer verfeindeten Regierung instrumentalisiert. So wurde die LRA in ihrem Kampf gegen die ugandische Zentralregierung unter Yoweri Museveni jahrelang von Khartum aus unterstützt, als Vergeltungsmaßnahme für die ugandische Unterstützung der Rebellen im Süden Sudans.
Hat man dabei Erfolg, steigt man zur international anerkannten Regierung auf und kann mit offiziellen Gewaltmitteln den Kampf um die Administration interessanter Rohstoffe fortsetzen. So ungefähr geht die Erfolgsstory von Yoweri Museveni, dem jetzigen Präsidenten Ugandas, dem Hauptfeind Konys, und einem engen Bündnispartner der USA in Ostafrika. In seinem Kampf um die Macht in Uganda vor mehr als 25 Jahren ist er angeblich als Erster im modernen Afrika auf die Idee gekommen, Kindersoldaten in den Dienst zu nehmen; und vor 15 Jahren im sogenannten „afrikanischen Weltkrieg“ hat er in der Konkurrenz um ostkongolesische Bodenschätze einiges an Erfolg zustandgebracht und dabei in Sachen Vernichtung von Land und Leuten Großes geleistet.
Hat man dabei Misserfolg, hält man sich mit dem lebenden und toten Ertrag aus Überfällen auf Dörfer einigermaßen schadlos. So mag diese letzte Variante kriegerischer Gewalt – von der Kony ein vielleicht besonders furchterregendes Exemplar darstellt – eine Abweichung von der erfolgreichen Ordnungsgewalt des Westens sein, aber so gehört sie allemal dazu: als ihr nicht immer dysfunktionales Produkt.
*
Und so wie alles andere in der Welt beziehen die USA auch diese Produkte ihrer Weltordnung auf die eigene Ordnungskompetenz; sie bemessen die Bedeutung dieser Konflikte für ihre weltweiten Ordnungsinteressen, wägen Kosten und Nutzen einer Intervention ab und entschließen sich zu der jeweiligen Kombination aus diplomatischer und kriegerischer Gewalt. Also hören sich die einschlägigen US-Politiker auch Russells Plädoyer für militärisches Zuschlagen an – lehnen aber dankend ab:
„Die USA werden sich nie an einem Konflikt beteiligen, in dem weder die nationale Sicherheit noch ein nationales finanzielles Interesse auf dem Spiel steht... Kony ist einfach nicht wichtig genug, um auf dem Schirm der amerikanischen Außenpolitik aufzutauchen.“
Das hätte eine Lehre sein können – über den kleinen Unterschied zwischen den nationalen Interessen einer Supermacht und dem Interesse einer Organisation wohlmeinender Menschen. Das hätte Anlass zu der Frage geben können, wofür Amerika sein riesiges Waffenarsenal bereithält und einsetzt und warum dafür so viel Gewalt nötig ist. An der Klarstellung wird Russell nicht irre, er zeigt sich vielmehr bitter enttäuscht über eine so bornierte und egoistische Agenda amerikanischer Gewaltanwendung – was alles an Zerstörung fällig ist, wenn die USA einen Konflikt nicht nur auf dem Schirm haben, sondern sich daran beteiligen, ist sowieso kein Thema, weil es sich dabei um die ordentliche Macht des Guten handelt. Russell zieht aus der Ablehnung die umgekehrte Lehre: Es wissen einfach viel zu wenig Menschen über Kony Bescheid! Er ist noch nicht auf ihrem Schirm aufgetaucht: Es ist offensichtlich, dass man Kony ein Ende machen muss. Aber das Problem ist, dass 99 % der Weltbevölkerung nicht wissen, wer Kony ist.
Wenn sich genug Menschen für Kony und seine Opfer interessieren, dann wird die Beseitigung eines Bösewichts zu einem nationalen Interesse, dann muss die Weltmacht in Aktion treten.
Daraufhin gründet sich Invisible Children mit dem Ziel, durch diverse Projekte vor Ort, in erster Linie aber durch Öffentlichkeitsarbeit in den USA die Menschen für den Fall Kony zu interessieren. Nach acht Jahren Engagement fällt IC mit ihren Anhängern in Washington erneut ein und trifft dieses Mal auf lauter Wohlwollen in der Regierung wie im Kongress. Und siehe da: Im Herbst 2011 greift Obama ein! Er schickt 100 „military advisors“ nach Uganda mit dem offiziellen Auftrag, die ugandische Armee durch Beratung und Training für die Jagd auf Kony fit zu machen. Warum die US-Regierung das tut; was sich im letzten Jahrzehnt alles geändert hat an Amerikas außenpolitischer Strategie in Afrika im Zuge des Anti-Terror-Kriegs und der aufkommenden Rivalität mit China; dass die USA nämlich schon seit geraumer Zeit dabei sind, ihre militärische Präsenz auf Afrika auszudehnen und dort auszubauen; dass sie in Museveni und seiner Armee einen treuen Partner in der Region haben – das ließe sich zwar auch mit ein paar Clicks im Internet ermitteln – aber das würde nur die Botschaft des Films vermasseln. Wenn Obama seinen Beschluss mit einem Dankeschön an Invisible Children für ihr Engagement fürs Gute auf der Welt versieht, dann sehen sich die IC-Anhänger nicht als die nützlichen Idioten einer Weltmacht, die sich als der Auftragnehmer der friedliebenden Menschheit vorstellig macht, wenn sie ihre Einsätze aus ihren eigenen Berechnungen unternimmt. Sie sehen die Sache genau umgekehrt, nämlich als Beweis der Macht der vielen kleinen Leute
. Und damit der US-Einsatz wirklich gelingt, muss sich die miteinander vernetzte Menschheit auf die Macht besinnen, die sie inzwischen ist:
„Es war immer so, dass die Entscheidungen der Wenigen mit Geld und Macht die Prioritäten der Regierungen und die Themen in den Medien diktiert haben. Sie haben das Leben und die Chancen der Bürger bestimmt. Aber jetzt gibt es etwas größeres: Die Menschen auf der Welt können einander sehen und einander schützen. Dadurch wird das System auf den Kopf gestellt und dadurch wird alles anders... Die Verhaftung Konys wird beweisen, dass die Welt jetzt nach anderen Regeln läuft; dass die Technologie, die unseren Planeten zusammenbringt, uns auch erlaubt, auf die Probleme unserer Freunde zu antworten. Wir studieren nicht bloß die Geschichte der Menschheit, wir gestalten sie.“
Und zwar genau dadurch, dass man die wirklichen Machthaber anfeuert, bei ihrer Sache konsequent zu bleiben. Denn noch ist Kony nicht gefasst. Die Kosten des Einsatzes könnten steigen, wenn er sich nicht schnell finden lässt; das könnte die US-Regierung dann doch dazu veranlassen, ihr militärisches Engagement zu überdenken und ihr Personal abzuziehen. Damit kommt man endlich zur „Was tun?“-Abteilung des Experiments: Die Kampagne wendet sich erstens an 20 Kulturmacher,
die ihren Promi-Status einsetzen sollten, um das Interesse der Öffentlichkeit an Kony zu wecken und damit, so der selbstverständliche Kurzschluss, das Interesse der Politiker für die Beseitigung des Bösen zu schärfen. Zweitens sind gerade die vielen kleinen Leute gefragt: Der Film ruft die Zuschauer auf, ein „Action Kit“ zu kaufen mit Armbändern, die man teilen kann, und einem „Kony 2012“-Plakat, das man in der Nacht am 20. April im Stil eines flash mobs auf öffentlichen Plätzen aufhängen soll...
Da landet man also: Erst hat man sich in der Rolle eines Auftraggebers imaginiert, der mit seiner gefühlten und bei Facebook praktizierten Verbundenheit mit allen Menschen auf der Welt eine große Macht darstellt; weil sie nicht zu ignorieren ist, stehen ihr die politischen Mächte zu Diensten. Und wie sieht sie aus, diese Macht? Eine großflächige Werbekampagne, die nur eins ausdrückt: das so grenzenlose wie bodenlose Vertrauen in die heilsamen Wirkungen amerikanischer Ordnungsgewalt.
II. ... und die Rezensionen
Die Wucht, mit der „Kony 2012“ innerhalb und außerhalb der Netzwelt einschlägt, lässt die etablierte Öffentlichkeit aufhorchen: Was ist da los im Netz?
Journalisten, stellvertretend für Lehrer und Eltern, staunen über eine ansonsten eher unpolitische Jugend, die endlich über ihren Tellerrand hinausschaut und sich für politische Angelegenheiten interessiert: Oftmals sind das Eltern, die seit Jahren in stiller Verzweifelung auf ihre ach so unpolitischen, konsumorientierten, Facebook-verquatschten ... Sprösslinge schauen.
(Zeit-Online 15.3.12) Das hätte man den Teenies von heute nicht zugetraut; sie nehmen auswärtige Grausamkeiten einmal nicht mit einem desinteressierten oder abgeklärten Schulterzucken zur Kenntnis, sondern betrachten sie als ein Problem, das sie angeht. Bei einer solchen Publikumswirkung muss man vor den Machern des Netzphänomens den Hut ziehen; ein so gewaltiges Echo ist den traditionellen Organen der Öffentlichkeit mit ihrem ganzen investigativen Journalismus noch nie gelungen:
„Mit einem vergleichbar überwältigenden Shock-and-Awe-Effekt ist jedenfalls selten ein Thema, das für die Öffentlichkeit bis eben noch völlig obskur war, auf die Agenda von Millionen vor allem sehr junger Menschen gesetzt worden.“ (SZ, 10.3.) „Kony 2012 holt vergessene Gräueltaten zurück auf die Agenda; gerade weil die Initiatoren verstanden haben, wie man die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie online nutzt.“ (Zeit-Online, 9.3.)
Das veranlasst die journalistischen Profis zu einer näheren Prüfung des filmischen Machwerks, das so viel Aufmerksamkeit in so kurzer Zeit hat erregen können. Und da gibt es doch erhebliche Defizite zu konstatieren. Zunächst werde im Interesse einer möglichst drastischen Schilderung des Bösewichts mit den Fakten Schindluder getrieben: Es stellt sich heraus, dass die Bilder von fliehenden Kindern aus dem Norden Ugandas über 6 Jahre alt sind; dass Kony gar nicht mehr im Lande ist und sich längst in die Zentralafrikanische Republik abgesetzt hat. Der Film lege nahe, dass Kony 30 000 Kinder unter Waffen hat, dabei ist seine Miliz tatsächlich auf geschätzte 200 bis 300 Mann/Kind geschrumpft. Nicht, dass da paradiesische Zustände herrschen würden, aber die Situation vor Ort hat sich nicht nur verändert, das Problem in Uganda ist mittlerweile auch viel zu komplex, als dass man es an einem Mann aufhängen könnte.
(Stern, 22.3.) Im Video wird nämlich unterschlagen, dass der Regierungsarmee,
die im Video als heldenhafte Mannschaft dargestellt wird, die in ihrer Jagd nach Kony amerikanische Unterstützung braucht, Verbrechen ähnlichen Ausmaßes angelastet werden.
(NZZ 11.3.) Auch dieses Problem spart ‚Kony 2012‘ aus: Die Militär-Hilfe kommt der Regierung Yoweri Museveni zugute, der seit 1986 an der Macht ist, Wahlen fälscht, Oppositionelle verhaften und Homosexuelle verfolgen lässt.
(Bild, 12.3.) Zwar kann man das Bedürfnis der Filmemacher nach Dramatisierung und Vereinfachung verstehen, wenn es darum geht, beim Publikum möglichst viel Betroffenheit für die Opfer zu erzeugen: Informationen erweitern das Wissen, Emotionen führen zum Handeln. So lautet ein Grundsatz der politischen und sozialen Kampagnenarbeit. Vereinfachungen und Rührseligkeit gehören dazu. Aber wie viel Rührseligkeit und wie viel Verzerrung verträgt die Realität?
(Zeit-Online 15.3.) Die Presse kennt sich offenbar aus; in der Konstruktion von Feindbildern ist sie schließlich geübt: Wenn es darauf ankommt, in einem Krieg Partei zu ergreifen, muss man möglichst lang auf die Opfer des ausgesuchten Feindes deuten, dessen Anliegen möglichst unerwähnt lassen, bis die Opfer selber als dessen Zweck gelten; bei der Seite, für die es Partei zu ergreifen gilt, muss man sich in Zurückhaltung üben. Aber man sollte es eben nicht übertreiben!
Überhaupt seien die Probleme des Landes komplexer
, vielfältiger
: Armut, Unterernährung, grassierende Krankheiten, mangelnde Bildung, Korruption, usf. Mehr hat die deutsche Presse allerdings darüber nicht zu berichten. Der schlichte Hinweis, dass die ugandischen Verhältnisse komplexer sind; die pure Benennung anderer Notlagen im Land – als Kritik am Film reicht das völlig aus. Mehr ist für die Demonstration nicht nötig, dass das Geschäft der Aufklärung bei den traditionellen Medien besser aufgehoben ist, auch wenn sie nicht so viel Durchschlagskraft besitzen wie solche sündhaft teuren
Werbefilme auf Hollywood-Niveau.
Aber immerhin: IC tut einen großen Schritt in die richtige Richtung, wenn sie einen Monat nach dem Erscheinen des ersten Videos ein zweites an die Öffentlichkeit bringt, das auf die vielen Kritiken dieser Art eingeht und die entsprechenden Mängel des Films ausbügeln soll. Die taz – stellvertretend für den Rest – zieht eine positive Bilanz: Das neue Video
„beginnt mit Ausschnitten von kritischen Berichten über das erste Video: ‚zu vereinfachend‘; ‚die wissen doch nicht, worüber sie reden,‘ kommentierten Journalisten und Fernsehmoderatoren. Doch Invisible Children erklärt in den folgenden 20 Minuten dann, dass sie sehr wohl Ahnung haben, worüber sie da reden.“ Denn diesmal trumpft sie mit der großen Einsicht auf: „Der Konflikt ist komplex, sonst würde er nicht 26 Jahre lang andauern.“ (taz, 6.4.)
*
Die Warnung vor moralischen Übertreibungen gilt nicht nur für die Darstellung des Konflikts, sondern genauso für die Forderungen an die Politik, die IC daraus folgen lässt. Man schätzt zwar den konstruktiven Geist, von dem das Video beseelt ist, aber es ist eine Sache, die Politik als den selbstverständlichen Auftragnehmer für die Erfüllung der guten Sache zu nehmen und sie zum Handeln aufzurufen, es ist aber eine ganz andere Sache, den Auftragnehmer auf die eigene Agenda verpflichten zu wollen, bloß weil man sie selber für das entscheidende Anliegen der Menschheit hält und sich viele Jugendliche dafür interessieren. Naiv zu meinen, die Weltverbesserung, für die die Politik selbstverständlich zuständig ist, wäre so einfach zu haben, wie das die Filmemacher ihrem Publikum weismachen wollen. Was für eine gute und gerechte Weltordnung nötig ist, auf welche Bedingungen und Schwierigkeiten man bei deren Durchsetzung zu achten hat – solche Fragen fallen in den Kompetenzbereich des politischen Auftragnehmers selber. Engagement von Seiten der Bürger ist natürlich erwünscht, aber dann muss man sich an den Instanzenweg halten: Kleine Schritte machen. Dranbleiben. Und bloß nicht so tun, als könnte man die Welt retten.
(Zeit-Online, 15.3.) So fühlt sich ein Kommentator durch die Aussage des Videos, das System
werde durch die Kampagne auf den Kopf gestellt
und die Welt
laufe jetzt nach anderen Regeln,
sogar zur folgenden Klarstellung herausfordert: Ohne Politik und ohne Parteien, ohne Repräsentation kann diese Welt nicht funktionieren.
(ebd.)
Bei allem Respekt für das Echo, das IC mit ihrer Kampagne erzeugt, müsse sich diese Organisation doch die möglichen Konsequenzen ihres übertriebenen Moralismus klar machen. Schließlich agitiert sie für eine Militärintervention:
„Es bleibt unklar, was passieren soll, wenn Kony nicht zu finden ist. Soll Amerika den offenen militärischen Konflikt mit der LRA suchen? Das würde das Leid der Menschen in der Region nur vergrößern. ‚Was ist mit den Dutzenden oder Hunderten von entführten und einer Gehirnwäsche unterworfenen Kindern?...Sollen wir auf alle Bomben werfen?‘“ (Zeit-Online, 9.3.)
Eine interessante Einsicht: Wenn man den Opfern des Feindes mit kriegerischer Gewalt hilft, dann werden sie weniger in Sicherheit gebracht als vielmehr ins Jenseits befördert. Will die Presse es dann nicht mehr durchgehen lassen, wenn kriegerische „Interventionen“ unter Berufung auf die Opfer des bekriegten Feindes durchgeführt werden – wie neulich in Libyen? Bild deckt auf: Fakt ist: .... Der US-Einsatz in Uganda, für den die Filmemacher zu kämpfen auffordern, ist alles andere als uneigennützig.
Sie lässt einen Uganda-Experten zu Wort kommen, der die entsprechende Klarstellung liefert: Die Jagd nach Kony sei ‚ein Anlass, den die US-Regierung gern aufnahm, um ihre militärische Präsenz in Zentralafrika zu rechtfertigen.‘
So gesehen mache IC ihr jugendliches Publikum zu nützlichen Idioten, um noch mehr Waffen und Militär nach Afrika zu schicken und die Macht befreundeter Staaten in der Region zu stützen.
Das Video „zeigt die Afrikaner als hilflose Kinder, die von weißen Amerikanern gerettet werden. Das Ergebnis dieses unverantwortlichen Eingreifens ist, dass die Bürger in Uganda einen hohen Preis dafür zahlen könnten, damit sich viele junge Amerikaner besser fühlen.“ (Bild, 13.3.) Möchte die Bild-Zeitung dann in Zukunft den Terminus „Friedenseinsatz“ als einen heuchlerischen Rechtfertigungstitel für imperialistische Zwecke denunzieren? Oder will sie behaupten, dass humanitäre Kampagnen letztlich Werkzeuge des Imperialismus sind? Möchte sie ihr „Herz für Kinder“ herausoperieren, weil am Ende nur die Spender mit ihrem guten Gewissen davon profitieren?
*
Da trifft es sich gut, dass die deutsche Presse umgehend die Chance bekommt, zu demonstrieren, wie verantwortungsvoller Journalismus wirklich geht. Denn eine Woche später wird Thomas Lubanga, ebenfalls ein Milizenführer in Zentralafrika, vom Internationalen Strafgerichtshof (ICC) für die Verwendung von Kindersoldaten verurteilt. Die deutsche Presse ist sich einig: Dieser erste Schuldspruch des ICC ist ein Fanal
, ein Meilenstein
, ein historischer Augenblick
, ein starkes Signal
, zugleich mehr als nur Symbolik,
vielmehr ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit.
Da sind keine Bedenken zu vernehmen über eine anmaßende Haltung seitens des Strafgerichtshofs im europäischen Norden, auch nicht über die kriegerische Taktik der Europäer bei Lubangas Verhaftung. Im Gegenteil: In diesem Fall hatte Opération Artemis, eine europäische Eingreiftruppe unter französischer Führung, endlich aufgeräumt, nachdem die uruguay-ischen Blauhelmsoldaten ein Jahr lang dem Schlachten unbeteiligt zugesehen hatten. Lubanga hatte wohl geglaubt, er könne mit französischen Fallschirmjägern genau so umspringen wie mit den Uruguayern, bis die Franzosen drei seiner Kindersoldaten nach etlichen Vorwarnungen erschossen.
(FAZ, 22.3.) Man hat auch keine Unzufriedenheit über eine Verzerrung der Realität vor Ort gehört, bloß weil auch dieser Krieg längst vorbei ist und Lubanga schon 2006 aus dem Verkehr gezogen worden ist. Die SZ zitiert zwar einen Experten, der über die Bedeutung des Schuldspruchs etwas skeptisch ist: Wenn dieser aber berichtet, dass die Menschen in dem von Lubanga terrorisierten Gebiet auf seine Verurteilung mit Schulterzucken reagiert haben, weil es noch weitaus grausamere Verbrechen [gibt], deren Verfolgung die Menschen in Ostkongo sich dringlicher wünschen,
kann die SZ das nicht einfach so stehen lassen: Zeigt nicht gerade das, wie dringend nötig das juristische Signal aus Den Haag war? Um ein Unrechtsbewusstsein zu schaffen?
Es scheint also nicht nur darauf anzukommen, wer das nötige politische Unrechtsbewusstsein bildet. Wenn von der deutschen Presse derart kritische Urteile über eine amerikanische NGO und ihre Hilfskampagne zu hören sind, dann kann man sich sicher sein, dass es ihr auch ein bisschen darauf ankommt, an wen sich die politisch engagierte Jugend wendet, welche Staaten also als Ansprechpartner für Weltverbesserung firmieren und wessen Verantwortung für die Weltordnung damit affirmiert wird. Gegen Kony, klar – und gegen die selbsternannten Weltretter, die von den USA aus Uganda helfen wollen.
(Stern, 22.3.) Von Den Haag aus geht das viel besser.
Und wenn man sich in dieser Frage vertut, ist nicht nur Kritik angesagt, sondern ein Aufruf an die richtigen Instanzen, für Ordnung zu sorgen. An die Kony 2012-Anhänger, die ihre bunten Plakate in den Großstädten aufhängen, lässt die Bild-Zeitung die entsprechende Botschaft von einem verantwortungsvollen Ansprechpartner in der Politik überbringen: CDU-Politiker Andreas Hartnigk ist sauer: ‚Auch wenn es gut gemeint war, wild plakatieren oder Parolen auf öffentliches oder privates Eigentum sprayen geht gar nicht. Da muss man sich an die Regeln halten – egal um welchen Zweck es geht... Wenn Ordnungswidrigkeiten oder Sachbeschädigungen festgestellt werden, verfolgen wir das.‘
(Bild, 21.4.) Doch solange man sich ordentlich an die richtige Adresse wendet, kann man der Sorte Politisierung, die die IC-Kampagne anstrebt, dann doch was abgewinnen: Und nun zeigt die Bewegung aus den Kinderzimmern, dass es durchaus eine brachliegende Bereitschaft gibt, sich einzumischen, Despoten und Kriegsverbrechern in den Arm zu fallen. Hoffentlich sehen unsere Regierenden das.
(Zeit-Online, 15.3.)