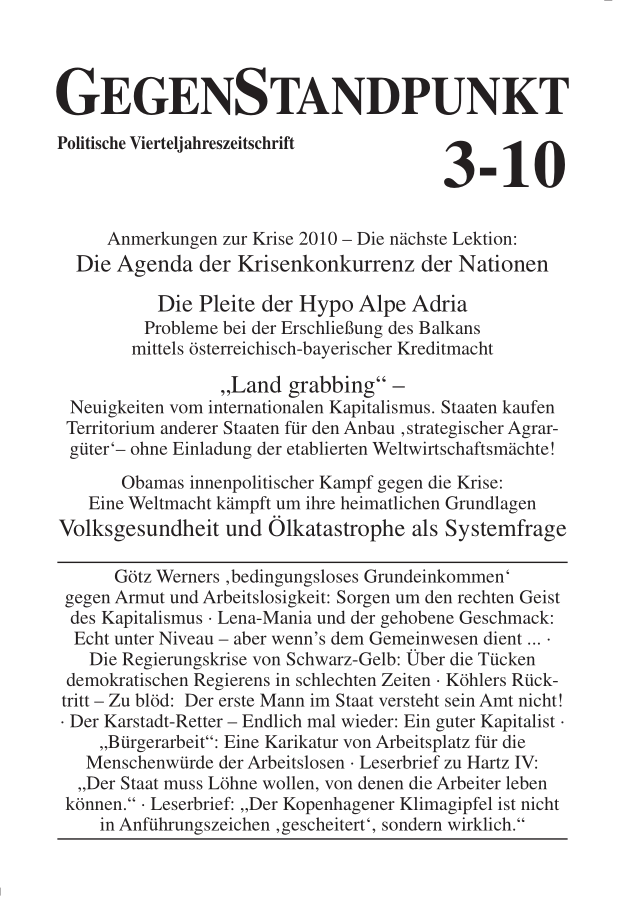Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Köhlers Rücktritt:
Zu blöd: Der erste Mann im Staat versteht sein Amt nicht!
Der unerwartete Rücktritt des Bundespräsidenten trifft bei seinen Kollegen aus der „politischen Klasse“ und in der nationalen Öffentlichkeit erst einmal auf demonstratives Unverständnis. Die zunächst konsterniert gestellte Frage nach den Gründen wird dann aber zügig einer Beantwortung zugeführt...
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Köhlers Rücktritt:
Zu blöd: Der erste
Mann im Staat versteht sein Amt nicht!
Der unerwartete Rücktritt des Bundespräsidenten trifft
bei seinen Kollegen aus der politischen Klasse
und
in der nationalen Öffentlichkeit erst einmal auf
demonstratives Unverständnis. Die zunächst konsterniert
gestellte Frage nach den Gründen wird dann aber zügig
einer Beantwortung zugeführt:
Der Bundespräsident, der bei den Bürgern gut ankam ...
zu den tatsächlich mächtigen Politikern in Berlin ...
jedoch nie ein tragfähiges Verhältnis
fand, verdiente
sich seine angebliche Beliebtheit beim Volk und sein
schlechtes Ansehen bei den praktizierenden Politikern mit
einer Tour, die man in Berlin
gar nicht
gut leiden kann. Köhler wollte nämlich ein Präsident
des Volkes sein
und kam den regierenden Politikern
mit kritischen „Vorstellungen über die
Politik..., wie sie in der Bevölkerung
herrschten. ‚Wir müssen uns wirklich fragen, wieso das
Vertrauen der Bürger in die Politik so wenig ausgeprägt
ist‘, sagte er einmal.“ (FAZ, 1.6.10)
So biederte sich der vormals kaum bekannte
Sparkassenpräsident und IWF-Direktor
(FAZ, ebd.) auf Kosten der Politik
bei den Bürgern an, mit populären Vorstellungen
,
in denen die Führung der Nation in Regierung und
Opposition notorisch schlecht dastand, und das „in
einer Zeit der Wirtschaftskrise ..., in der die
Bürger der Politik vertrauen müssen“ (SZ, 1.6.10);
und geißelte die Arbeit von Banken und
Finanzmärkten
als Monster
(FAZ, ebd.), anstatt den Menschen in
dieser schwierigen Situation wenigstens etwas zu erklären
...
(SZ, ebd.)
Der Mann hat sich also – man hat es eben ein wenig spät
bemerkt – als ziemliche Fehlbesetzung auf seinem Posten
herausgestellt, so dass sein Rücktritt nichts anderes war
als die am Ende unausweichliche Konsequenz einer
unbefriedigenden Amtsausübung. Wer sich selbst als
höchster Repräsentant des Staates mit volkstümlicher
Kritik an der Politik
ausdrücklich
außerhalb der Politik stellt, der verfehlt die
Aufgaben, die in einer Demokratie – und auch sonst – mit
einer so herausgehobenen Position verbunden sind: die
Stiftung von Vertrauen in die Führung des
Gemeinwesens und die Beförderung einer vertrauensvollen
Einheit von Volk und Führung gerade in schweren
Zeiten. Und wer sich als leitender Funktionär mit dem
populären Generalmisstrauen gegenüber Politikern gemein
macht, selber gar keiner sein will und der schlechten
Meinung über das Führungspersonal damit ein wenig recht
gibt, der macht sich – was eigentlich das
Kerngeschäft des Präsidentenamtes wäre – nicht
gerade um die Idealisierung der politischen
Machenschaften im Land verdient, von der nationalistische
Parteilichkeit und das Verständnis für Zumutungen in
Krisenlagen leben. Dass dieser Teil der
Stellenbeschreibung des Bundespräsidenten nach Auffassung
seiner Kritiker ganz an der Gabe der schönen Rede hängt,
kommt hier erschwerend hinzu: Wenn ihm, amtsbedingt,
als politisches Mittel ausschließlich das Wort zu
Gebote steht
, um auf das Wahre, Gute und Schöne an
Krisen-, Kriegs- und Hartz-IV-Politik zu verweisen,
Köhler aber damit nicht umgehen konnte
(SZ, ebd.), dann ist es am
Ende nicht schlecht, sondern gut, dass dieser Präsident,
gekränkt von der Kritik an seiner Amtsführung und
beleidigt durch die fehlende Unterstützung aus der
Regierung, einfach gegangen ist. Er hat, wie es einer
seiner altgedienten Politikerkollegen ausdrückt,
„offensichtlich – tut mir leid – das Amt nicht richtig verstanden. Es ist in Ordnung, dass man beliebt sein will beim Volk. Aber man muss sich diese Beliebtheit erwerben durch Autorität und nicht dadurch, dass man die politische Klasse schrecklich findet.“ (Finanzminister Schäuble, CDU,Tagesspiegel am Sonntag, 04.07.10)
*
Die Chefs in Berlin zeigen sich also schnell erholt von
diesem Aufsehen erregenden Rücktritt und machen sich
unverzüglich an die Bestallung eines Nachfolgers. Weil
sie vorerst ein wenig die Schnauze voll haben von
dilettierenden Quereinsteigern mit unberechenbarer
Überempfindlichkeit gegen Kritik, schlägt Kanzlerin
Merkel den amtierenden niedersächsischen
Ministerpräsidenten Christian Wulff vor: Sie will
einen Profi, der das Geschäft kennt.
(Spiegel, 07.06.10) Weil Köhler nach dem
Geschmack der politischen Führung ihre Regierungsarbeit
mehr schlechtgeredet als gut verkauft hat, soll den
Posten jetzt einer versehen, der dazu gehört,
das selbst auch so sieht und von dem deshalb keine
falschen Töne zu erwarten sind, auch wenn er mal kritisch
wird: Solidarische Ermahnungen werden immer gern gehört,
schließlich kann es ja nicht schaden, wenn ab und zu ein
Ruck durchs Land
geht.
Bei dieser Gelegenheit gelingt den Sozialdemokraten ein
hübsches Stück demokratischer Perfidie: Mit der
Aufstellung des verdienten vormaligen Stasi-Oberjägers
Gauck bringen sie gegen den professionellen
Karrieristen aus dem CDU-Lager einen erstklassigen
Repräsentanten der bundesdeutschen Politmoral in
Stellung, den die Konservativen ebenso gut wie ihren
eigenen Kandidaten, wenn nicht besser finden könnten.
Gauck gilt landesweit als mutiger Anführer des
demokratischen Aufstandes gegen das Unrechtsregime der
ostdeutschen Realsozialisten, nur weil man ihm nach dem
Anschluss die Abrechnung mit dem alten System
übertragen und er diese mit angemessenem
antikommunistischem Beamteneifer zur Zufriedenheit der
neuen Herren durchgeführt hat. Tatsächlich gelingt es der
SPD, mit dieser Kandidatur ein wenig Unfrieden und
Verunsicherung ins gegnerische Lager zu tragen, weil es
eben nicht ganz leicht zu entscheiden ist, ob man lieber
einen Präsidenten hätte, der zuverlässig und ganz nahe an
der Macht agiert, oder einen, der für die Werte
steht, denen sich diese Macht verpflichtet hat, – wie
etwa die immerwährende Sehnsucht nach Freiheit
, in
der sich Gauck und Merkel nach deren eigener Auskunft
verbunden wissen (Spiegel, 7.6.10). Schließlich
verdeutlichen die Kandidaten nur die Aufgaben des Amtes
nach den beiden Seiten hin, die möglichst von ein und
derselben Präsidentenfigur bedient werden sollten:
Repräsentanz der wirklichen Politik und ihre
glaubwürdige Idealisierung in einem. Die kleinen
Turbulenzen unter den Wahlleuten der CDU legen sich dann
aber schnell wieder: Der eigene Kandidat bekommt am Ende
den Posten, und die SPD darf hoffen, mit dem Aufgebot
ihres Freiheitshelden, der den Machtberechnungen der
Koalition unterliegt, dem Ansehen der Regierung wieder
ein bisschen geschadet zu haben.
*
Die besondere Hinterfotzigkeit an der Verwendung des Freiheitskämpfers Gauck besteht im dual use dieses Kandidaten als politische Waffe auch gegen die linke Konkurrenz der Sozialdemokraten: Der Linkspartei wird einer ihrer entschiedensten Feinde zur Wahl angetragen, und die Zustimmung zu ihm unter dem Banner der Verhinderung des schlechten rechten Kandidaten zur fortschrittlich-vaterländischen Pflicht erklärt: Wählt die Linkspartei den Kommunistenfresser Gauck mit, unterwirft sie sich dem Manöver der SPD, enttäuscht Teile ihrer linken Anhängerschaft und gibt Gauck und seiner antilinken Hetze gegen das eigene Parteiprogramm mehr recht als ihr lieb sein kann; wählt sie ihn nicht, wie geschehen, beweist sie, dass ihr ihr partikulärer Parteistandpunkt wichtiger ist als das hohe Amt und seine würdige Besetzung – und damit ihre anhaltende Regierungsunfähigkeit! Die Linkspartei, die nichts gegen dieses Amt und seine Aufgaben einzuwenden hat, sondern am Ende sogar selbst noch eine Kandidatin dafür aufbietet, hat sich allerdings solche Gemeinheit von Seiten der Konkurrenz redlich verdient.