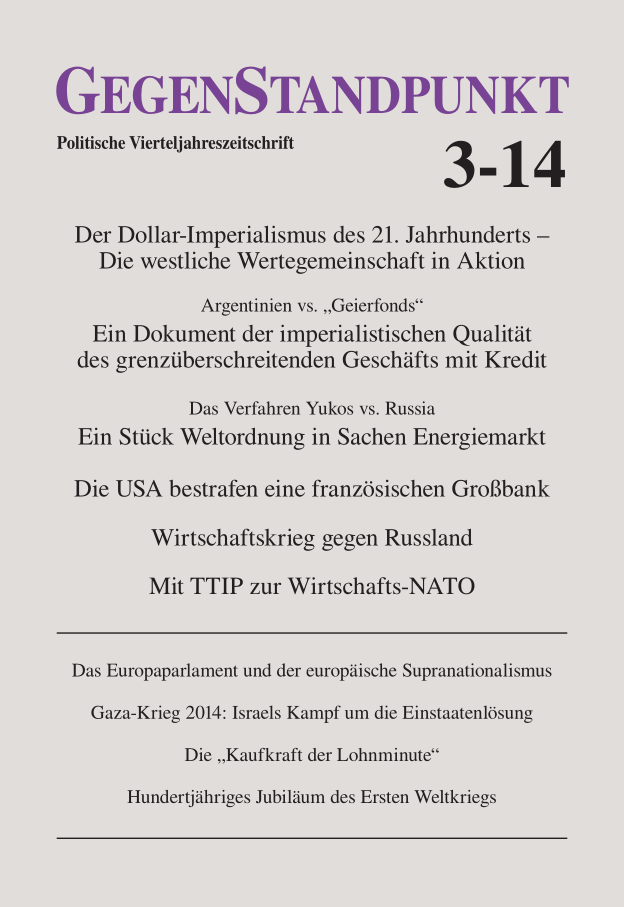Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die „Kaufkraft der Lohnminute“ – oder: die volkswirtschaftsgelehrte Verwandlung von Ausschluss in Teilhabe
Regelmäßig wird der Zeitungsleser mit einer
volkswirtschaftlichen Entdeckung bekannt gemacht, für die
zuletzt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IWK) die
statistische Aufbereitung geliefert hat. Das Institut geht in
einigen Studien der Frage nach, wie lange man heute
eigentlich für eine Ware arbeiten muss, und kommt zu dem
Ergebnis: Der deutsche Lohnempfänger kann zufrieden
sein
, denn die durchschnittliche Kaufkraft der
Lohnminute
nimmt tendenziell zu. (www.iwkoeln.de. Ebenso
alle folgenden Zitate, soweit nicht anders gekennzeichnet)
Dass ein Warenkorb, der 1950 noch dem Gegenwert einer
vollen Stunde Arbeit entsprach, (…) heute bereits nach elf
Minuten verdient
ist, wird über die verschiedensten
Bestandteile dieses Korbs – Brot, Bier, Kaffee, Kleidung,
Waschmaschine, Fernseher, Kinobesuch, Energie usw. –
ermittelt. Bei der Erklärung der unterm Strich
konsumentendienlichen Preisveränderungen kommen die Männer
und Frauen vom Fach auf den Grund zu sprechen:
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
Die „Kaufkraft der Lohnminute“ – oder: die volkswirtschaftsgelehrte Verwandlung von Ausschluss in Teilhabe
Regelmäßig wird der Zeitungsleser mit einer volkswirtschaftlichen Entdeckung bekannt gemacht, für die zuletzt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IWK) die statistische Aufbereitung geliefert hat. Das Institut geht in einigen Studien der Frage nach, wie lange man heute eigentlich für eine Ware arbeiten muss, und kommt zu dem Ergebnis: Der deutsche Lohnempfänger kann zufrieden sein
, denn die durchschnittliche Kaufkraft der Lohnminute
nimmt tendenziell zu. (www.iwkoeln.de. Ebenso alle folgenden Zitate, soweit nicht anders gekennzeichnet) Dass ein Warenkorb, der 1950 noch dem Gegenwert einer vollen Stunde Arbeit entsprach, (…) heute bereits nach elf Minuten verdient
ist, wird über die verschiedensten Bestandteile dieses Korbs – Brot, Bier, Kaffee, Kleidung, Waschmaschine, Fernseher, Kinobesuch, Energie usw. – ermittelt. Bei der Erklärung der unterm Strich konsumentendienlichen Preisveränderungen kommen die Männer und Frauen vom Fach auf den Grund zu sprechen:
„Teurer geworden sind (…) manche Dienstleistungen wie der Friseurbesuch – nicht zuletzt deshalb, weil bei handwerklichen Leistungen meist kaum Produktivitätssteigerungen möglich sind.“ „Besonders deutlich sind die Kaufkraftgewinne dort, wo viele elektrische oder elektronische Bauteile eingesetzt werden – der technische Fortschritt und der durch die Globalisierung verstärkte Wettbewerb drücken hier besonders auf die Preise.“
Die Rechnung mit der steigenden Kaufkraft einmal ernst genommen, also vom Kopf auf die Füße gestellt
Bemerkenswert ist an dieser Auskunft – neben dem schlechten Scherz, eine Wirtschaftsweise dafür zu loben, dass tatsächlich auch die darin tätigen Arbeiter etwas davon haben – bereits die Fragestellung, von der die Studie des IWK lebt: Wieviel Kaufkraft repräsentiert eine Lohnminute? Denn die ist absolut doppeldeutig: Wie lange man heute im Vergleich zu gestern für ein Produkt arbeiten muss, nimmt einerseits den Lohn in den Blick, den eine Arbeitsminute einbringt, sowie den Umfang an Produkten, die sich mit dem verdienten Geld kaufen lassen; darauf, auf den Arbeitenden als dem letzten Glied in der Produktionskette, als zahlungsfähigen Endverbraucher kommt es der volkswirtschaftlichen Statistik zur Kaufkraft der Lohnminute
an. Die gänzlich andere Auflösung derselben Frage nimmt mit dem Hinweis auf den technischen Fortschritt
den Arbeitsaufwand ins Visier, der zur Herstellung eines Produkts nötig ist. Dass eine Lohnminute
auf immer mehr Waren zugreifen kann, verdankt sich nach Auskunft des IWK dem Sinken von Warenpreisen, das wiederum im Wesentlichen auf einer Steigerung der Arbeitsproduktivität beruht, die im Herstellungsprozess dieser Waren zur Anwendung kommt, also letztlich darauf zurückgeht, dass besagte Produkte mit immer weniger Arbeit herzustellen sind.
Die Rechnung der Volkswirtschaftsgelehrten, dass die Kaufkraft der Lohnminute
in Abhängigkeit von Produktivkraftsteigerungen – irgendwie – zunimmt, einmal ernst genommen: Welche Implikationen sind in dem Argument des technischen Fortschritts
enthalten und was haben die mit der Kaufkraft der Lohnminute
zu tun?
Die unausgesprochene Gleichung, die in der Produktivkraftsteigerung unterstellt ist, mit der das IWK die Tendenz einer Kaufkraftzunahme pro Lohnminute
begründet, setzt das Arbeitsquantum, das verausgabt werden muss, um eine Ware herzustellen, und im Maße steigender Produktivkraft schwindet, ins Verhältnis zum Warenpreis: Je weniger Arbeit zur Produktion einer Ware erheischt ist, desto niedriger ist ihr Preis, d.h. das Geldquantum, das die Ware repräsentiert und im Verkauf realisiert.
Auch wenn die Konstrukteure der Kaufkraft der Lohnminute
nichts davon wissen wollen, über welche ökonomische Bestimmung von Arbeit und Reichtum sie mit diesen Wirkungen des technischen Fortschritts
reden – der von ihnen als selbstverständlich unterstellte Zusammenhang von sinkendem Arbeitsquantum und entsprechend sinkendem Warenpreis unterstellt die gemeinhin verpönte Arbeitswertlehre von Marx. Erstens heißt das ja, dass in der Marktwirtschaft an den Arbeitsresultaten als gesellschaftlich gültiger Reichtum einzig die Geldmenge zählt, die durch ihren Verkauf zu erlösen ist, die also der Käufer zahlt, ihr Wert – im Unterschied zu all den konkreten Eigenschaften der Güter, dank derer sich diverse Bedürfnisse befriedigen lassen. Wenn sich die im Warenpreis vorgestellte Geldmenge, die Wertgröße der Ware, in Abhängigkeit von der verausgabten Arbeitsmenge, unabhängig von ihrer jeweiligen konkreten Gestalt, verändert, dann bedeutet das zweitens, dass der Wert, den eine Ware repräsentiert, in dem Maße geschaffen wird, wie mehr oder weniger Arbeitszeit, also purer Arbeitsaufwand, in der Ware steckt. Die Rechnung des IWK – um den Zusammenhang noch einmal in Marx’ Worten auszudrücken – gibt auf ihre Weise zu, dass
„der Wert der Ware (…) Verausgabung menschlicher Arbeit überhaupt“ (Das Kapital, Bd. 1/59) darstellt und „die Wertgröße einer Ware nur das Quantum der in ihr enthaltenen Arbeit“ (60); und dass „dieselbe Arbeit (…) daher in denselben Zeiträumen stets dieselbe Wertgröße [ergibt], wie immer die Produktivkraft wechsle.“ (61)
Wenn das aber so ist, steht drittens damit auch fest: Für denjenigen, der die Waren kauft, mag sich der technische Fortschritt
lohnen, da er mit ein und derselben Geldsumme auf mehr, weil weniger Arbeitsaufwand und damit weniger Wert, also Geldanspruch repräsentierende Waren zugreifen kann. Für denjenigen aber, der die Waren herstellt, stellt sich die Steigerung der Arbeitsproduktivität als paradox dar: Der produziert in derselben Zeit vermittels gesteigerter Produktivität zwar mehr nützliche Gegenstände, aber mehr Wert, mehr von dem Reichtum, auf den es im Kapitalismus ankommt, produziert er deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil: Erst einmal bedeutet das ja nur, dass jedes einzelne Produkt wegen des sinkenden Arbeitsaufwands pro Ware weniger wert ist. Weil und insofern es beim Arbeiten aber auf die Herstellung eines Wert-Produkts, also darauf ankommt, dass Waren und Dienstleistungen über den Verkauf Geld einbringen, ist die Produktivkraftsteigerung, die vom Standpunkt nützlicher Arbeit betrachtet eine gesellschaftliche Errungenschaft wäre – mit weniger Arbeitsmühe verfügt die Gesellschaft über mehr nützliche Güter –, vom gesellschaftlich gültigen Zweck des Arbeitens aus gesehen völlig nutzlos. Sie mindert ja pro Ware den Zugriff auf den Reichtum, der zählt: das mit ihr zu erlösende Geld.
Wenn dennoch in der Marktwirtschaft immerzu und systematisch die Produktivität der Arbeit gesteigert wird, dann sicher nicht, weil es beim gepriesenen „technischen Fortschritt“ darum geht, den Arbeitenden Mühsal zu ersparen und ihnen mehr freie Zeit und Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu verschaffen – das ist , um es vorwegzunehmen, am Ende ja auch gar nicht das Ergebnis dieses Fortschritts. Diejenigen, die mit ihrer Arbeitsleistung den ganzen Warenreichtum schaffen, deren Arbeitsleistung also sich im Wert ihrer Produkte niederschlägt und einen Anspruch auf Bezahlung der produzierten Ware begründet, können unmöglich die maßgeblichen Subjekte einer Produktion sein, die alles, was für sie von Nutzen wäre, als geminderten Reichtum verbucht. Da bestimmen offensichtlich andere als die Arbeitenden über die produktive Tätigkeit, ziehen andere aus dem wertstiftenden Arbeitsaufwand und dem „technischen Fortschritt“ ihren Nutzen. In den Statistiken der Auskenner vom IWK kommen die wirklichen Nutznießer der Warenproduktion zwar nicht ausdrücklich vor, aber ihre Rechengröße Lohnminute
, die entlohnte Arbeitsminuten statistisch zusammenfasst, verweist ja durchaus darauf: Das wirkliche Subjekt, das über die Produktion entscheidet und mit dem Verkauf der Produkte Geld erwirtschaftet, ist der Unternehmer, der arbeiten lässt, der die Arbeit anderer in seinem Betrieb in Anspruch nimmt und kommandiert und dafür einen Lohn zahlt – und dem deshalb die Waren gehören, die Lohnempfänger unter seiner Regie produzieren.
Das heißt zweitens aber auch: Der paradoxe Effekt, dass der ständig gesteigerte Wirkungsgrad der Arbeit das bezweckte Arbeitsergebnis, das allein zählt und auf das es den Veranstaltern allein ankommt, den Wert, mindert, kann auch nicht der eigentliche Zweck und die eigentliche Kalkulation der Unternehmer sein, die diese Produktion veranstalten und immer produktiver machen. Die rechnen ganz offensichtlich überhaupt nicht mit wertschaffender Arbeit als Reichtumsquelle, sondern stellen beim Umgang mit den von ihnen Beschäftigten eine andere Rechnung an, die ihnen die Ersparung von Arbeitsaufwand, also ausgerechnet die Minderung der Wertquelle, lohnend erscheinen lässt – und offenbar auch lohnend macht. Darüber legen die gelehrten Sprachrohre der Unternehmerschaft ebenfalls Zeugnis ab: Das IWK bespricht die durch Produktivitätsfortschritte bewirkten Preissenkungen, also die Verminderung des Arbeitsaufwands pro Ware, die es als vermehrte Kaufkraft der Lohnminute
anpreist, ja selber nur als Effekt von Preiskämpfen, die die Unternehmen im globalisierten Wettbewerb
veranstalten, um am Markt zu bestehen. Und dabei unterstellen die Propagandisten wachsender Kaufkraft der Lohnminute stillschweigend die Rechnung, die die Unternehmen, die mit niedrigeren Preisen um Marktanteile konkurrieren, tatsächlich mit der Arbeit anstellen: Dass an der nur der Preis zählt, den jede Arbeitsminute sie an Lohn kostet, sowie der Geldertrag, den sie ihnen in Gestalt verkäuflicher Güter produziert.
Tatsächlich ist den Unternehmern selber die Abhängigkeit des Warenwerts vom Quantum verausgabter Arbeit von Berufs wegen nur als Wirkung ihrer Konkurrenz um möglichst lohnenden Verkauf bekannt, als Konsequenz des Einsatzes arbeitssparender Produktionsmethoden, die ihnen ‚der Markt‘, also ihre Konkurrenten in Gestalt sinkender Warenpreise als Bedingung ihres Geschäftserfolgs stellen und die sie ihrerseits im eigenen Betrieb als Hebel nutzen, um sich gegen die Konkurrenz mit lohnenden Preisen durchzusetzen. Wertschaffende Arbeitsminuten kommen in ihrer Kalkulation ausschließlich als Lohnminuten vor – als bezahlte Arbeitsleistung, als Kostenaufwand, den sie treiben und treiben müssen, um lohnend verkaufen zu können. Sie interessiert von Anfang an nichts als die in einem Geldbetrag quantifizierbare Differenz zwischen dem Kostenaufwand für die im Betrieb angewandte Arbeit und dem Ertrag, den der Verkauf der unter ihrer Regie produzierten Arbeitsprodukte einbringt. Für sie zählt Arbeit daher nur in genau einer Hinsicht als Quelle von Wert: von mehr Wert, realisiert im Verkaufserlös, als sie in die Arbeit hineingesteckt haben, die ihnen die verkäufliche Ware liefert. Was sie daher interessiert und woran sie sich laufend zu schaffen machen, ist ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen dem Arbeitsquantum, das für den Unterhalt der Arbeitskräfte draufgeht, d.h. zwischen der Geldsumme, die sie aus dem Verkaufserlös an Lohn verausgaben müssen, und dem Arbeitsquantum, das darüber hinaus einen Gelderlös begründet, der ihnen als den Eigentümern der Produktion und Anwendern der Arbeitskräfte als Gewinn zufällt. Je größer diese Differenz, desto lohnender das Geschäft, das sie mit ihrem Kommando über fremde Arbeit auf eigene Rechnung machen.
Die kapitalistische Natur des „technischen Fortschritts“
In dieser Rechnung spielt der technische Fortschritt
eine entscheidende, allerdings ganz andere als mit dem konsumentenfreundlichen Effekt der Preissenkung vorstellig gemachte Rolle. Um die Differenz von Kostenaufwand für den Einsatz von Arbeitskräften und Geldertrag, den sie als die Organisatoren der Produktion aus dem Arbeitseinsatz herauswirtschaften, zu steigern, führen Unternehmer einen ständigen Kampf um die Senkung der Lohnkosten. Dafür nutzen sie die mit ihrem Kapitaleinsatz erworbene Verfügungsmacht über die Agenzien der Produktion und die in Dienst genommenen Arbeiter. Da kommt – neben Lohndrückerei und Arbeitshetze – arbeitssparende Technik zum Einsatz; dafür und ausschließlich dafür, nämlich pro Warenprodukt bezahlte Arbeit einzusparen, und zwar mehr bezahlte Arbeit als die Investition in den technischen Fortschritt
kostet. Verbesserte Produktionsverfahren und Maschinerie dienen dazu, im Ergebnis das Quantum bezahlter Arbeit zu verringern und darüber den Überschuss zu steigern, den die geleistete Arbeit ihnen abliefert. Worum es bei der Steigerung der Produktivität der Arbeit also geht, ist die Steigerung der Produktivität des eingesetzten Kapitals. Dessen Produktivität ist gestiegen, auch wenn der Wert der einzelnen Ware durch die Reduktion wertschaffender Arbeit absolut sinkt, weil durch die Anwendung Produktivkraft steigernder Mittel dem Unternehmer pro Ware ein relativ größer werdender Anteil zufällt, wenn er mit seinen Investitionen in solche Mittel die Lohnstückkosten, den Lohnbestandteil pro hergestelltem Produkt, immer weiter reduziert. Die Arbeit, die noch im Betrieb verbleibt, produziert mit jeder einzelnen Ware Wert, von dem ein immer geringerer Anteil an die Lohnarbeiter weggezahlt werden muss.
Dieses Resultat der rastlosen Bemühungen um mehr Gewinn wird nicht dadurch hinfällig, dass sich die Unternehmen mit ihrer Konkurrenz um den Markt laufend den Vorteil gesunkener Produktionskosten durch Preissenkungen streitig machen. Umgekehrt: Die Anstrengungen, die Kosten zu reduzieren, sind ja darauf berechnet und taugen dazu, auch zum geringeren Preis mehr lohnend Verkäufliches zu produzieren und auf dem Markt abzusetzen. Und wenn das alle gegeneinander machen, dann nötigen sie sich eben nur wechselseitig diese Rechnung auf, so dass insgesamt die Preise sinken; die allgemein gesunkenen Preise aber repräsentieren an jeder einzelnen Ware und insgesamt ein lohnenderes Verhältnis von Kapitalaufwand für Arbeitskräfte und Kapitalertrag aus der mit diesem Lohn gekauften Arbeit. Als Ergebnis dieses Konkurrenzkampfs steht dem wachsenden Kapital eine relativ immer geringere Masse bezahlter Arbeit gegenüber. Ein Arbeiter mag nominell dasselbe verdienen, relativ, d.h. in Bezug auf das Produkt seiner Arbeit, wird er immer ärmer, weil er von einem größer werdenden Ertrag seiner Arbeit ausgeschlossen bleibt.
Wenn also die Steigerung der Arbeitsproduktivität als Hebel zur Steigerung des Wertquantums, das sich ein Unternehmer pro Ware aneignen kann, in der Konkurrenz der Unternehmen um den Markt als allgemeines Prinzip der Warenproduktion zur Anwendung kommt und dank dieser Konkurrenz zu sinkenden Preisen führt, dann mögen diejenigen, deren Arbeitsleistungen nach wie vor in Dienst genommen werden, mit ihren bezahlten Lohnminuten
ein Geld in Händen halten, mit dem sie sich – im historischen Vergleich – tendenziell mehr von den Waren kaufen können, die mit immer weniger Arbeitsaufwand herzustellen sind. Allerdings ist der vom IWK propagierte Kaufkraftnutzen der Konkurrenz für den lohnverdienenden Konsumenten nicht der Zweck – und am Ende auch gar nicht das wirkliche Ergebnis – des gepriesenen „technischen Fortschritts“ im Kapitalismus. Was die Propagandisten dieses Fortschritts als dessen entscheidende Leistung anpreisen, nämlich dass eine durchschnittliche Lohnminute
glatt auf immer mehr Waren zugreifen kann, ist in Wahrheit ein Abfallprodukt der immer perfekteren kapitalistischen Ausnutzung der Arbeit im gesamtgesellschaftlichen Maßstab: der allgemein gestiegenen Ausbeute an Wert aus der bezahlten Arbeit – der Ausbeutungsrate.
Die Konsequenzen des kapitalistischen Fortschritts für die Lohnarbeiterschaft
Um den ‚Kaufkraft‘-Effekt gewinnsteigernder Produktionsmethoden als gesellschaftliche Errungenschaft für die Lohnbezieher hochzuhalten, muss man schon absehen – und sieht das IWK mit seiner Durchschnittsberechnung eines sich ständig positiv verändernden Verhältnisses zwischen einem bestimmten Lohnquantum auf der einen und den Warenpreisen auf der anderen Seite auch ab – von allen maßgeblichen Kalkulationen, die in Wahrheit über Kapitalaufwand, Kapitalertrag, seine Steigerung und damit darüber entscheiden, welche Rolle einer von diesen Rechnungen abhängigen Lohnarbeiterschaft darin zukommt, wie deswegen ihr Arbeiten aussieht und was sie am Ende wirklich an Geld in Händen hält und sich an Konsum leisten kann. In der kapitalistischen Wirklichkeit machen die, denen der Produktivitätsfortschritt laut IWK zugutekommen soll, ganz andere Erfahrungen, als die, dass ihre „Lohnminuten“ sich für sie immer mehr lohnen würden.
Um mit der vom IWK beschworenen Kaufkraft zu beginnen. Soviel steht fest, wenn schon die Anschaffung von Auto, Fernseher und anderen heutzutage unverzichtbaren Dingen eines mobilen, zeitlich und geldlich gut einzuteilenden Arbeitnehmerdaseins als Errungenschaft gelten: Mit der Freiheit des Konsums ist es materiell gesehen soweit nicht her; das Wirtschaftsinstitut vergisst ja auch selber nicht, all die elementaren Güter wie Wohnen, Gesundheit, Energieversorgung aufzuführen, die in der Lohnminutenrechnung zunehmend negativ zu Buche schlagen. Dass, Kaufkraftsteigerung hin oder her, die Einteilungssorgen nicht geringer werden, das liegt allerdings an der anderen Seite, der Organisation von Leistung und Bezahlung der immer produktiveren Arbeit, die die Auskenner und Ausrechner des Instituts nur als durchschnittlich verdiente Geldmenge pro Minute aufführen. Denn was die Konsumenten mit ihrer Kaufkraft an sinkenden Preisen freuen mag, hat für die Lohnempfänger einen Preis, den sie als Produktionsfaktor des Kapitals zahlen müssen und der für sie gleich doppelt anfällt: bei der Arbeit und beim Lohn.
Erstens fallen den Produktivitätsfortschritten massenhaft Lohnabhängige zum Opfer, werden Beschäftigte durch Arbeit einsparende Technik überflüssig gemacht und verlieren Arbeitsplatz und Lohn. Sie sind zu viele, zu teuer – gemessen an der immer anspruchsvolleren unternehmerischen Rechnung mit der Differenz zwischen bezahlter Arbeit und deren Geldertrag –, ein durch produktivere Maschinen zu ersetzender Kostenfaktor. Verringerter Arbeitsaufwand bedeutet wegen dieser Rechnung eben keine Ersparung an Arbeit für alle, sondern eingesparte Arbeitskräfte.
Zweitens begnügt sich das Unternehmen nicht mit der Lohnstückkostensenkung, die ihm der Ersatz bezahlter Arbeitskräfte durch produktivere Maschinen aufs Ganze gerechnet einbringt. Der Gewinn entspringt schließlich nicht aus den eingesparten Lohnkosten der nicht mehr angewendeten Arbeitskraft, sondern aus dem Einsatz der weiterhin angewandten Arbeiter, der mit geringeren Lohnkosten mehr Geldertrag zu erwirtschaften erlaubt. Davon können dann die Unternehmer nicht genug kriegen, sowohl was die Arbeitszeit als auch die möglichst kostengünstige Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse betrifft. Und dafür taugt die Produktivitätssteigerung dann auch noch in ganz anderer Weise. Jede Rationalisierungs
-Offensive ist unter der Regie der kapitalistischen Organisatoren immer auch ein Hebel, das Lohnniveau der weiterhin Beschäftigten „anzupassen“, also die Kosten für jede einzelne Arbeitsminute auch nominell zu senken. Durch den Einsatz neuester Technik wird die Trennung der produktiven und immer produktiveren Momente der Arbeit von der Tätigkeit der Arbeitenden vorangetrieben, bisheriges Können und Geschick hinfällig. Und das nutzen die Anwender der Arbeitskräfte nach den Gesetzen des Leistungslohns dazu, deren Leistung geringer zu bewerten, also geringer zu bezahlen. Mit dem „technischen Fortschritt“ werden Arbeitskräfte „dequalifiziert“; weil sie nur mehr einfachere Hilfsdienste an den gegenständlichen Kapitalbestandteilen leisten müssen, also auch leicht ersetzbar sind, werden ganze Teile der Belegschaft abgruppiert, verlieren ihren bisherigen Lohn, während ihre Arbeit zumeist an Eintönigkeit, Leistungsdichte und ‚Stress‘ gewinnt. Auch das, die pure Verdichtung der Leistung und pure Senkung des Lohns, trägt bei zur Steigerung der Produktivität des eingesetzten Kapitals, verbessert die Gewinnrechnung gerade so wie die Steigerung der Produktivität der Arbeit und macht die erst richtig lohnend.
Gemäß dieser Rechnung werden auch dort, wo sich zeitweilig oder dauerhaft technologische Produktivitätsfortschritte als nicht machbar bzw. als nicht lohnend, weil zu teuer, erweisen, die Arbeitskräfte für diesen Konkurrenznachteil haftbar gemacht: mit ihrer absoluten Leistungsbereitschaft und Billigkeit, für die die Unternehmer mit der Drohung des Arbeitsplatzverlustes sorgen; mit dem auch dem IWK wohl nicht unbekannten Ergebnis, dass gerade die miesesten Jobs auch die am schlechtesten bezahlten sind und dass es zur Normalität einer hochtechnisierten und hochproduktiven Ökonomie gehört, dass Millionen Arbeitskräfte mit mehr oder weniger ‚prekären Beschäftigungsverhältnissen‘ einen ganzen ‚Niedriglohnsektor‘ bevölkern.
Insgesamt nehmen mit den wachsenden produktiven Potenzen der Arbeit in Unternehmerhand also auch die unternehmerischen Mittel und Freiheiten zu, die Lohnsumme zu drücken, die Arbeitsleistung zu erhöhen, die Arbeitszeit gemäß den Betriebsbedürfnissen zu verlängern oder zu ‚flexibilisieren‘. Für die aber, die die Arbeit leisten, wird sie mit den kapitalistischen Produktivitätsfortschritten keineswegs produktiver. Sie gewinnen weder ständig an Mitteln noch an arbeitsfreier Lebenszeit, sondern erfahren beim Arbeiten und beim Geld, dass sie die Manövriermasse der Rechnung sind, die mit ihnen als Kostenfaktor angestellt wird. Sie rechnen daher auch nicht in immer kaufkräftigeren Lohnminuten, sondern können froh sein, wenn sie 35 Stunden und mehr arbeiten dürfen und einen Lohn verdienen, der für den Lebensunterhalt hinreicht. So macht sich im Arbeitsalltag der Lohnbezieher geltend, dass sie nicht die Subjekte und Nutznießer des vermehrten Reichtums sind, sondern mit ihrer Arbeit Mittel seiner Vermehrung in der Hand ihrer Anwender. Um auch das einmal in Minuten auszudrücken: In jeder Arbeitsminute, die Unternehmer verrichten lassen und bezahlen, ist mit den produktiven Fortschritten wachsender gesellschaftlicher Reichtum in Privathand eingeschlossen, von dem die Lohnarbeiter ausgeschlossen sind und der ihnen als vermehrte Geldmacht und Verfügungsmacht über ihre Arbeit gegenübertritt.
Der ideologische Ertrag der „Kaufkraft der Lohnminute“
Die immer kaufkräftigere „Lohnminute“ ist also eine pure Fiktion. Denn von all dem, was die wirklichen Gründe und Folgen der Produktionsfortschritte im Kapitalismus sind, abstrahiert das IWK zielstrebig und stellt damit die Sache gründlich auf den Kopf – für die eine Botschaft, auf die es ihm ankommt: Egal wie die Arbeits- und Einkommensverhältnisse der Lohnarbeiterschaft ausfallen, sie profitiert insgesamt vom kapitalistischen Fortschritt; ihr Wohlstand wächst – mit der steigenden „Kaufkraft der Lohnminute“ statistisch erwiesen und säuberlich ausgerechnet. So wird aus dem wachsenden Ausschluss der lohnarbeitenden Massen vom gesellschaftlichen Reichtum wachsende Teilhabe an ihm.