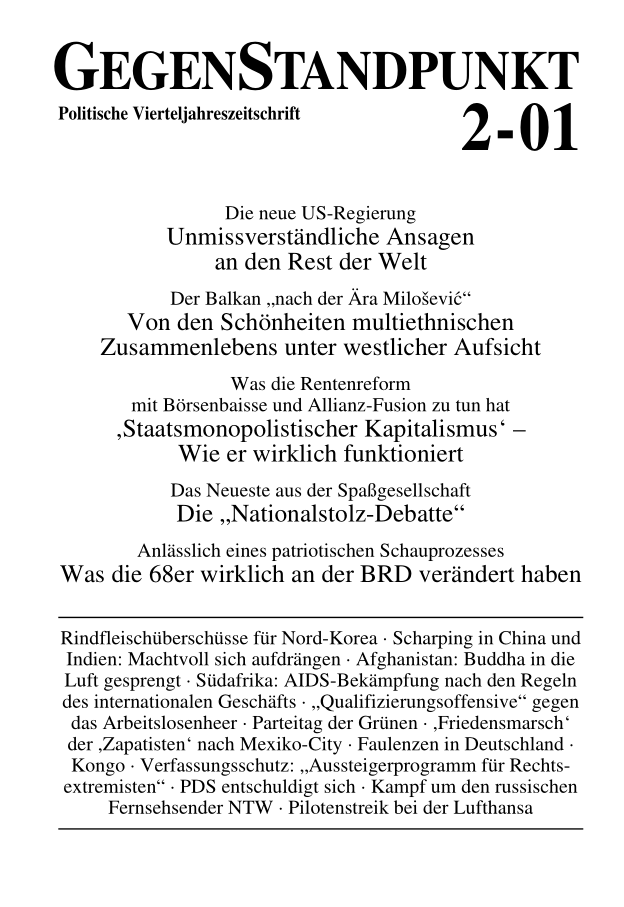Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Faulenzen in Deutschland:
Die neue Front im „Kampf gegen die Arbeitslosigkeit“
Kanzler Schröder will einschreiten gegen das „Faulenzertum“ unter den Arbeitslosen und eröffnet damit eine neue Offensive für die Senkung der Sozialkosten. Die ganze Nation ist für noch mehr Kontrollieren und Drangsalieren der Arbeitslosen, und „das tut dann die Regierung: Sie organisiert den Zwang zur Arbeit – auch ohne Arbeit.“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Faulenzen in Deutschland:
Die neue Front im „Kampf gegen die
Arbeitslosigkeit“
1.
Wer in der Demokratie schlecht regiert, wird abgewählt, siehe neulich Helmut Kohl. Sein Nachfolger nimmt deshalb nicht nur die Macht, auf die er scharf ist, in Kauf, sondern auch eine beträchtliche „Erblast“ – die allerdings gerne, weil sie schlagend beweist, dass besseres Regieren in Deutschland bitter vonnöten, also seine Kompetenz gefragt ist. Außer Schulden und Reformstau hat Gerhard Schröder über vier Millionen Arbeitslose von Helmut Kohl geerbt. Die skandalöse Rekordzahl spricht Bände, taugt folglich bestens als moralische Mehrzweckwaffe der neuen Regierung: Hinter den abstrakten Zahlen, die monatlich aus Nürnberg vermeldet werden, stehen 4 Millionen „Einzelschicksale“, lebende Dokumente der „Fehler und Versäumnisse“ der Kohl-Regierung; beliebig zitierbar für sämtliche Standortdefizite, allen voran die viel zu hohen Lohn(neben)kosten, die Gift für „Beschäftigung“ sind; zusammengefasst der sichtbare Ausdruck einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, welche die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer gemacht hat; und natürlich die Berufungsinstanz für die guten Absichten, die die neue Mannschaft verfolgt. Denn das versteht sich: bei der sozialen Frage, da haben die Sozis die Kompetenznase vorn! Zum Beweis, wie ernst es ihm ist, bietet der Kanzler dem Wahlvolk das Kriterium an, an dem es die Qualität der Regierungsarbeit objektiv und idiotensicher überprüfen kann: Den Erfolg der rotgrünen Herrschaft, so Schröder in seiner ersten Regierungserklärung, wolle er „am Abbau der Arbeitslosigkeit messen lassen“.
Seither tut die Regierung alles, um ihr Versprechen einzulösen. Damit Deutschlands Unternehmer wieder Freude an ihrem Beruf haben, spendiert sie eine Steuerreform, die den Mittelstand um 30 Milliarden entlastet; sie fördert die Umwelt mit einer Ökosteuer, welche die Rentenbeiträge „stabil“ hält, indem sie die Lohnkosten des Kapitals subventioniert; zusätzlich beschließt sie eine Rentenreform, die den Arbeitsmann ein Stück weit von staatlicher Bevormundung befreit und durch die Teilprivatisierung der „Altersrisiken“ außer den Lohnkosten auch die Sozialkassen schont; sie organisiert ein Bündnis für Arbeit, in dem „Beschäftigung“ so groß geschrieben wird, dass die Beschäftigten in Deutschlands Fabriken und Betrieben sich nur wundern können, wie „flexibel“ sie bei Arbeitszeit und Arbeitslohn sind, usw. Das alles tut dem Standort gut. Der Aufschwung kommt, das Wachstum wächst, die Wirtschaftsdaten „stimmen wieder“. Und das – weiß der Kanzler – ist der einzig gangbare Weg, um das große soziale Problem namens Massenarbeitslosigkeit zu meistern, unter dem nicht zuletzt sein Finanzminister leidet.
2.
Wie nicht anders zu erwarten, hat die Regierung zweieinhalb Jahre nach dem „Wechsel“ allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Sie hat den Reformstau aufgelöst, die wesentlichen Hindernisse für lohnende Beschäftigung aus dem Weg geräumt. Nur eine Rechnung ist nicht aufgegangen. Die Zahlen aus Nürnberg signalisieren, dass das Wachstum des Kapitals „am Arbeitsmarkt vorbeigeht“. Das ist zwar genau genommen keine übermäßige Überraschung, weil Deutschlands Unternehmer so kalkulieren wie immer: sie beschäftigen nur soviel Arbeit, wie sie brauchen können; und brauchen können sie nur solche, die rentabel ist. Dafür sorgen sie kräftig, mustern ihre Belegschaften durch, rationalisieren, sortieren aus; und dem Rest der Mannschaft machen sie Beine, flexibel genug sind sie ja.
Dem Kanzler gibt die Lage auf dem „Arbeitsmarkt“ allerdings zu denken. Ihm will nicht einleuchten, dass die Arbeitslosen so massenhaft teilnahmslos die Erfolgsstory begleiten, die seine Regierung schreibt. Er ist es leid, sich diesen Erfolg durch das Genörgel der Gewerkschaften madig machen zu lassen: die Regierung täte zu wenig, sie solle mehr Druck auf die Unternehmen ausüben, damit die ihre satten Gewinne „in Arbeitsplätze investieren“, statt immer nur umgekehrt aus Arbeitsplätzen Profite zu schlagen. Der Kanzler sieht die Sache so: Wenn die Regierung das Ihre getan und für die nötigen Rahmenbedingungen gesorgt hat; wenn daraufhin die Wirtschaft wächst und die Konjunktur nach oben zeigt; wenn dann trotz dieser blendenden Daten und allen Anstrengungen der Politik zum Hohn der „Beschäftigungseffekt“ so kümmerlich ausfällt, dann ist es allerhöchste Zeit, das Prüfverfahren für gutes Regieren einmal umzudrehen und die Arbeitslosen an den Leistungen der Regierung zu messen. Wenn die keine Anstalten machen, sich in vorzeigbarem und kostendämpfendem Umfang zu verflüchtigen, dann ist es keine Frage, auf wen hier „mehr Druck“ ausgeübt werden muss. Denn dann liegt es ja wohl auf der Hand, dass diejenigen, die angeblich nicht arbeiten dürfen, es in Wahrheit nicht wollen. Weswegen er ein Machtwort sprechen und ein für allemal klarstellen muss: Ein „Recht auf Faulheit“ gibt es in Deutschland nicht.
Wohl wissend, dass Denkanstöße in der Politik nur mit einer gehörigen Portion Denunziation Wirkung entfalten, regt Gerhard Schröder einen Diskurs zum Thema „Sozialmissbrauch“ an – und wird verstanden. Denn nichts ist in einer kapitalistischen Klassengesellschaft so populär wie die klassenübergreifende und jederzeit abrufbare Auffassung, dass Arbeitslosigkeit das sozialstaatlich subventionierte Privileg zum „Faulenzen“ sei. Zwar hält sich die individuelle Nachfrage nach dem Beruf des Arbeitslosen in Grenzen, aber der Verdacht, dass sich „Drückeberger“ hinter ihrem „Schicksal“ verschanzen, ist so lebendig wie die Demokratie, die ihn fördert. Nebenbei ist das ein schönes Urteil über die Arbeit im Kapitalismus und über das Glück, eine zu haben. Ihr Nutzen scheint jedenfalls so überragend, dass ihr Verlust wie Freizeit und Urlaub daherkommt. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil die Freigesetzten nicht gleich ins totale Elend abstürzen. Sie müssen nicht arbeiten und können trotzdem überleben! Dass der Staat ihnen die „Stütze“, die sie beziehen, zu Zeiten ihrer Beschäftigung zwangsweise vom Lohn abzieht, gilt da nicht als Einwand. Im Gegenteil: Es beweist ja nur, dass die Beschäftigungslosen die Solidarität der Beschäftigten „ausnutzen“. Auf diese Gedankenfigur versteht sich auch der Kanzler und liefert endlich die passende sozialdemokratische Antwort auf die „soziale Kälte“ der „Ära Kohl“.
3.
Das Echo folgt prompt: Ganz schön im Ton vergriffen hat sich der Schröder da, Stammtischmentalitäten aufgerührt, Populismus betrieben, die Arbeitslosen – nachhaltig die Zonis unter ihnen – beleidigt, an der (Ur-)Sache vorbeigeredet und von den eigenen Versäumnissen abgelenkt. Lauter Freunde der „sozial Schwachen“ melden sich zu Wort und geben ihre Wahrnehmung der Problemlage kund: Die Opposition, den Sorgen der kleinen Leute zugetan, gratuliert dem Regierungschef zu seiner Initiative, muss ihn aber im selben Atemzug der „Feigheit“ bezichtigen, weil er seinen Standpunkt weder bei den Gewerkschaften noch in seiner Partei durchzusetzen gedenkt. Die Bundesanstalt für Arbeit, die sich zu Recht angesprochen fühlt, nimmt ihre Schutzbefohlenen und sich selbst in Schutz und wartet mit einem interessanten Dementi auf: Mehr Druck auf die Arbeitslosen auszuüben, ist nicht nötig, da dem Zwangsregime des SGB III allenfalls die paar „schwarzen Schafe“ entkommen, die es überall gibt; und überhaupt sind die Zeiten, in denen man es sich als Arbeitsloser „bequem machen“ konnte, vorbei. Das soziale Netz, das wissen diese Experten, ist längst als umfassende rechtsstaatliche Drangsalisierung der Betroffenen organisiert. Die Öffentlichkeit argumentiert „differenziert“, wie es der Sache angemessen ist: „Pauschal“ kann man „nicht alle“ Arbeitslosen als Faulenzer verdächtigen, zumal den 4 Millionen nur ungefähr ein Zehntel an „offenen Stellen“ gegenübersteht, wo auch immer die sich gerade befinden. Die „Hauptursache“ der Arbeitslosigkeit bleibt „strukturell bedingt“, womit die Nebenursache ausgeguckt ist: jene, die „nicht arbeiten wollen, obwohl sie können“; hier besteht Handlungsbedarf.
Der Kanzler hat allerdings – und das weiß jeder – keinen Beitrag zur Ursachenforschung in Sachen Arbeitslosigkeit abgeliefert, mithin auch keinen „unsachlichen“; das ist gar nicht sein Job. Warum sollte ausgerechnet der oberste Standortverwalter die Notwendigkeit erläutern, mit der das kapitalistische Marktwirtschaften seine proletarische Reservearmee produziert! Was Schröder sich herausnimmt, weil es ihm qua Amt einfach zusteht, ist die Meinungsführerschaft in der aktuellen Ideologienbildung, also die regierungsamtliche Definition der Problemlage, die mit dem Begriff des „Sozialmissbrauchs“ schon erschöpfend beschrieben ist. Diese Begutachtung der Arbeitslosigkeit unter dem Aspekt der Schuldfrage entfaltet ihre – nicht nur – moralische Wirkung und ist keineswegs auf die „schwarzen Schafe“ als die eigentliche Zielgruppe gemünzt. Sie ist der praktizierte Generalverdacht gegen alle – und auch so gemeint. Denn gerade die mit dem Gestus des Verständnisses daherkommende Differenzierung zwischen unschuldigen, also „echten“ Arbeitslosen und „wirklichen“ Faulenzern macht das Überprüfen „jedes Einzelfalls“ so richtig notwendig und spannend. Kein Wunder, dass das allgemeine Beratschlagen, das der Kanzler in seiner volkstümlichen Art anzettelt, dann auch nach dem Geschmack demokratischer Feingeister „langsam an Niveau gewinnt“ (SZ), nämlich durch die vielen konstruktiven Sortierungsideen zur effektiveren Bekämpfung der „Massenarbeitslosigkeit“, die allesamt offenlegen, worin das Elend dieser „Volksseuche“ (ebd.) besteht: Deutschlands Arbeitslosen geht es zu gut. Trotz aller Reformen können sich vier Millionen ihre Beschäftigungslosigkeit offenbar leisten; glaubwürdige Unternehmer von Lauterbach bis Schweinfurt können einen Eid darauf schwören, dass sie schon mal „händeringend“ nach Personal gesucht und keines gefunden haben. Sie kennen Leute, die Arbeit ablehnen, nur weil deren Entlohnung sich auf dem Niveau der Sozialhilfe bewegt, die sie „umsonst“ bekommen. Ein unmöglicher Zustand! Der darüber binnen zwei Tagen hergestellte Konsens ist der erste, aber nicht der letzte Ertrag der von Schröder losgetretenen Debatte.
Was Arbeitslose sich „leisten“ können, beschreibt der neue Zeitgeist als die Pervertierung des Sozialsystems: Sie schaffen es tatsächlich, sich in ihrer Arbeitslosigkeit „einzurichten“. Damit darf sich „unsere Gesellschaft“ – schon im Interesse der Betroffenen – niemals abfinden. Ein schöner Einfall. Was sollen 4 Millionen Arbeitslose, wenn Erschießen schon nicht erwünscht und Arbeit nicht zu haben ist, schon großartig anderes machen, als sich mit ihrem längerfristig angelegten „Provisorium“ irgendwie zu arrangieren. Das „Geschick“, das sie dabei unanständigerweise entwickeln, orientiert sich an den Daten, die sie selber nicht erfunden haben, für die sie aber nichtsdestoweniger haftbar gemacht werden. Dass mit Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe kein proletarischer Haushalt mit Anstand über die Runden kommt, ist nach anderthalb Jahrzehnten Dauerreform der Sozialkassen und der ebenso traditionsreichen Senkung des nationalen Arbeitslohns als Bemessungsgrundlage hinreichend bekannt. Davon gehen ja auch alle aus, die das Schwarzarbeiten anprangern und so tun, als könne sich jeder Arbeitslose vor Angeboten und Gelegenheiten dieser Art kaum retten.
4.
Während dessen leistet die Arbeitsverwaltung im wirklichen Leben des bundesdeutschen Sozialstaats mit den Instrumenten des SGB III schon längst ganze Arbeit. Und zwar ganz im Geiste der von Schröder vorgegebenen Linie. Die unter den Kategorien Verfügbarkeit, Mobilität und Zumutbarkeit versammelten Rechtsansprüche des Staates definieren penibel und in allen Einzelheiten den Status des Arbeitslosen, also das Ensemble seiner Pflichten. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf den Freizeitwert der Berufsgruppe „Faulenzer“, schlägt auf den Tagesablauf der „Beschäftigungslosen“ nachhaltig durch und macht sich auch in Punkto „Gehalt“ und „Karrierechancen“ der Kostgänger der Nation geltend.
– Wer keine Arbeit hat, ist noch lange kein Arbeitsloser. Diesen Rechtsstatus muss der Mensch sich erwerben – durch Arbeit. Hat er das, kann er sich nicht einfach auf seine Rechte berufen und das ihm zustehende Arbeitslosengeld kassieren. Er muss „verfügbar“ sein, womit wiederum ein bisschen mehr gemeint ist, als die Adresse zu hinterlassen, unter der er erreichbar ist, wenn es ein Jobangebot gibt. Solche Angebote des Arbeitsmarktes, falls es sie denn überhaupt gibt, haben von vorneherein nicht die Qualität, dass der Arbeitslose sie nach eigenem Interesse prüfen und gegebenenfalls ablehnen kann; sie stehen für ein kapitalistisches Benutzungsinteresse, dem der Sozialstaat die Form eines prinzipiellen Verfügungsrechts über die Arbeitskräfte der Nation verleiht, indem er den Arbeitslosen die Verfügbarkeit als ihre erste und grundlegende Eigenschaft abverlangt. Sie müssen fähig und willig sein, sich jederzeit wieder in Lohnarbeiter zurückverwandeln zu lassen, und zwar zu den Konditionen, die der Sozialstaat definiert, der „bezahlt“ sie schließlich. Um verfügbar in dieser anspruchsvollen Bedeutung zu sein, ist von den Arbeitslosen zweitens „Mobilität“ verlangt. Einerseits im wörtlichen Sinn; denn dass die Menschen zu den Arbeitsplätzen zu wandern haben und nicht umgekehrt, versteht sich von selbst. Zweieinhalb Stunden Fahrt zur Arbeitsstätte definiert das Sozialgesetz derzeit als das Zeitmaß (von der Wirkung auf den verbleibenden Lohn ganz abgesehen), um das ein ausgefüllter Arbeitstag ergänzt werden kann, ohne die Menschenwürde von Lohnarbeitern zu verletzen. Die Grenze zur Schikane zieht der soziale Rechtsstaat nämlich durch die rechtlich einwandfreie Regelung der „Zumutbarkeit“, die er seinen arbeitslosen Massen aufs Auge drückt. Eine äußerst zweckmäßige Regelung, die vom Nutzen der Arbeit für die Beschäftigten kündet und die Quintessenz aller arbeitsfördernden Maßnahmen auf den Begriff bringt: Wenn schon das Glück, Arbeit gegen Lohn verrichten zu dürfen, eine einzige Zumutung ist, dann findet die „Förderung“ von Beschäftigung konsequenterweise in Form von sozialstaatlichen Zumutungen an die Beschäftigungslosen statt. Und deshalb müssen Arbeitsuchende noch in ganz anderer Hinsicht „mobil“ sein: bei ihrem „Entgelt“. Die 60% bzw. 53% ihres vorherigen Nettolohns, mit denen sie als „Empfänger von Leistungen“ auskommen müssen, bilden die ungefähre Richtzahl für den künftigen Bruttolohn, auf den sie sich einzustellen haben. Das SGB III hat den alten – auf zwei Jahre befristeten – „Berufsschutz“ praktisch liquidiert, so dass Herr und Frau Lohnarbeiter schon nach ein paar Monaten Beschäftigungslosigkeit „jede zumutbare Arbeit“ annehmen müssen, egal welchen Beruf sie vorher ausgeübt und welchen Lohn sie dafür bekommen haben.
– Die Tatsache, dass 4 Millionen Arbeitslosen, für die das Kapital definitiv keine Verwendung hat, auch nicht übermäßig oft ein Job angeboten wird, führt nicht dazu, dass sie in Ruhe gelassen werden. Im Gegenteil. Gerade dieses Missverhältnis von Angebot und Nachfrage macht es aus der Sicht des Staates notwendig, dass die Bundesanstalt sich mehr um ihre Klientel „kümmert“. Das Kümmern folgt einer ebenso einfachen wie zynischen Logik: Wer keine Arbeit findet, muss sich heftiger um eine bemühen. Sich selbst als das Hindernis für Beschäftigung zu definieren, dann aber auch als Bedingung für (aussichtslose) Beschäftigung herzurichten; die hohe Kunst der „erfolgreichen Bewerbung“ zu erlernen, um sich „besser verkaufen“ zu können; sich „marktgerecht zu qualifizieren“ durch „lebenslanges Lernen“ usw. – mit dieser Aufgabe wird das Heer der Beschäftigungslosen traktiert. Je fiktiver nämlich die „Vermittlungstätigkeit“ der Behörde ist, desto wüster fällt ihr Anspruch aus, der Arbeitslose solle durch eigene Anstrengungen seine „Vermittlungschancen“ verbessern. Und damit dieser Anspruch keine wirkungslose Phrase bleibt, organisiert die Behörde das Verbesserungswesen selbst. So kommen dann jährlich eine halbe Million freigesetzter Lohnarbeiter, die das Sozialgesetz erst einmal systematisch dequalifiziert, in den Genuss von „Qualifizierungsmaßnahmen“ aller Art. Die garantieren, ob als Nebeneffekt einkalkuliert oder gleich als Hauptzweck deklariert, vor allem eins: eine gewisse Sortierung der Reservemannschaft in die verschiedenen Abstufungen der Elendskarrieren. Denn das Angebot zu Weiterbildung und Umschulung – das erstens Ablehnen mit „Leistungsentzug“ bestraft und zweitens ganztätige Präsenz verlangt – legt manches offen, was daheim und im Verborgenen als „Sicheinrichten“ stattfindet und der Idee des Sozialstaats widerspricht: Frauen kassieren „Leistungen“ für einen verflossenen Ganztagsjob, obwohl sie inzwischen wegen Kindererziehung dem Arbeitsmarkt höchstens halbtags oder gar nicht zur Verfügung stehen; also erfolgt Anpassung der Leistung an die neue Lage oder gänzlicher Stopp. Andere offenbaren beim Test auf „Eignung und Interesse“ körperliche und/oder moralische „Defizite“; Verwahrlosungserscheinungen, die sich während 30 Jahren Lohnarbeit oder je nach dem auch 10 Jahren Arbeitslosigkeit „eingestellt“ haben; sie taugen für gar keinen Job mehr und sind ein Fall für die Sozialhilfe. Wiederum andere haben sich aufs gelegentliche Schwarzarbeiten verlegt und halten so den Luxuslebensstandard eines Durchschnittsproleten aufrecht. In all diesen Fällen sorgt jedenfalls schon die Präsenzpflicht bei der „Verbesserung der beruflichen Integration durch Qualifizierung“ dafür, dass nicht wenige der alternativlosen Berechnungen durchkreuzt werden und jährlich etliche Tausend aus dem „Leistungsbezug“ herausfallen. Gut, wenn auch nicht gut genug, ist das auf alle Fälle für die Arbeitslosenstatistik; und Entlastung schafft das, wenn auch viel zu wenig, für die Sozialkassen des Staates.5.Mit dieser Praxis der „Arbeitsförderung“ will sich der Kanzler nicht mehr zufrieden geben. Wenn die Arbeitslosenzahlen „trotz“ aller Anstrengungen seiner Regierung nicht runtergehen, dann kann dafür nicht die Regierung haftbar gemacht werden. Dann müssen die Arbeitslosen für die Misere haften, die die Nation mit 4 Millionen Unbrauchbaren hat. Der Vorwurf des „Sozialschmarotzertums“ gibt die neue Front im „Kampf gegen die Arbeitslosigkeit“ bekannt, und alle, die sich zu dieser moralischen Verantwortung bekennen – der Minister für Arbeit und Soziales mitsamt seiner Behörde, der Arbeitgeberpräsident, die Vertreter der vierten Gewalt –, reichen ihre Vorschläge ein, damit die Elendsgestalten sich nicht mehr in ihrem Elend „einrichten“ können.
– Als erstes müssen einmal die vorhandenen Förderungsinstrumente „geschärft“, sprich: die Sanktionen in Anschlag gebracht werden, die das Sozialgesetz vorsieht. Viel zu wenig Sperrzeiten werden in Deutschland verhängt: In Amerika wird jeder zweite Arbeitslose mindestens einmal im Jahr „gesperrt“, bei uns sind es nur 500000 (im letzten Jahr). Die Arbeitsämter klagen, dass sie gegen Leute, die eine „zumutbare Arbeit“ als unzumutbar ablehnen, „machtlos“ sind, weil das Bundessozialgericht entschieden hat, dass die „Beweislast“ beim Arbeitsamt und nicht bei den Arbeitslosen liegt. Außerdem, so hört man, werden die Arbeitsämter von den Unternehmern im Stich gelassen: Die rücken nämlich ihre „Informationen über Bewerber“ nicht heraus, machen sich zu Kollaborateuren von „Drückebergern“, nur weil sie das „Risiko eines Rechtsstreits scheuen“. Der Unternehmerverband hat eine bessere Idee und fordert vom Gesetzgeber, bei der anstehenden Reform des SGB III die „Umkehr der Beweispflicht“ zu verankern. Damit hätte kein Drückeberger mehr eine Chance.
– Bei aller Sanktionswut bleibt der Arbeitgeberpräsident realistisch. „Schärfere Sanktionen allein genügen nicht“ (Hundt). Man muss den Leuten Angebote machen, neben der Peitsche auch ein bisschen Zuckerbrot reichen. Als „besseren Anreiz“ zur Arbeitsaufnahme kann er sich vorstellen, dass die Zahlung der (einkommensbezogenen) Arbeitslosenhilfe konsequent und ohne Ausnahme auf 12 Monate beschränkt wird. Danach gibt’s nur noch Sozialhilfe, hierzulande immerhin die offizielle Maßeinheit für „Armut“; das müsste doch arbeitsförderlich sein. Glücklicherweise fällt dem Mann noch rechtzeitig ein, was er sonst noch weiß: Diese Armenspeisung ist immer noch eine viel zu bequeme Matratze, auf der sich Drückeberger ausruhen. Denn die Löhne, die Deutschlands Unternehmer zahlen, sind alles andere als eine attraktive Alternative zum sozialstaatlichen Almosen, schon gleich für Jobs, die für Langzeitarbeitslose vorgesehen sind, die liegen eher noch drunter. Was daraus folgt, ist klar: Ein vernünftiger „Abstand“ zwischen Lohn- und Sozialhilfeniveau muss her. Also runter mit der Sozialhilfe! „Arbeit muss sich wieder lohnen!“
– An „Anreize“ dieser Art denkt man im Hause Riester schon seit längerem. In diversen Bundesländern laufen „Modellversuche“, die eine „engere Kooperation zwischen Arbeits- und Sozialämtern“ austesten sollen. Der Minister plant, bis 2006 Sozial- und Arbeitsämter zu „verzahnen“ und „die Sozial- und Arbeitslosenhilfe auf dem Niveau der Sozialhilfe zusammenzuführen“ (Handelsblatt). Das hätte für die Leistungsempfänger einen doppelten Vorteil: Erstens könnten sich auch ganz „normale“ Arbeitslose an die menschenwürdige Rolle von Bittstellern und die entsprechende Praxis der Zuteilung von Kleidungs- und Lebensmittelgutscheinen gewöhnen. Und zweitens würden sie nicht mehr zwischen den Ämtern „hin und her verschoben“ werden – wegen Kompetenzstreitereien. Diese Schikane entfällt dann.
– Zuguterletzt gibt es noch eine echte Sensation: Die Arbeitslosenzahl ist weitaus niedriger, als bisher angenommen. Der Spiegel hat herausgefunden, dass von den 4 Millionen nur die Hälfte dem Arbeitsmarkt „wirklich zur Verfügung steht“. Die andere Hälfte – Alte, Kranke, Langzeitarbeitslose – kann abgeschrieben werden. Warum das bisher nicht geschehen ist, weiß der „Gesellschaftswissenschaftler“ Meinhard Miegel: Die „Sozialindustrie“ verteidigt ihre Pfründe. Gewerkschaftliche, kirchliche und private „Qualifikationsfirmen“ – auch das Drangsalieren der Arbeitslosen ist als Geschäftsgelegenheit organisiert – reißen sich um Staatsgelder und bilden Leute aus und weiter, die definitiv zu nichts mehr taugen. Getopt wird die Meldung dann noch von der christlichen Opposition: Wenn man die 2 Millionen verbliebenen Arbeitslosen noch gegen die 700000 Saisonarbeiter und die 1,3 Millionen Ausländer verrechnet, dann haben wir in Deutschland das, was wir seit Adenauer und Erhard schon immer hatten: Vollbeschäftigung.
Von wegen also ein „Beitrag zum Stammtisch“. Der Kanzler hat ein „Tabu gebrochen“, und die ganze Nation mobilisiert ihre marktwirtschaftlich-moralische Kompetenz; ist sich einig, dass Arbeit eine Gnade und sonst gar nichts ist; dass der Unterhalt von nicht arbeitenden Elendsgestalten das Geld nicht wert ist, was er kostet; kommt zu dem Schluss, dass diese Figuren unbedingt verbilligt gehören, also das Kontrollieren und Drangsalieren erst noch richtig zu organisieren ist. Das tut dann die Regierung: Sie organisiert den Zwang zur Arbeit – auch ohne Arbeit.