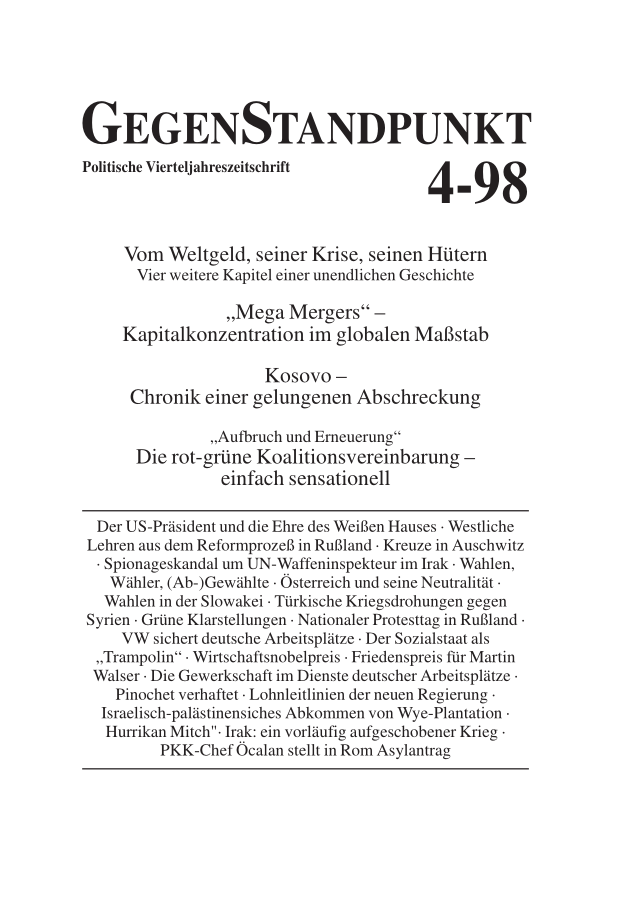Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Hurrikan „Mitch“ und die Folgen:
Die kapitalistische Bilanz einer Naturkatastrophe
Die katastrophalen Verwüstungen, die der Hurrikan in großen Teilen von Honduras und Nicaragua angerichtet hat, resultieren aus den erbärmlichen Lebensumständen, die der Naturkraft nicht gewachsen waren. Deswegen ist sofort klar, dass schon die Wiederherstellung der dort normalen Verhältnisse ohne auswärtige Hilfe undenkbar ist, die zwar großspurig angekündigt wird, im Resultat jedoch sehr schäbig ausfällt. Der Imperialismus kennt nämlich das eigentliche Opfer der „Naturkatastrophe“: Das ist er selber, dem die nützlichen Dienste der ruinierten Staaten abhanden zu kommen drohen…
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Hurrikan „Mitch“ und die
Folgen:
Die kapitalistische Bilanz einer
Naturkatastrophe
Ein Hurrikan verwüstet Honduras und Nicaragua. Die
Öffentlichkeit zählt die Leichen und registriert die
Schäden: Mindestens jeder dritte Bewohner des Landes
zählt zu den Geschädigten. Auch in Nicaragua das gleiche
Bild: zerstörte Häuser und Brücken, überschwemmte Felder
und von der Außenwelt abgeschnittene Dörfer… Die Behörden
schließen den Ausbruch von Seuchen nicht mehr aus.
(SZ 5.11.98) Zehntausende von
Toten, Hunderttausende von Obdachlosen, Ernte und
Viehbestand vernichtet… So etwa fällt die Bilanz der nach
allgemeiner Auskunft „größten Naturkatastrophe“ seit
Jahrzehnten in Mittelamerika aus. Wie wenn es ganz
natürlich wäre, daß das bekannte Zusammenspiel von warmem
Ozean und tropischer Luftzirkulation in Gestalt von
Wirbelstürmen und nachfolgenden Unwettern die Bevölkerung
mehrerer Länder katastrophenartig überfällt, schlagartig
ihre sämtlichen Lebensbedingungen zerstört und „Tote und
Chaos“ zurückläßt. Da die Medien schneller als die
Hilfslieferungen überall vor Ort sind, um ihrem Publikum
die Wirkungen der Naturkatastrophe zu veranschaulichen
und zu deuten, erfährt man nebenbei denn auch einiges
über die katastrophalen normalen Lebensverhältnisse, die
der Wirbelsturm so nachhaltig durcheinandergebracht hat.
Die vielen Armen in Tegucigalpa leben an den Hängen
der Berge, und so manche Hütte aus Holz oder Karton hält
nicht einmal heftigem Regen stand.
(SZ 5.11.) Das ist nämlich so üblich in
Ländern, die auf das Exportgeschäft mit Naturprodukten,
in diesem Fall Bananen und Kaffee, ausgerichtet sind. Die
Plantagenwirtschaft ausländischer Konzerne hat da schon
längst die Bevölkerung von den fruchtbaren Böden
verdrängt und ihnen die Subsistenzgrundlagen geraubt; in
den Städten sammeln sich dann die Massen in den
Elendsvierteln, die die Bodenspekulation ihnen läßt. Kein
Wunder also, daß ganze Wellblechdörfer im Schlamm
versinken und das Land weggeschwemmt wird. Denn die
Massen geraten nicht erst jetzt in Not, sie sind es
längst: Schätzungen zufolge ist mehr als die Hälfte in
Nicaragua ohne Arbeit
(FAZ
4.11.), damit auch ohne Auskommen, denn von einem
Lohn abhängig sind sie auch in diesen Ländern, in denen
das Geld regiert, Gelegenheiten, Geld zu verdienen, für
die meisten aber nicht existieren, weil amerikanische
Bananen-Companies und Kaffee-Handelsgesellschaften die
einzig funktionierende Reichtums-, also auch
Beschäftigungsquelle sind.
Ein bißchen liegt es also schon noch an den Voraussetzungen, auf die die Laune der Natur trifft, wie sich die „Naturgewalten“ auswirken. Schließlich hat der Süden der USA vergleichbare Katastrophen ganz anders überstanden. Um schlagartig solche verheerenden Wirkungen zu produzieren, braucht es schon die Elendsumstände von Ländern, die als Anhängsel des Weltmarkts fungieren, in denen alles auf Dollars ausgerichtet ist, ziemlich wenig Volk zur Vermehrung des $-Reichtums in anderer Hand gebraucht wird und der überflüssige Rest von der jeweiligen Staatsgewalt unter Kontrolle gehalten wird, auf daß er nicht störend auffällt. So ganz natürlich oder bloß einer notorischen Verantwortungslosigkeit dortiger Politiker geschuldet ist es ja nicht, daß der nationale Warndienst nicht funktioniert – von irgendeiner staatlichen Vorsorge gegen die regelmäßigen Unwetter ganz zu schweigen; daß in Nicaragua aus dem Bürgerkrieg immer noch massenhaft Minen herumliegen, die jetzt freigeschwemmt worden sind; daß 60% der Kinder unterernährt und daher für Krankheiten anfällig sind; daß es an Chlortabletten gegen Cholera fehlt; daß die nach den letzten Katastrophen geflossenen Hilfsmittel und -maßnahmen in „dunklen Kanälen“ versackt sind. Und es müssen schon die ehernen Gesetze der Marktwirtschaft gelten, wenn sich jetzt wegen der veränderten Verhältnisse von Nachfrage und Angebot auf dem Lebensmittelsektor schlagartig die Preise für Grundnahrungsmittel verdoppeln – „Knappheit treibt Preise hoch“, vermeldet die Presse kurz und bündig –, wenn Trinkwasser nur gegen unerschwinglich viel Geld zu haben ist und wenn die Bananen-Gesellschaften wegen des aktuell daniederliegenden Geschäfts ihre paar tausend Arbeiter entlassen…
So will die öffentliche Berichterstattung, die jetzt wegen der Verwüstungen mal wieder einen Blick auf diese Länder wirft, das alles allerdings nicht verstehen. Wenn sich die Medien der „Not in diesen Ländern“ widmen, dann ist unterstellt, daß an deren Ursachen nichts zu kritisieren und nichts zu ändern ist. Im Gegenteil! Die ausnahmsweise, katastrophenhafte Dimension des Elends, die sie dem Wirken der Natur zuschreiben, schreckt sie auf. Daran gemessen ist für sie die alltägliche kapitalistische Massenarmut die „Normalität“; daß bei der dort herrschenden „Unterentwicklung“ massenhaft Opfer anfallen, daran haben sie sich gewöhnt. Jetzt nach der Katastrophe kann man bestenfalls diese dort normalen Verhältnisse wiederherstellen – und auch das nur mit viel Mühe und unendlich viel internationalem Aufwand.
Denn das ist klar: Das bringen die aus „eigener Kraft“
nicht hin. „Wir“ sind gefragt, die reichen Länder.
Freilich, die Hilfe gestaltet sich schwierig, heißt es.
Was leicht geht, ist, daß prompt die internationalen
Medien mit ihrem Gerät vor Ort sind; sehr flott sind auch
in Katastrophenhilfe bekanntlich bewanderte ausländische
Politiker zur Stelle – amerikanische Ex-Präsidenten, die
Gattin des Vizepräsidenten, aber auch unsere neue
Ministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die
überreichen persönlich Hilfspakete und machen sich „ein
Bild der Lage“; d.h. sie lassen sich sehen und tun ihre
autorisierte Sicht der Lage kund: Selbstverständlich muß
alles getan werden, um „schnell, unbürokratisch,
entschlossen die Not zu lindern“. Die benötigten Mittel,
die es anderswo ja durchaus reichlich gibt, in
ausreichender Menge zu mobilisieren, kommt dagegen
überhaupt nicht in Betracht. Genügend Aufräummannschaften
abzukommandieren, die benötigten Hilfsgüter dorthin zu
schaffen – unmachbar! Die großartig verkündeten
Hilfsmaßnahmen und -angebote, welche die Politiker von
„der Welt“ verlangen und im Namen ihrer Länder anbieten,
fallen vergleichsweise lächerlich aus, so daß
Journalisten – obwohl sie täglich neue Hitlisten
veröffentlichen: nach zwei Tagen dank Amerika, Panama und
Mexiko „schon 14 Helikopter im Einsatz.“ (NZZ 5.11.) – darüber berichten müssen,
daß einfach von allem zu wenig da ist: zu wenig
Nahrungsmittel, zu wenig Hubschrauber und
Frachtflugzeuge. Es wird nämlich auch hier gerechnet! Die
Hilfen werden in Geld bemessen, ganz bürokratisch im Etat
von internationalen Hilfsorganisationen bilanziert, als
ein „humanitärer“ Sonderposten im Staatshaushalt
verbucht. Und das ist für alle, die nach entschlossener
Hilfe gegen die „unermeßliche Not“ rufen, so
selbstverständlich, daß keine Zweifel an den
menschenfreundlichen Absichten ihrer Politiker aufkommen,
wenn die lächerlichen Ergebnisse dieser
Hilfsanstrengungen vermeldet werden. Daß Deutschland nach
einer Woche bei versprochenen 10 Millionen angelangt ist,
ist für sie nicht kritikabel; noch weniger drängt sich
ihnen ein Vergleich der bereitgestellten 19
US-Hubschrauber und 3 amerikanischen Frachtflugzeuge mit
dem gleichzeitigen Aufmarsch der US-Army gegen den Irak
auf. Wenn die Geldzusagen mager ausfallen, dann ist das
ihrer Meinung nach kein Hinweis darauf, daß die
Verantwortlichen für „Hilfe“ mehr nicht für nötig halten;
das liegt an der prinzipiellen Begrenztheit des Stoffs,
über den die reichen Länder gebieten und mit dem sonst
alles geht: Gegen zuviel Wasser hilft kein Geld.
(SZ 9.11.) Die
Naturkatastrophe ist einfach zu groß ausgefallen. Dann
reichen auch die privaten Geldspenden, zu denen die
Politiker, deren Hilfsmöglichkeiten so schnell an
Schranken stoßen, ihre Bürger aufrufen. Zynisch? Mag
sein, aber durchaus sachgerecht!
Die „freigemachten“ Finanzmittel, die sich vom Standpunkt
der beschworenen „Not“ und der Reichtumsbilanzen der
„Helferländer“ so mager ausnehmen, sind durchaus
verantwortlich bemessen, wenn man den wirklichen Schaden
ins Auge faßt, dem da abgeholfen werden soll. Der besteht
nicht in Toten und ruinierten Lebensumständen, sondern
bemißt sich in nationalen Bilanzen und Gewinnziffern:
Auf mindestens zwei Milliarden Dollar beläuft sich der
Schaden für Honduras.
(SZ
5.11.) Die Summe entspricht einem Drittel der
jährlichen Wirtschaftsleistung.
(FAZ 6.11.) Honduras wird nach
Einschätzung der betroffenen Firmen im kommenden Jahr
wahrscheinlich keine einzige Bananenstaude exportieren
können. 1997 waren Bananen nach dem Kaffee das
zweitwichtigste Ausfuhrprodukt und trugen mit 255
Millionen Dollar ein Fünftel zum Devisenaufkommen bei. In
Honduras wurde etwa ein Zehntel der
Bananen-Weltmarkternte eingefahren.
(FAZ 7.11.) Geschädigt sind also die
Staaten mit ihren ohnehin mageren
Einnahmen, betroffen ist deren „hoffnungsvolle
Entwicklung“, die im Wirtschaftsteil kundig ausgemalt
wird:
„Noch vor wenigen Wochen sah die Zukunft für Nicaragua und Honduras im Vergleich zu früher recht rosig aus… noch in diesem Jahr würde der wirtschaftliche Aufschwung durch die geplanten Privatisierungen von Staatsbetrieben und erhebliche Auslandsinvestitionen zusätzliche Dynamik erhalten… aufgrund der strikten marktwirtschaftlichen Politik die Inflationsrate von mehreren Tausend Prozent auf rund zwölf Prozent gesenkt… Wirtschaftswachstum… Die Hoffnung auf Auslandsinvestitionen und Touristen sind in Honduras und Nicaragua nun vergessen.“ (SZ 11.11.)
Geschädigt sind nicht die Massen, die nach der penibel
geführten Statistik zu 60% „unterhalb der Armutsgrenze
leben“. In einer ganzen Region sind auf einen Schlag die
so nützlich geregelten Verhältnisse, denen die Massen
ihre alltägliche Armut verdanken, grundsätzlich
durcheinandergeraten: Nicht nur die privaten
Geschäftsrechnungen und nationalen Bilanzen, die paar
profitablen Unternehmungen in ausländischer Hand und die
Deviseneinnahmen der Staaten vor Ort sind erst einmal
dahin. In Frage gestellt sind damit auch und vor allem
die Dienste dieser Staatsgewalten für den Weltmarkt und
ihre gelungene Einsortierung in eine Weltordnung, in der
sie vornehmlich darauf zu achten haben, daß Bananen- und
Kaffee-Exporte unbehelligt von den inneren Zuständen
ihren Gang gehen, die Massen sich nicht störend bemerkbar
machen, das für notwendig erachtete Elend eingehegt
bleibt, keine politischen Abweichungen wie vor Jahren die
Sandinistenregierung in Nicaragua mehr vorkommen und
Guerillabewegungen wie in Guatemala erledigt werden. „Die
Welt“ ist also „herausgefordert“ durch den drohenden
Ausfall der staatlichen Ordnung. Eine Flüchtlings„welle“,
die der amerikanische Ex-Präsident Bush beschwört, muß
verhindert werden; die nutzlose absolute Armut soll
schließlich dort beheimatet bleiben, wo sie produziert
wird. Außerdem fällt mit den mageren Devisenquellen auch
die Bedienung der Schulden aus, die das bleibende
Ergebnis der großartigen Entwicklung hin zu mehr Wachstum
und Wohlstand sind. Denn der größte Teil der
Exporteinnahmen ist für die Schuldenbedienung reserviert,
wie man jetzt beiläufig von den Kennern in den
Redaktionsstuben erfährt, die öffentlich ohne Scheu
vorrechnen, daß die in Geld gemessenen Schäden fast die
Höhe der bestehenden Auslandsschulden erreichen –
versunken in Schlamm und Schulden
(SZ 10.11.).
Diese schönen Verhältnisse sind jetzt also durcheinandergekommen. Diese „Ausnahmesituation“ muß beseitigt werden. Es braucht wieder berechenbare Zustände. Weil klar ist, daß die betroffenen Staaten die gar nicht „aus eigener Kraft“ wiederherstellen können, weil sie selbst nicht der Garant der bei ihnen erwünschten Verhältnisse sind, wird sich anderweitig darum gekümmert, die elementaren staatlichen Funktionen wieder in Gang zu bringen. Die Instanzen, die ohnehin alle Verhältnisse dieser Länder kommandieren, organisieren nach ihren Nützlichkeitserwägungen die Einhegung des Schadens, dem die örtlichen Macher nicht gewachsen sind. Und da es sich um Länder handelt, die keinen bedeutenden Beitrag für das kapitalistische Geschäft anderswo leisten, fällt der Aufwand begrenzt aus: Die paar Weltmarktgeschäfte wieder auf die Beine stellen, das bißchen Infrastruktur, das es für die braucht, wieder in Gang bringen, das Volk wieder dauerhaft verstauen, allzu massenhaftes Verhungern verhindern, drohende Seuchen nach Möglichkeit eindämmen – das ist es dann auch schon, was an internationalen Anstrengungen für erforderlich gehalten wird. Und das läuft unweigerlich darauf hinaus, daß nicht einmal das zustandekommt, was als Zweck des großen internationalen „Hilfswerks“ angegeben wird: „Wiederherstellung“.
Beabsichtigt ist nämlich etwas anderes: die künftige Wieder-Indienstnahme. Weil es darum und um die Regelung der unterschiedlichen Betroffenheit von Regionalmächten wie Mexiko, des Generalzuständigen Amerika und der sonstigen Oberverwalter des Weltmarkts geht, ist eine gewisse Konkurrenz der Helfer darum, wer bei der gemeinsamen Begrenzung des Schadens eine Rolle spielt, nicht zu übersehen. Umgekehrt entdecken die beschädigten Länder in der internationalen Aufmerksamkeit, die ihnen die Naturkatastrophe hat zuteil werden lassen, die Chance, sich eventuell eine Förderung zu sichern, die für sie unter normalen Umständen gar nicht zu erwarten steht. Sie verweisen auf die Zerstörungen, beschwören ihre ökonomische Notlage und fordern eine Art „Marshallplan für den Aufbau Lateinamerikas“. Sich als Objekt auswärtiger Rechnungen bei den richtigen Adressen in Erinnerung zu bringen, dafür sind die Zerstörungen also gut. Die betroffenen Länder wissen bei der „Bewältigung der Not“ daher auch zwischen richtiger und falscher Hilfe politisch zu unterscheiden: Die nicaraguanische Regierung lehnt die angebotenen Ärzte aus Kuba dankend ab; man hat doch nicht die Sandinisten erledigt und sich den Segnungen von Marktwirtschaft und auswärtiger Privatinitiative verschrieben, um sich jetzt zum Objekt kubanischer Propagandamaßnahmen machen zu lassen! Man setzt schließlich auf andere Unterstützung.
Und in gewissem Sinn geht die Rechnung auch auf! Die Adressaten der Hilfegesuche haben zwar nichts mit einem Restauration dieser Region im Sinn; aber was die aufgelaufenen Verbindlichkeiten angeht, drängt sich ihnen das Problem der fälligen Zinsen auf, die gegenwärtig uneinbringlich sind: Die Kreditbedienung ist bis auf weiteres nicht mehr möglich. Daher kommt als großartiges und gar nicht mehr zu überbietendes Hilfsangebot die Möglichkeit eines partiellen Schuldenerlasses bzw. der vorläufigen Stornierung und langfristigen Umschuldung der Verbindlichkeiten ins Gespräch. Deshalb beratschlagen die Gläubigernationen darüber, welches neue Schuldenmanagement für diese Länder fällig ist: Verständigung unter ihnen tut not, was diese Posten noch wert sind und wie sie die Schuldner instandsetzen wollen, ihre Dienste wieder aufzunehmen. Da es sich vom Standpunkt der Gläubiger ohnehin um keine großen Summen handelt, gehen einige demonstrativ mit „gutem Beispiel voran“ und streichen wie Frankreich die Schulden. Andere, wie unser grüner Außenminister, geben zu bedenken, daß dies nur gemeinschaftlich und im Rahmen des Pariser Gläubigergremiums zu regeln sei; schließlich ist jede Umschuldungsvereinbarung eine Konkurrenzangelegenheit zwischen den betroffenen Gläubigernationen. Die endgültige Beschlußfassung ist für Dezember vorgesehen. So mündet eine Naturkatastrophe umstandslos in die allerhöchsten Kreditfragen und in den Streit um die Modalitäten eines neuen Schuldenmanagements, weil eben auch die „ärmsten Länder“ ein Bestandteil des globalen Geschäfts- und Finanzwesens, also „unserer Interessen in der Welt“ sind.
Die Medien wissen diese Leistung des Wirbelsturms
gebührend zu schätzen: „Einen Vorteil hat der Hurrikan
‚Mitch‘: Er hat das alte Thema Schuldenerlaß für die
Drittweltländer wieder aufgewirbelt.“ (SZ 13.11.) Allerdings birgt das in den
Augen der hiesigen Öffentlichkeit auch Gefahren. Sie
behandelt nämlich die offizielle Anerkennung der
Tatsache, daß die Schuldner nicht mehr in der Lage sind,
die Hälfte ihrer Exporteinkünfte gleich bei den
auswärtigen Banken abzuliefern, weil sie bis auf weiteres
gar keine Einkünfte mehr haben, ganz im Sinne ihrer
Politiker wie ein Entgegenkommen für Notleidende, das
ihnen mit einem Schlage Geld beschert. Die Schuldner
verfügen wegen der Stornierung der Zinszahlungen nach
ihrer Milchmädchenrechnung demnächst womöglich über einen
Kredit von einer halben Milliarde, um „die Not zu
lindern“. Dieses öffentlich ermittelte Vermögen – samt
der Aussicht, daß den Ländern die gesammelten Hilfsgelder
und womöglich auch noch neuer Kredit zufließen – ist für
die hiesigen Kenner der Sitten und Gebräuche in den
Ländern da hinten prompt Anlaß für Bedenken der höheren
Art: Das darf kein Präzedenzfall für andere säumige
Schuldner werden; Katastrophen solcher Art gibt es
schließlich laufend in den einschlägigen Ländern! Die
Verwendung dieser Gelder muß unbedingt international
überwacht werden, am besten muß jedem Minister vor Ort
ein ausländischer Kontrolleur beigesellt werden, damit
die auf keine falschen Gedanken kommen! Denn Vorsicht ist
geboten, wenn „wir“ deren Verpflichtungen auch nur ein
bißchen lockern. Deren Schulden stellen nämlich einen
heilsamen Zwang dar, dessen erzieherische Wirkung man gar
nicht hoch genug veranschlagen kann: Wenn der
Schuldendruck wegfällt, könnte die Regierung auf die Idee
kommen, Projekte in die Tat umzusetzen, von denen sie
schon immer träumte. Und weil das Geld kostet, nimmt sie
erneut Kredit auf.
(SZ
13.11.) Geld in den Händen dieser Staaten –
einfach unmöglich. Also braucht es ein strengeres Regime
über diese Länder, ein viel weitergehendes noch als es
das in Gestalt der eingerichteten Abhängigkeiten, der
Schuldenverpflichtungen und ihrer internationalen
Verwaltung durch Pariser Club, IWF und Weltbank ohnehin
gibt!