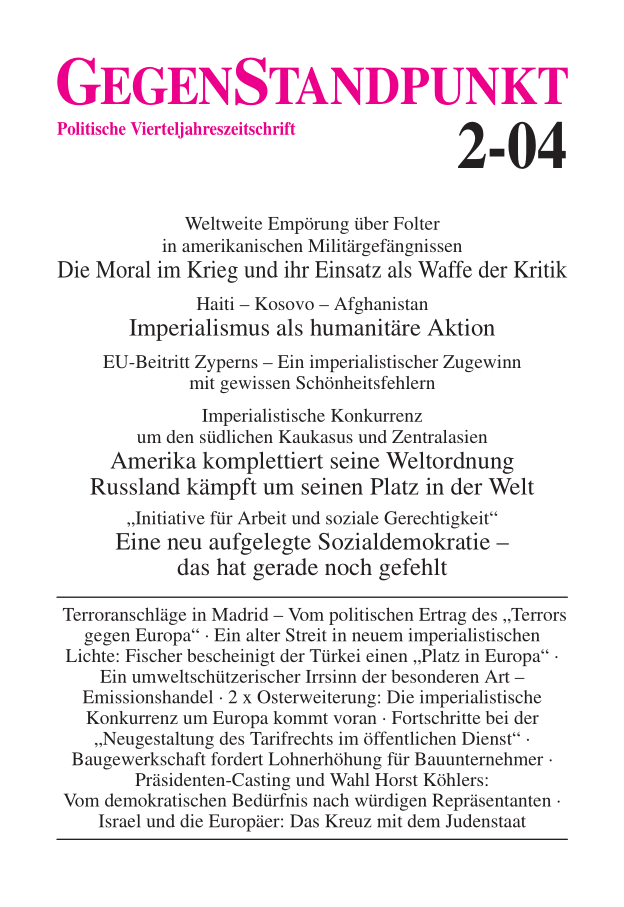Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Präsidenten-Casting und Wahl Horst Köhlers:
Wie die demokratische Herrschaft das Bedürfnis des Volkes nach würdigen Repräsentanten erst schürt und dann bedient
Die Besetzung des verfassungsrechtlich höchsten Postens, den Deutschland zu vergeben hat, ist Sache der Bundesversammlung, die sich alle fünf Jahre trifft und feierlich den „Ersten Bürger im Staate“ inthronisiert. Sie loben einen der Ihren als den „Besten“ aus und präsentieren das Ergebnis ihrer internen Machtkonkurrenz vor laufenden Kameras. Diesmal aber soll das heitere Präsidentenraten zum „Schmierentheater“ missraten sein.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Präsidenten-Casting und Wahl Horst
Köhlers:
Wie die demokratische Herrschaft das
Bedürfnis des Volkes nach würdigen Repräsentanten erst
schürt und dann bedient
An sich hat das Grundgesetz alles gut geregelt: Neben dem garantierten Recht auf Eigentum, der bewaffneten Landesverteidigung und seiner unantastbaren Würde steht dem Menschen auch ein Bundespräsident zu. Die Besetzung des verfassungsrechtlich höchsten Postens, den Deutschland zu vergeben hat, ist Sache der Bundesversammlung, die sich alle fünf Jahre trifft und feierlich den „Ersten Bürger im Staate“ inthronisiert. Die Jury zum Casten des „geeigneten“ Kandidaten stellt die jeweilige Mehrheit der herrschenden Parteien: Sie loben einen der Ihren als den „Besten“ aus und präsentieren das Ergebnis ihrer internen Machtkonkurrenz vor laufenden Kameras.
Diesmal aber soll das heitere Präsidentenraten zum „Schmierentheater“ missraten sein. Mit der „Demontage“ des zunächst favorisierten Schäuble und ihrem „Gezerre“ um den Ersatzmann sollen CDU/FDP „parteipolitische Eitelkeiten über die Würde des Amtes“ gestellt und zur „Verachtung von Politikern“ beigetragen haben. Die Messlatte der öffentlichen Kritik an der Berufung Köhlers ist aufschlussreich, denn sie zeugt vom Bedürfnis nach Achtung vor dem herrschenden Personal. Wo das Verfahren geächtet wird, ist eine unbeirrbar hohe Meinung von dem Amt unterwegs. Es gehört nicht in die ‚Niederungen der Machtpolitik‘: So wird der Würdenträger und dessen Aufgabe vor Verunglimpfung in Schutz genommen. Die Kontrolleure politischer Kultur klagen als Anwälte des Volkes: Dessen Recht auf respektable Oberhäupter habe die Politik zu „entsprechen“. Dabei sprechen sie – indem sie das „Ansehen der Politik“ bekümmert – selbst aus, dass es umgekehrt ist: Das Bedürfnis nach würdigen Repräsentanten, vor denen der Bürger gerne den Hut zieht, ist eines der Herren der Nation; also tun sie einiges für dessen Herstellung im Volk.
Warum und zu welchem Zweck: Dafür ist die deutsche Präsidentenwahl ein Lehrstück in 4 Akten.
1. Das Amt
Moderne Staaten halten zusätzlich zu dem Personal, das die Staatsgewalt exekutiert, ein Sonder-Angebot bereit: Eine Figur, die die Ehrbarkeit und Menschlichkeit der Staatsmacht, die Einheit der Bürger mit ihrem politischen Gemeinwesen, den Glanz der Herrschaft und zugleich ihre Volksverbundenheit repräsentiert. Für diese Figur, die als Queen, spanischer König oder eben deutscher Präsident kein Politiker der Legislative und Exekutive ist, soll ein äußerst unschuldig gemeinter, weil „nur“ repräsentativer Auftrag gelten, der sie aus dem „schmutzigen Geschäft“ der unmittelbaren Anordnung von Diensten heraushebt: In einem vom Alltag der Staatsmacht betont getrennten Personal sollen Größe und Ehre der Nation Anerkennung erfahren. Solches halten viele Verfassungen für zweckmäßig und das hat seinen guten Grund: Die Ausübung der Herrschaft geht einfach nicht ohne Gegensätze zwischen Regierenden und Regierten ab. Die Spitze des Staates als gesonderte Repräsentation seiner Einheit mit dem Volk einzurichten, ist darauf berechnet, die unübersehbaren Gegensätze als dem Ganzen dienliche, nur der Einheit wegen fällige Verlaufsformen im Miteinander von Volk und Staat hinzustellen. Dazu braucht es eine Figur, die für keine Rentenreform und Tabaksteuer verantwortlich ist, auch nicht für Arbeitsplätze und Armut, erst recht für keine Aufrüstung und keinen Krieg – die lediglich Schönredner der im Prinzip achtbaren Anliegen der Politik ist, personifiziertes Aushängeschild der natürlichen Identität des nationalen Kollektivs, darin Verkörperung der menschlichen Güte der Herrschaft, die sich via Kutschfahrten, Kondolenzbesuchen in Hochwassergebieten, Kriegslazaretten oder Waisenhäusern, Sportlerehrungen und Bürgerfesten „zum Anfassen“, also wie von du zu du gibt. Kurz: Eine Figur, bei der sich jedem Bürger der Gedanke aufdrängt, dass, „wenn nur alle Politiker so wären, im Lande alles zum Besten stände“. Diese Figur ist in Deutschland, ganz ohne blaues Blut, der Bundespräsident.
Seine Aufgabe: Den täglich herzustellenden
Schulterschluss von Machern und Mitmachern als notwendige
Anstrengung aller für das Gemeinwesen zu deuten,
dem man wegen gemeinsamer Erbmasse & Geschichte,
vorzüglicher Dichter & Denker, spezieller Mahlzeiten &
Volkstänze, vor allem aber wegen geteilter Werte
angehöre, also auch verpflichtet sei. Die Stellung des
Präsidenten als „Erster Bürger im Staate“ pflegt den
Schein, für die verlangte Unterordnung gäbe es einen
gleichermaßen natürlichen wie guten Grund. Zum
Propagieren einer nationalen Identität
, die Oben
und Unten, Arm und Reich, jenseits aller Differenzen und
Gegensätze zu einem kollektiven „Wir“ schmiedet als auch
persönlich auszeichnet, braucht es in der Tat keine
Befugnisse ausführender Gewalt; dafür hat der Präsident
die Lizenz zum Predigen. In unweigerlich „großen
Reden“ erzählt er den „lieben Landsleuten“, dass die
Werke seiner regierenden Kollegen nicht nur recht,
sondern auch billig waren: Die Politik ist ihrem
sittlichen Auftrag nachgekommen („Verantwortung“), Opfer
sind die erste Bürgerpflicht („Ruck“), Deutschland ist
ein schönes Land („Heimat“); und wenn er beim Montieren
der 3 Textbausteine – Ethik der Macht, Dienst ist geil
und die Nation das Höchste – nicht stottert, wird er auch
nicht ausgelacht. Denn für den Schwindel hat
ein guter Präsident gerade zu stehen: Die
ideelle Versöhnung von Volk und Nation, die er nicht nur
zur Weihnachtszeit zu beschwören hat, soll ihm nicht etwa
qua Amt, sondern auf Grund seines unwiderstehlichen
Geistes und einnehmenden Wesens
gelingen. Das demokratische Quidproquo der
„Führungspersönlichkeit“ ist hier zur eigenen Profession
geronnen: Frei vom Verdacht, sich mit dieser Angeberei
nur beim Wahlvolk anzuwanzen, verfügt ein Präsident
nahezu unvermeidlich über Charisma, wenn er
„Hoch auf dem Gelben Wagen“ singt (Scheel) oder
„Machtvergessenheit und -besessenheit“ der Politiker
anprangert (Weizsäcker).[1] Das Konstrukt einer extra
Staatsspitze, die das innige, quasi familiäre Verhältnis
von Volk und Macht verkörpert, zielt also voll aufs
nationale Gemüt, das sich von seinen
grundgütigen „Landesvätern“ genau so ergreifen lassen
soll wie von der in dieser Hinsicht unerreichten,
allerdings verblichenen „Prinzessin der Herzen“, Lady Di.
Und die jeweilige Livebesetzung hat für das Ideal einer
überzeugenden Autorität, zu der mündige Bürger
als Vorbild aufblicken können, mit ihrem privaten
Lebenswandel in aller Öffentlichkeit gerade zu stehen.
Die Anforderungen an so ein Staatsoberhaupt sind also enorm: Volkstümlich muss es sein, ohne sich allzu gemein mit dem Volk zu machen; die ganz tiefe Bedeutung des Amtes ausstrahlen, ohne dabei arrogant zu wirken; staatsmännische Weisheit verströmen, ohne belehrend und besserwisserisch aufzutreten; immer gut angezogen sein, aber bitte alles aus eigener Tasche bezahlt haben; große Reden müssen aus seinem Munde sprudeln, ohne dass all die schönen Formulierungen und eingängigen Sprüche nach Ghostwriter oder Schema F klingen; einen gefestigten christlichen Standpunkt sollte es haben, aber um Gottes Willen nicht fundamentalistisch und engstirnig sein; ein intaktes, glückliches Familienleben vorweisen können, ohne hoffnungslos altmodisch zu erscheinen usw. usf. Der Anforderungskatalog an das herausragende Individuum, das tatsächlich würdig ist, unser oberster Deutscher zu sein, ist, wie gesagt, immens. Trotzdem stehen die Chancen alle fünf Jahre immer wieder gut, dass die verantwortlichen Politiker der Nation genau die passende Figur finden und per Bundesversammlung ins höchste Staatsamt wählen lassen. Sie veranstalten nämlich keinen Eignungstest zum besten Bundespräsidenten anhand einer Eignungsliste voller unabweisbarer Kriterien. Die Sache läuft umgekehrt: Sie einigen sich, gemäß ihren (partei)politischen Berechnungen, auf eine Gestalt – und schon lassen sich an genau dieser Figur und ihrer Vita all die herausragenden Kriterien deutlich machen, die sie gerade jetzt und heute für das höchste Amt im Staate ganz zweifellos prädestinieren.
Das Bedürfnis nach dem passenden Vorbild nationaler Identität ist also total angebotsorientiert – was die Anforderungen der Nation sind, wissen eben die am besten, die sie definieren; und seine politischen Anbieter gehen davon aus, dass die Nachfrage nach ihrer Figur sich im Volk schon einstellen wird. Wie ihr auserkorener Großverweser für Nationalstolz sich präsentieren und damit das Land repräsentieren soll, welche „Eigenschaften“ als angemessen gelten (nach denen es den Bürger dann je schon gedürstet hat): Das erfährt die Nation mit der Vorstellung des Kandidaten.
2. Ein neuer Typus Charaktermaske: „Der Quereinsteiger“
Als die Opposition sich wegen interner Machenschaften nicht auf den Favoriten S. einigen kann und als auch sonst kein verdientes Parteigesicht ins Kalkül der Westermerkels passt: Da haben die C- und F-Gruppen eine Eingebung. Vor jeder Auskunft über die Person ihrer Wahl lassen sie die von der nervtötenden Wichtigtuerei keineswegs angewiderte Öffentlichkeit wissen, ihr Mann sei ein international erfahrener „Quereinsteiger“; und da Rot-Grün den Einfall echt genial findet, zieht die Regierung umgehend mit einer eben solchen Frau nach.
Die Parteien spielen mit der Idee offen und berechnend auf Vorurteile an, die gebildete Patrioten über ihre Politikerkaste pflegen (und die jene kräftig gegeneinander schürt). Nur die Karriere im Auge statt des großen Ganzen; immer korruptionsgefährdet, im Wahlvolk auf Applaus zu schielen, statt unbestechlich das national Notwendige zu tun; Politiker als Beruf statt aus Berufung; eine „Hammelherde“ schwacher, ungeeigneter Staatsmänner, die aus „Machtbesessenheit“ ihren edlen Auftrag „vergessen“, Deutschland zum Erfolg zu führen: So betritt via Anspielung auf den (offenbar nicht bloß Faschisten vertrauten) Vorbehalt, die Technik demokratischer Ermächtigung gehe wg. Konkurrenz um die Zustimmung auf Kosten der Staatsräson, „der Quereinsteiger“ die Bühne. Eine Kopfgeburt der Machtkonkurrenz unter den Volksparteien, die gleich zwei Vorzüge aufweist: Einmal, von woher eingestiegen wird: selbstredend nicht von irgendwo, sondern von weit oben. Ausgewiesener Teil der Elite zu sein, die andern mitteilt, was sie zu melden haben, ist H. Köhlers und G. Schwans zu höheren Weihen befähigende Eignung. Als Direktor des Internationalen Währungsfonds über die globale Verteilung von Armut und Reichtum mitentschieden; als Direktorin der Deutsch-Polnischen Universität bekehrten Sozialisten erklärt, wie man „Europa“ buchstabiert: Zuständig für Wohl und Weh der Menschheit haben sie Verdienste um das Vaterland erworben. Zum anderen, wohin sie einsteigen: in die Politik. Mit der tonnenschweren Kompetenz, die ihre Paten ihnen attestieren, heiligen sie das Amt wie auch umgekehrt: Die Repräsentation Deutschlands ist die größte Ehre, die einem Erdenbewohner zuteil werden kann. Für diese Botschaft kommen statt der altgedienten Ausrangierten „zwei dem Volk fast unbekannte Gesichter“ ganz groß raus: Vertreter der „Zivilgesellschaft“, die den vom Zuspruch des gemeinen Stimmviehs abhängigen Politprofis vormachen, wie sich die Nation den Zeiten gemäß darzustellen hat.[2]
Was auch ein „Quereinsteiger“ als Bundespräsident zu tun, womit er „uns“ zu repräsentieren hat, steht einerseits fest. Er muss sagen, dass Deutschland und seine Insassen an guten wie an schlechten Tagen zusammenhalten, weshalb „wir“ echt klasse, oft aber auch undankbar sind; warnen, dass wir das Land und seine edlen Ressourcen nicht verlottern lassen und der Staat kein Supermarkt ist; loben, dass die BürgerInnen, jede an ihrem Platz, selbstlos Dienst an der Gemeinschaft tun; allen „ein gutes neues Jahr“ wünschen, in dem der gleiche Zirkus von vorn beginnt; kurz: die Eintracht von Volk & Führung anmahnen. Und er muss dafür sorgen, dass die Mannschaft ihm dabei gerne zuhört: Nicht, weil der Häuptling zum Fußvolk spricht, sondern weil er ein weiser Mahner ist, dem die Bürger an den Lippen hängen; das vertrauenswürdige Vorleben dieser Lüge ist sein Job. Wie er den ausfüllt, welchem speziellen Wert er seine Amtszeit widmet: Darin haben sich die Präsidenten, sehr persönlich der Lage der Nation entsprechend, nebst Gattinnen andererseits unterschieden. Darin unterscheiden sich auch die beiden Bewerber des Jahres 2004 von ihren Vorläufermodellen.
3. Das aktuelle Angebot: Horst Köhler, „ein Mann der Wirtschaft“
Horst Köhler ist erklärtermaßen ein Kandidat für
schwere Zeiten
. Auch das ist zunächst nichts
Einzigartiges. „Schwere Zeiten“ waren ausgerufen, als die
BRD sich als Teil des kapitalistischen Westens in der
Staatenkonkurrenz zurückmeldete und ihr Präsident Heuss
den frisch uniformierten Verteidigern des
„Wirtschaftswunders“ mit ureigenem Nachkriegshumor „Nun
siegt mal schön!“ zurief. „Schwere Zeiten“ gab es, als
Westdeutschland zum „ökonomischen Riesen“ mit erster
Arbeitslosenmillion aufgestiegen war und ein
feingeistiger Weizsäcker dem mit Pershing-Raketen
nachgerüsteten „politischen Zwerg“ den sittlichen
Freibrief ausstellte, eines Tages dürfe die neue
Wehrmacht überall dort wieder gutmachende „Verantwortung“
wahrnehmen, wo die alte wütete. Patriotisch beglückende,
aber auch schwere Zeiten erlebten „wir“, als die „wieder
vereinigte“ Republik neue blühende D-Mark-Landschaften
schaffen sowie „endlich souverän“ ihre ersten Kriege
gewinnen wollte und Herzog bzw. Rau den Anschluss der
Zone und die Waffen für die Balkan-Intervention mit
humanistischen Werten segneten. Allerdings: „Die
deutschen Probleme“, auf die Horst Köhler
trifft, als er gerufen wird, sind heute, so hört man,
„struktureller Art“ und „über viele Legislaturperioden
gewachsen“, wie der Kandidat scharfsinnig und
überparteilich erkennt. Der Kapitalstandort ist bloß „2.
Liga“, die Politik reagiert „kurzatmig“, international
ist „die Stimme Deutschlands“ zu wenig hörbar: So
diagnostiziert der neue Mann das aktuelle Leiden seiner
Nation, deren gewachsene Ansprüche auf Geld- und
Weltmacht er nicht mit den ihr gebührenden
Erfolgen belohnt sieht.
Dem Wahn der „Führungspersönlichkeit“, der ihn beauftragt, das Land als „geistig-moralisches“ Vorbild aus der Krise heraus- und seinen Erfolg herbeizuführen, stellt er sich erstens wie jeder Präsident. Mittels Verbreitung vorsätzlichen Frohsinns („Ich würde gern dazu beitragen, dass die Deutschen wieder etwas fröhlicher in die Zukunft blicken“) und dem Lob, Land und Leute seien im Grunde völlig in Ordnung („Wir sollten den Mut haben, die großen Probleme anzugehen: Deutschland hat das Potential dazu“), beschwört Köhler die Produktivkraft des guten patriotischen Willens. „Wir alle“ müssen uns nur zusammenreißen, ein jeder weniger an sich denken und bei seinen Leisten bleiben, die Politiker also besser regieren und die Bürger dabei mithelfen wollen: Dann wird Deutschland unschlagbar – und aus dem einzigartigen Potential eine Potenz im ökonomischen und politischen Wettbewerb der Staaten, den zu gewinnen dem Standort D selbstverständlich zusteht. Dem Wahn, eine Nation schneide in der kapitalistischen und imperialistischen Konkurrenz so gut oder so schlecht ab, wie „charismatisch“ sie geführt und wie „kompetent“ sie beraten werde, soll und will der neue Präsident zweitens aber ein bisschen anders Genüge tun als seine Vorgänger:
Den „62% der Deutschen, die mit dem Namen nichts anfangen können“, wird Horst Köhler als Mann der Wirtschaft vorgestellt; und da die Präsentation des Großen Schlichters als Mann eines gesellschaftlichen Sonderinteresses keinen Schatten, sondern Licht auf seine Eignung werfen soll, enthält das Etikett eine denkwürdige Botschaft. Was nach früherem politischen Geschmack einmal als Makel „der Wirtschaft“ galt – „undemokratische Entscheidungsstrukturen“: der Boss befiehlt, die Belegschaft spurt – spricht heute für Köhlers Qualifikation zum Oberdemokraten. Zumal das staunende Volk im FAZ-Net lesen darf, was der Einsteiger quer durch den Erdball schon alles für die Nation geleistet hat: Daheim wie auswärts hat der Ex-„Bonner Spitzenbeamte“ als „treibende Kraft beim Staatsvertrag mit der DDR, Verhandler über den Euro und Abzug der russischen Truppen, Präsident des Sparkassenverbandes, Vorbereiter des Münchner G-7-Gipfels und IWF-Chef“, allzeit „charmant, aber auch hartnäckig, manchmal aufbrausend“, deutsche Interessen vertreten und durchgesetzt. Qua Amt Leute herumkommandieren, über die Kreditwürdigkeit ganzer Länder befinden: Das kann er, das mag er! In Zeiten, da die Gleichung ‚Wohl der Wirtschaft = Wohl der Nation‘ von Regierung und Opposition gleichermaßen propagiert und praktiziert wird, gilt ein Lebenslauf lückenloser Parteilichkeit für Staat und Kapital als 1a-Bewerbungszeugnis, das nationale Kollektiv ganz oben zu repräsentieren.
So macht sich der Mann der Wirtschaft als Retter des
Standorts Deutschland bekannt. Köhler begrüßt alle
unter dem Titel „Reform“ ergriffenen Maßnahmen zur
Befreiung der Nation von ihren überflüssig gemachten
Kostgängern („Die Agenda 2010 von Kanzler Schröder geht
in die richtige Richtung“), erklärt sie mittels der
patriotischen 1. Person Plural zur ultimativen Vernunft
(„Wir müssen den Sozialstaat durch Umbau sichern, daran
gibt es gar keinen Zweifel“) und verhimmelt das Streichen
am Lebensunterhalt der Leute zur Befreiung von
Realitätsferne und Trantütigkeit: „Deutschland muss noch
mehr aufwachen, um Reformen durchzuführen“. Er hat sich
für seine Amtszeit vorgenommen, Reform
als Wert zu
verankern: die Hinnahme der angeordneten Verarmung als
Tugend, die alternativlos gemachten Sachzwänge der Nation
nicht murrend, sondern heiteren Sinnes zu ertragen, das
ist sein erklärtes Propagandaziel. Seine Vision: „Die
Reformen sollen das Land nicht spalten“, sondern in
Zufriedenheit – mit allen Gegensätzen, die sie
produzieren oder verschärfen – vereinen.
Vorbild für die angesagte Sittlichkeit der Ära Köhler ist der Heimwerker Horst: „Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten will durch Mehrarbeit den Wirtschaftsstandort Deutschland retten. Er habe früher auch öfter die Wohnung geweißelt und tapeziert – und da habe er wegen anderer Termine am kommenden Tag auch nicht einfach um 18 Uhr aufgehört“. Dem in schrägen Bildern geübten Spiegel-Leser wird augenblicklich klar: Die Adresse der Wohnung lautet ohne Zweifel Standort D, „Weißeln“ steht für Wachstum, „Tapezieren“ für Märkte erobern (oder umgekehrt?), und den Termin am nächsten Tag hat das nationale Wir mit der ausländischen Konkurrenz, die bekanntlich früh aufsteht – allen klar, dass der Herr Wir deshalb mehr schaffen muss und weniger verdienen darf? Wenn ein „Weltökonom“, der als „deutsche Antwort auf die Globalisierung“ gilt, längere Ausbeutungszeiten sachgerecht als Waffe der Durchsetzung der Nation auf dem Weltmarkt „erklärt“: Dann leuchtet ja wohl ein, dass die von Wirtschaft und Sozialstaat abhängigen Massen sich warm anziehen müssen.
Und das nicht nur in ihrer Eigenschaft als Lohnarbeiter, Erwerbslose oder Patienten; auch auf dem Feld der politischen Konkurrenz fordert Köhler den nationalen Kraftakt. Seiner Mahnung, „wir müssen mehr Substanz aufbauen, um die internationalen Herausforderungen zu bestehen“, lässt er böse Worte gegen die folgen, die „uns“ daran hindern. Den „arroganten“ USA wirft er „schwere Fehler im Irak“ vor, „hat den Eindruck, dass den Amerikanern die Macht zu Kopf gestiegen ist“, und warnt „die Supermacht, nicht alle Probleme dieser Welt alleine lösen zu wollen“; sie solle sich dafür bitte der „Mitwirkung der internationalen Gemeinschaft und Deutschlands“ bedienen. Streng überparteilich, also total parteiisch für den weltpolitischen Emanzipationsbedarf „seines geliebten Deutschland“ (SZ) setzt der Kandidat auf die Tugend des Antiamerikanismus (mehr, als Frau Merkel, auf die er „als Bundeskanzlerin hofft“, lieb ist). In der Pose eines Schiedsrichters über die korrekte sittliche Dosis staatlichen Machtgebrauchs beantragt er mehr Rechte für die gute, weil deutsche Ordnungsmacht. „Alleine“ den Irak und die Völker dieser Welt zu beaufsichtigen, ist ein „Fehler“: Daran müssen „wir“ beteiligt sein, mit mehr imperialistischer Substanz. Die größere „Mitwirkung“ in aller Welt, die sich Deutschland längst herausnimmt, steht ihm auch zu; dabei kann Köhler nach eigenen Angaben helfen. Also dürfen alle Zeitungen das Rührstück drucken, wie unser Mann beim IWF schon mal „die Regierung Bush vor zu hohen Defiziten im Haushalt und in der Leistungsbilanz gewarnt und deren Korrektur gefordert hat“. Dann wird unser studierter „Weltmanager“ dem Amerikaner auch erzählen können, eine „unipolare“ Gewaltmaschine rechne sich nach bundesdeutscher Volkswirtschaftslehre des Jahres 2004 nicht mehr…
Die Presse ist von Köhlers Selbststilisierung angetan. Ein Präzeptor Germaniae, der Deutschland auf seinem steinigen Weg zu neuen Ufern unterweist und nur „redet, um etwas zu sagen“: Das hat uns schon lange gefehlt. Sorge bereitet lediglich, ob ein schwäbischer Finanzbeamter das bringt: „Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bundesrepublik Deutschland braucht andere Fähigkeiten als ein Bankdirektor: Er muss die Herzen der Menschen erreichen, ihnen aus der Seele sprechen, wenn er etwas bewirken will“ (SZ). Doch der Kandidat beruhigt: „Gott ist für mich sehr wichtig. Es ist gut, wenn Menschen einen Anker haben, der tiefer reicht als die alltäglichen Dinge. Tiefer als Wirtschaft oder die Frage nach dem neuen Auto.“ Die Antwort ist eines Präsidenten durchaus würdig. Dass ausgerechnet der „Mann der Wirtschaft“ Wichtigeres als Wirtschaft kennt, spricht die, die in dieser Wirtschaft vornehmlich unter die Räder kommen, in ihren patriotischen Herzen an. Die Relativierung des privaten, als „nieder“ verleumdeten Materialismus folgt aus der Verabsolutierung des nationalen, der sich in Wachstum von Kapital beziffert: Den von ihm getrennten lohnabhängigen Produzenten empfiehlt der politische Oberhirte höherer Werte, aus der Not erzwungener Bescheidenheit eine Tugend zu machen; denn der Mensch lebt nicht vom Opel allein. So bekennt auch der neue Präsident, was die Mächtigen am Gottesglauben schätzen. Die Vorstellung eines absolut Allerhöchsten spendiert ihren Untertanen Trost; der „Anker“ hilft, dass die Geschädigten nicht so schnell den guten Glauben an ihre Herren verlieren: Ein, ja der Wert – umso angesagter, je „schwerer die Zeiten“, die Staat und Wirtschaft verordnen.
Der Mann ist für Deutschland ein Geschenk des Himmels.
4. Die (kon)geniale Antwort: Gesine Schwan, „eine Frau der Wissenschaft“
Das würde die Regierung einerseits auch so sehen (sie hat Köhler/CDU einst zum IWF beordert). Andererseits: Die Abgabe moralischer Richtlinienkompetenz über den Zeitgeist ist ein Verlust – an Macht, das Volk zu betören; insofern ist das Parteibuch des ersten Gesinnungswächters nicht unwichtig, gerade für demokratische Anhänger des Ideals der Manipulation qua Amt & Würde. Immerhin war ein Präsidentenwechsel schon mal „Signal“ für einen Machtwechsel: Den Glanz, der von der Auswahl des Staatsoberhaupts, dem Abschreiten roter Teppiche und dem Kult der großen Reden auf die „Fähigkeit“ der Partei zurückstrahlt, solche tollen Hechte hervorzubringen, wollen Rote und Grüne nicht missen; also erteilen sie, trotz (oder wegen) geringer Aussichten, dem „Schachzug“ mit dem Mann der Wirtschaft die gerechte Antwort. Schröder proudly presents: „Professor Gesine Schwan, eine Frau der Wissenschaft“.
Frau und Wissenschaft! Auch das Konkurrenzangebot appelliert an unerlässliche Reflexe erfolgreich politisierter Bürger: Gleichberechtigung und Bildung machen sich immer gut. Bild: „Machen Frauen anders Politik als Männer?“ Schwan: „Frauen haben in der Regel ein anderes Verständnis von Macht. Es gibt aber auch Frauen, die das männliche Machtverständnis überdrehen und damit jeden Mann in den Schatten stellen“. So verkörpert Frau Gesine, die zwecks Eigenwerbung gerne das 60-jährige Girlie abgibt, das ‚sich gut findet‘, den Endsieg der Frauenbewegung. Sie kokettiert mit dem Vorurteil, Politikerinnen wären irgendwie anders, und erklärt offensiv den Witz von „Emanzipation“: Die Gleich-Stellung der Weiber beseitigt den unerträglichen Ausschluss vom Selben, was für Kerle reserviert war; weg von der Bornierung auf Heim und Herd, hin zur Befreiung durch Hochschulabschluss und Macht! Vom hohen Wert von Bildung kündet die Vita Schwans, die dem Volk als „ausgewiesene Fachfrau für Politikwissenschaften“ vorgestellt wird, die dem Vergleich mit dem „international renommierten Wirtschaftsfachmann“ locker Stand hält: Laut Selbstauskunft ist die emanzipierte „Quereinsteigerin“ stets „gegen den Strom geschwommen“; war bereits 1970 in der richtigen Partei, „aber nie Parteisoldatin“; bekämpfte als Jungsozialistin die Ostpolitik, später die Pershing-Gegner; witterte als junge Professorin überall den „Ausverkauf der Freiheit“; flog schon mal wegen „Rechtsabweichung“ aus der Grundwertekommission der SPD; leitet die „Viadrina“ an der Frontlinie zu nun „unseren“ EU-Satelliten. Kurzum: Sie verkörpert den mainstream von Politik und Geist, dessen heutigen Stand sie weitblickend und unkorrumpierbar voraus ahnte und der sie jetzt umso mehr ins Recht setzt. Auch als gewisse Minderheiten im Lande noch meinten, gegen „Nachrüstung“ oder was auch immer demonstrieren zu müssen, hat sie schon immer den guten gesellschaftlichen Durchschnitt der anständigen Bürger repräsentiert. Und in jenen wild bewegten 60er-Jahren, als aufmüpfige Studenten an ihrem Berliner Uni-Institut tatsächlich die eine oder andere Vorlesung störten, da stand sie bereits fest und unerschütterlich auf dem Standpunkt der damaligen Springer-Presse. Das findet sie, wenn sie vor laufenden Fernsehkameras so aus ihrem Leben plaudert, ungeheuer mutig und geradezu kennzeichnend für ihren „unangepassten Charakter“. Die Kunst, Originalität zu beweisen, indem man sie sich selber zuschreibt, ist zwar streng genommen nicht übermäßig originell, aber nichtsdestotrotz: Frau Gesine beherrscht sie, sobald sie den Mund aufmacht.
Ihre angeblich so „unangepasste“ Vita spiegelt auf diese Weise das große nationale „Wir“ wider, das sie in Zukunft mit ihrer ganzen Originalität als „erste Frau!“ im höchsten Staatsamt repräsentieren möchte. Als frühreife Demokratin machte sie aus der Parteilichkeit der Politischen Wissenschaft einen persönlichen Kampfauftrag. Kommunismuskritik hat sie, auch zu Zeiten wohldosierter „Entspannung“, mit der Keule „Freiheit oder Barbarei“ absolviert. Heute repräsentiert sie für ihre Partei lauter gute Werte: von Frau, die „es“ besser kann, bis zur Osterweiterung, die „uns“ fraglos nutzt. Das Lieblingswort Bildung bringt ihre Bewerbung auf den Punkt: „Bildung“, das ist (entgegen alter sozialdemokratischer „Chancengleichheits“-Flausen) nichts, was etwa der Staat den Bürgern schulde, sondern umgekehrt eine „Ressource“, deren Pflege der Bürger seinem Standort schuldet. Flotte Computerfritzen und schlaue Thinktanks als scharfes Schwert in der Staatenkonkurrenz: Prof. Schwan leiht dem Standpunkt, das Schmieden des „Rohstoffs Wissen“ entscheide über Sieg und Niederlage der Nation, gerne die Stimme. Der Staat muss seiner Jugend ein Angebot machen, dann ordentlich sortieren; das stärkt die Wirtschaft, die mittels hoch qualifizierter Wissenschaftler den Weltmarkt aufreißt – daran hat sich die Güte von Bildung zu messen. Ihre vorbildliche Laufbahn und ihr ebenso vorbildlicher Humor, von dem sie so gerne erzählt, sind demnach ausgezeichnete Qualifikationen für das höchste Staatsamt; ihr „Lebensmotto“ passt dazu: „Vertrauen ist die Ressource der Demokratie“. Harmonie von Oben und Unten will sie mit ihrer „Kultur der Ermutigung“ vorleben: Beide Seiten des Gegensatzes sollen darauf setzen, dass die jeweils andere ihr Geschäft gut verrichtet – die einen das Befehlen, die andern das Parieren –, dann ist die Herrschaft des Vertrauens würdig, das sie tagtäglich von den ihr Unterworfenen verlangt.
So bleibt zum Schluss noch zu vermelden, was aus der Ankündigung Gesine Schwans geworden ist, die erste Präsidentenkür dieses Jahrtausends wie einen richtigen „Wahlkampf“ zu gestalten. Eben dies: Die kämpferische Note, mit der sie Horst Köhler zum „Rededuell“ herausforderte; das Bestreben, ihre gepflegten Zähne mindestens so oft bei „Christiansen“ zu zeigen wie der Favorit; die demonstrative Hoffnung, „die Frauen der CDU und FDP herüberzuziehen“ – lauter Touren, nicht gleich als hoffnungslose „Zählkandidatin“ und damit Verlierer-„Type“ zu gelten: Ich bin der bessere Köhler! „Mann der Wirtschaft“ oder „Frau der Wissenschaft“, beide qualifiziert bis zum Anschlag: Da heißt es sich entscheiden.[3] Aber die Mehrheit wird in jedem Fall das Richtige tun.
[1] Die seltenen Skandale um das Amt bestätigen die Regel. Einige Lapsus linguae („Meine Damen und Herren, liebe Neger“, Lübke) und politisch inkorrekte Töne (Carstens, Heitmann), wurden von der öffentlichen Ethik-Kommission als Verstoß gegen den antifaschistischen Zeitgeist getadelt: Man vermisste die internationale Vorzeigbarkeit, die Aura von Intellekt und weißer Weste = den Glanz, der vom obersten Deutschen auf die Nation abfärbt. Eben darum geht es also.
[2] Die „Quereinsteiger“ adeln das Amt und das Amt adelt sie: Als die Logik, wonach kein Politiker gewesen zu sein, extra zum Politiker qualifiziere, eingeschlagen hat, versteht die Öffentlichkeit, warum Schäuble es einfach nicht werden konnte. Die mehr oder minder bedauernd angestellten Spekulationen, ob ein Rollifahrer deutschen Weltmachtansprüchen gut zu Gesicht gestanden hätte, die „Schwarzgeldaffäre“ seinen Ruf beschädigte oder Frau Merkel ihn nicht leiden kann, weil er „schon mal in ’ne Schießerei verwickelt war“ (Titanic), haben ein und den selben Stoff: Gemessen am Bild, das den unbestechlichen, erfolgreichen Quereinsteiger zum neuen Idealtypus erhebt, sieht ein „machthungriger Berufspolitiker“, der „dennoch stets nur Kronprinz blieb“, moralisch alt aus.
[3] Gewissermaßen als mustergültiges Kombinat aus Köhler & Schwan wurde schon kurz vorher der Bundesbankpräsident ernannt. Als der Alte wegen moralischer Verfehlungen widerwillig den Stuhl räumt, „glückt der Regierung ein überraschender, genialer Coup“, so das einhellige Lob: Statt der „Versuchung“ zu erliegen, das Amt „politisch zu instrumentalisieren“, oder „dem bewährten Nachfolgeschema zu folgen“, nimmt sie weder einen SPDler noch den Vizepräsidenten, sondern Professor Axel Weber! Über den erfährt man in der Tat Überraschendes: Er ist „ausgewiesener Fach(!)wissenschaftler“, der „in Finanzkreisen einen hervorragenden Ruf genießt“. Kein Politiker, sondern „Wirtschaftsweiser“: Der Mann muss mit Geld umgehen können! So reanimiert Rot-Grün mit der neuen Charaktermaske das Gerücht, die deutsche Währung verdanke ihre legendäre „Härte“ nicht dem kapitalistischen Reichtum, den sie ausdrückt, und der Staatsgewalt, die ihn bewacht, sondern der „umsichtigen Geldpolitik“ ihrer stets unglaublich „unabhängigen“ Pöhls & Tietmeyers – und „beeindruckt“ mit der Einsetzung dieses qua Amt genialen „Quereinsteigers“.