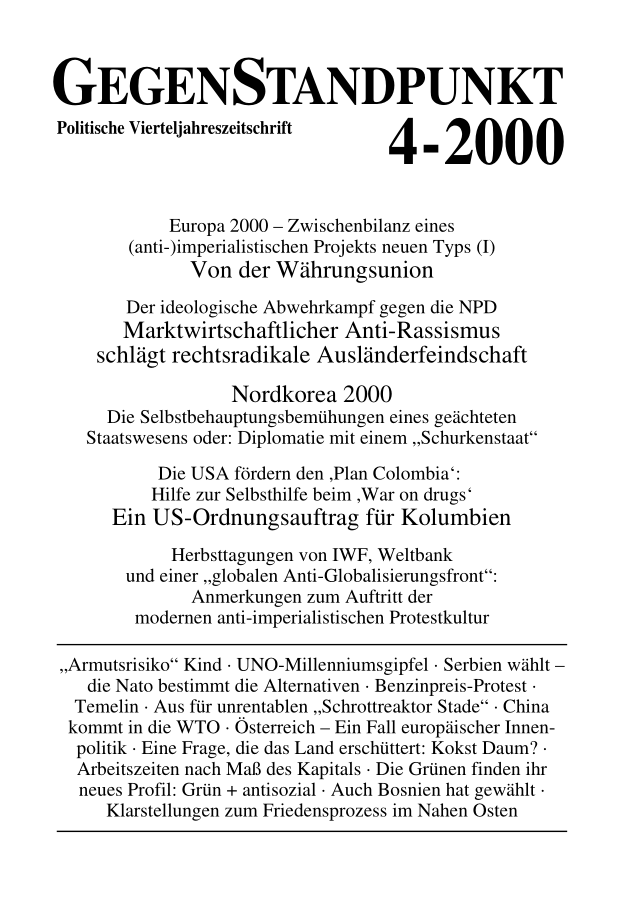Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Grünen finden ihr neues Profil
Grün + antisozial = mindestens 5%
Die Grünen werden ihrer Verantwortung als alternative Lifestyle-Partei gerecht: Ausstieg aus der Atomenergie in 30 Jahren; ganz pazifistisch treten sie für einen veritablen Krieg auf dem Balkan ein; die Multikulti-Freunde sind für Ausländer „nach Bedarf“ und beim Rentenkürzen wollen sie gleich noch mehr Nachteile für die Rentner als die SPD!
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Grünen finden ihr neues
Profil
Grün + antisozial = mindestens
5%
Die Grünen haben die Zeit ihrer Beteiligung an der Macht in Deutschland genutzt. Was es für eine ökologisch-alternative Partei in der Regierungsverantwortung zu tun gab, haben sie getan, und das bereits zur Halbzeit der Legislaturperiode:
Der wichtigste Tagesordnungspunkt ihrer ökologische Agenda ist abgearbeitet. Gegen die übermächtige Atomindustrie und die widerstrebenden Sozialdemokraten haben sie den Atomausstieg durchgesetzt. Jedenfalls den Einstieg in den Ausstieg, der in kaum dreißig Jahren – man wollte sich nicht unnötig streiten, sondern den Konsens wahren – perfekt sein wird, wenn nicht ein anders lautender Beschluss einer späteren Bundesregierung dazwischen kommt, oder ein sonstiger GAU.
Ihrem pazifistischen Erbe hat die Partei eine hoffnungsfrohe Zukunft gesichert. Sie hat es vertrauensvoll in die starken Hände der NATO und einer künftigen europäischen Streitmacht gelegt, die ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur menschenrechtlichen Friedenssicherung erst neulich mittels eines veritablen Krieges auf dem Balkan unter Beweis gestellt haben. Mit ihrer Zustimmung zum Angriff der machtvollen nordatlantischen Friedensinitiative auf den serbischen Schurkenstaat haben die grünen Verantwortungsethiker gezeigt, dass ihnen für den Frieden kein Preis zu hoch ist. Und sei es der Preis eines ausgewachsenen mehrwöchigen Bombenhagels auf ein Volk mit der falschen Führung.
Ihrer Verantwortung als alternative Lifestyle-Partei sind die Grünen gerecht geworden. Homo-Eheleute dürfen sich künftig liebevoll an ihre Unterhaltspflichten erinnern lassen und den Grünen für ein Stück staatliche Anerkennung ihrer privaten Abweichung dankbar sein. Sie haben dafür gesorgt, dass Homos und Lesben nicht mehr so grausam außenseitermäßig neben den gutbürgerlichen, glücklichen Kernfamilien herumstehen müssen. Dem privaten Zusammenhalt der Homos zum Durchstehen der guten und schlechten Tage, die ihnen Staat und Kapital bescheren, ganz nach dem Vorbild der „Heteros“, haben die Grünen eine richtige Rechtsform spendiert, und damit dem privaten ein kleines Stück staatlichen Sinn hinzugefügt.
Ihre alte Liebe zum Multikulturellen hat die
Partei inzwischen auf eine solide Grundlage gestellt,
indem sie, einig mit allen anderen demokratischen
Parteien, für ihre bislang eher diffuse
Ausländerfreundschaft endlich ein klares Kriterium
entwickelt hat: Das Einwanderungsgesetz, an dem sie mit
ihren sozialdemokratischen Mitregenten arbeitet, soll
sich allein am Bedarf orientieren
, weshalb die
Grünen jetzt mit Multikulti-Beliebigkeit nichts mehr
anfangen können.
(Bütikofer, Die
Grünen, SZ, 9.11.00)
Und auch ihren radikal- und basisdemokratischen Ansatz als neuartige Demokratiebewegung von unten haben die Grünen vollständig eingelöst, und tun dies jeden Tag ihrer Regierungsbeteiligung aufs Neue: Sie sind oben angekommen, dort, wohin sie unterwegs waren. Sie haben ihr alternatives Getue abgelegt, sind eine ganz normale Partei geworden und – an der Macht.
Nach solchen Erfolgen stellt sich für die grüne Partei die Frage: Was bleibt eigentlich noch zu tun? Im Lichte der Tatsache, dass nach der ersten Hälfte der Regierungszeit die zweite und danach die nächste Wahl folgt, beantwortet sich die Frage wie von selbst: Die Partei muss es schaffen, mit ihren guten vergangenen und noch besseren künftigen Taten, neben dem großen Koalitionspartner wahrgenommen zu werden, ein eigenständiges Profil zu bekommen und dafür zu sorgen, dass „an uns nicht nur die miesen Sachen hängen bleiben, während sich die SPD auf die Schulter klopft“ (Kuhn, Grünenvorstand). Kurz: Sie muss es schaffen, wieder gewählt zu werden.
Die Aufgabe scheint den Grünen lösbar: Durch unverwechselbar grüne und verstärkt öffentlich wahrnehmbare Sachpolitik! Die Sache, die in diesem Sinne von der neuen Führung der Partei in Angriff genommen wird, ist Mitte November die Rentenreform. Sie wird in demonstrativ „offener Konfrontation mit der SPD“ als „heftiger Koalitionsstreit“ abgehandelt, damit jeder merkt, dass es nun ein Ende hat mit der „Kuschelei“ (SZ, 9.11. ff.). Die Sozialpolitik ist ein Politikfeld, auf dem die Grünen schon lange das Bedürfnis verspüren, ihre Kompetenz zu beweisen – insbesondere im Dienste der „jüngeren Generation“. In deren Kreisen sollen die Grünen, Umfragen zufolge, nämlich schwer unter „schwindender Attraktivität“ leiden, mit der Folge ausgeprägter „Überlebensangst“ in weiten Teilen der Partei. (SZ, 9.11.)
Die Regierung will bekanntlich das Rentenniveau von derzeit ca. 70% des „statistischen Nettolohns“ bis 2030 um ca. 10% senken. Einerseits durch einen Abzug von 0,3% von der Rente bei Neurentnern ab 2011, der sich bis 2030 bis auf 6% akkumulieren soll. Andererseits durch Abzüge von anstehenden Rentenerhöhungen mittels rechnerischer Senkung der Berechnungsgrundlage, des „statistischen Nettolohns“. Diese Aktion sollte nach bisheriger Planung ab dem Jahre 2002 beginnen. Ein Jahr davor, in 2001, sollte die staatliche Förderung der „privaten Altersvorsorge“ einsetzen, mit der die jetzigen Beitragszahler, mit neuen Sparbeiträgen ohne Arbeitgeberbeteiligung, die durch die Senkung des Rentenniveaus bescherte spätere „Versorgungslücke“ wieder schließen sollen.
Mitte November kündigt der Finanzminister an, die Förderung der Privatvorsorge und damit auch die für das Folgejahr geplante Kürzung der laufenden Renten um ein Jahr aufzuschieben. Er hat dafür seine Kosten- und taktischen Gründe. Dazu zählt unter Anderem der nicht unerwünschte Effekt, dass durch die Verschiebung der Beginn der Förderung ins Wahljahr 2002, der Beginn der Rentenkürzungen aber in das Jahr nach der Wahl fällt. Da schlägt die Stunde der Grünen: Sie „fetzen sich“ öffentlich mit dem Koalitionspartner und werfen sich aus Gerechtigkeitsgründen für die jüngere Generation der Beitragszahler und gegen die derzeitigen Rentenbezieher in die Bresche. Unerträglich finden sie es, dass, wenn der „Staat erst später die Zuschüsse für die private Altersvorsorge (gewährt), vor allem die jetzigen Rentner davon profitieren. Ihre Renten würden dann erst 2003 weniger stark zulegen.“ (SZ, 15.11.) Der „Profit“ der „jetzigen Rentner“ nach der Redeweise der grünen Politökonomie besteht wohlgemerkt darin, dass deren ohnehin mickriger Rentenanstieg im Falle der von Eichel geplanten Verschiebung erst ein Jahr später gekürzt würde. Das wollen die Grünen keinesfalls aushalten, dass die Rentner sich noch ein Jahr länger auf Kosten der jungen Beitragszahler an ihren ungekürzten Renten mästen. Nach heftigem, aber kurzem Streit folgt die Einigung mit der SPD: Die Verschiebung geht in Ordnung, wenn durch den ungerechten Profit der Rentner „die jüngere Generation nicht stärker belastet“ und „ein gerechter Ausgleich zwischen den Generationen“ (SZ, 15.11.) gefunden wird. Der sieht entsprechend dem Wunsch der Grünen so aus, dass „gleichzeitig mit dem Einstieg in die Privatvorsorge auch die Rentenanpassung gedämpft wird.“ (SZ, ebd.). Die einen bekommen also ihren Zuschuss später, die anderen ihre Rentenkürzung früher, und beide Unterabteilungen der nationalen Gesamtarbeit, die man vorher gegeneinander aufgehetzt hat, sollen sich nun in der grünen Gerechtigkeit des beiderseitigen Nachteils zufriedengestellt sehen, vor allem die „jüngere Generation“, der die Grünen ja den Nachteil eines ungerechtfertigten „Profits“ auf Seiten der „derzeitigen Rentner“ erspart haben. Damit haben die Grünen ihr Debüt in der Rolle des gnadenlosen Vorkämpfers der „Beitragsstabilität“ gegeben, der „unser Sozialsystem“ und seine „Leistungsträger“ gegen den „Wankelmut“ des Kanzlers verteidigt, der „die notwendigen Sozialreformen verschiebt und verwässert“ (SZ, 15.11.). Sie lassen Schröder seine offenbar immer noch im Übermaß vorhandenen sozialen Neigungen nicht durchgehen und decken mutig die sozialistischen Bestrebungen der SPD-Bundestagsfraktion und ihrer gewerkschaftlichen Klientel auf: Die lassen es immer noch an der nötigen Härte beim Vorgehen gegen Alte und sonstige Minderbemittelte fehlen und verhandeln noch mit Riester, ob die Absenkung des Rentenniveaus auf eine neue Stufe der „Altersarmut“ nicht vielleicht doch um den einen oder anderen Prozentpunkt zu weit geht. Doch da sind die Grünen vor! Sie wollen künftig weithin sichtbar als Gegengewicht gegen die Sozis und deren unausrottbare soziale Allüren wirken, indem sie sich zum radikalen Vorreiter eines von der SPD längst selbst angemeldeten und praktizierten Korrekturbedarfs in Sachen staatlicher Sozialkosten machen.
Ob bei den Rentenbeiträgen oder der Selbstbeteiligung an den Krankheitskosten: die Grünen stehen für die „Entlastung der Wirtschaft“, und „Eigenverantwortung“, ganz wie ihre schärfsten Konkurrenten in der Welt um die 5 Prozent, die FDP. Und wie die, haben sie auch für faule und überbezahlte Proleten nichts übrig, dafür aber viel Verständnis für Unternehmer, die wie sie am „Strukturkonservatismus der Gewerkschaften“ (Rezzo Schlauch) leiden. „Mit immer mehr Lohn und immer weniger Arbeitszeit“, meint die grüne Abgeordnete Wolf, „seien die Probleme nicht zu lösen“ (SZ, 20.11.), weshalb die Partei gleich nach Abschluss des Streits um die Rentenreform einen weiteren sinngemäßen Vorschlag nachschiebt: „Sozial- und Wirtschaftspolitiker der Grünen bereiten einen Gesetzentwurf vor, der eine Entlohnung auch unterhalb der Tarifverträge ermöglichen soll.“ (SZ, ebd.)
So schärfen die Grünen ihr sozial- und wirtschaftspolitisches Profil und empfehlen sich schneidigen Yuppies und anderen Besserverdienenden als politische Sachwalter der sozialstaatlichen Modernisierung in Parlament und Regierung. Und ganz in diesem Stil beweisen sie, dass sie sich auch in der regierungsinternen Konkurrenz der Ressorts nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen wollen: Die SPD will mit der Neuregelung der Invalidenrente diese künftig nicht mehr vom Sozialministerium (Riester, SPD), sondern vom Gesundheitsministerium (Fischer, Die Grünen) verwalten – und mit den zu erwartenden Defiziten verantworten – lassen. Dabei stört die Grünen keineswegs die Verschärfung der Kriterien für die Auszahlung der Invalidenrente, sondern der Umstand, dass in ihrem Ressort ein politisches Problem mit absehbar schlechter Presse für die zuständige Ministerin abgeladen werden soll. Das ist für sie ein Anlass für einen weiteren „Grundsatzstreit“ mit der SPD.
Weil den Grünen bei alledem der Vorwurf gemacht wird, sie würden sich das „erstbeste Thema“ suchen, „nur“ um einen „Anlass zum Koalitionsstreit“ (SZ, 14.11.) zu haben, weist die neue Parteivorsitzende die Kritik zurück. Sie besteht darauf, „man müsse ihrer Partei abnehmen, dass sie manche Dinge auch um der Sache willen tue“ (SZ, ebd.). Diese Stellungnahme halten wir für ausgesprochen glaubwürdig.