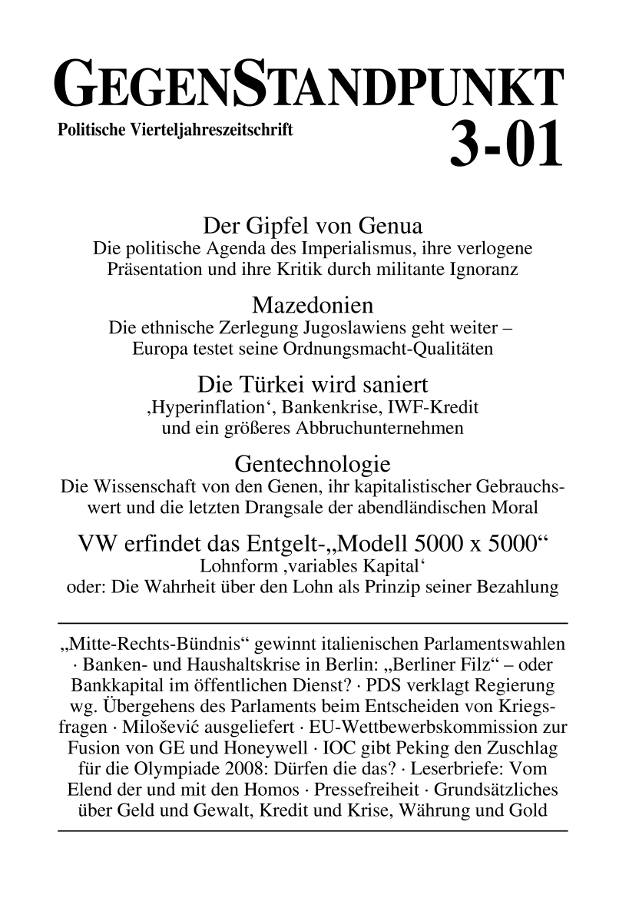Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Wettbewerbskommission der EU untersagt Fusion von General Electrics und Honeywell:
Die Weltmarktführer verständigen sich – noch – über die internationale Zentralisation des Kapitals
Anfang Juli verbietet der Wettbewerbskommissar der Europäischen Kommission die geplante Fusion der amerikanischen Konzerne General Electrics (GE) und Honeywell. Das Recht dazu hat er aufgrund einer Vereinbarung über die Anwendung ihrer jeweiligen Wettbewerbsrechte, welche die EU und die USA 1991 geschlossen und seither um zwei Zusatzabkommen erweitert haben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Die Wettbewerbskommission der EU
untersagt Fusion von General Electrics und
Honeywell:
Die Weltmarktführer verständigen
sich – noch – über die internationale Zentralisation des
Kapitals
Anfang Juli verbietet der Wettbewerbskommissar der Europäischen Kommission die geplante Fusion der amerikanischen Konzerne General Electrics (GE) und Honeywell. Das Recht dazu hat er aufgrund einer Vereinbarung über die Anwendung ihrer jeweiligen Wettbewerbsrechte, welche die EU und die USA 1991 geschlossen und seither um zwei Zusatzabkommen erweitert haben. Die Begründung ist kurz –
„Die Fusion von GE und Honeywell hätte in der angemeldeten Form den Wettbewerb in der Luft- und Raumfahrtindustrie erheblich verringert und letztendlich zu höheren Preisen für die Abnehmer, insbesondere die Fluggesellschaften, geführt… Der Zusammenschluss bewirkt bei Avionik- und sonstigen Produkten sowie bei Triebwerken für Firmenflugzeuge eine beherrschende Stellung und verstärkt die bereits vorhandene dominante Stellung von GE bei Triebwerken für große Verkehrsflugzeuge und große Regionalmaschinen“ (Begründung der Kommission) –
und beruft sich auf den Grundsatz europäischen Wettbewerbsrechts:
„Die zentrale Frage bei der Überprüfung von Beschlüssen in Europa lautet, ob dadurch eine beherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird. Die europäische Fusionskontrolle dient nicht dem Schutz der Konkurrenten, sondern soll die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Märkte sicherstellen, damit die Verbraucher von ausreichender Auswahl, Innovation und attraktiven Preisen profitieren können.“
Was die Kommission als gefährliche „marktbeherrschende
Stellung“ klassifiziert, hat die amerikanische ‚Antitrust
Division‘ nicht lange zuvor als wettbewerbsfördernd
und verbraucherfreundlich
eingestuft, die positiven
Wirkungen der Fusion hervorgehoben – bessere Produkte,
Dienstleistungen und attraktivere Preise
– und sie
genehmigt. Hinsichtlich dieser weltgrößten Fusion
liegt also zwischen diesen beiden Institutionen, die für
Überwachung und Schutz des Wettbewerbs zuständig sind,
ein offener Dissens vor. Sie haben langwierige
Untersuchungen durchgeführt und sind zu genau
entgegengesetzten Ergebnissen gekommen:
„Europäische Kommission und US-Justizbehörden haben bei dieser Untersuchung eng zusammengearbeitet. Leider sind wir am Ende zu verschiedenen Ergebnissen gekommen, doch muss jede Behörde ihre eigene Analyse durchführen und das Risiko, zu unterschiedlichen Schlüssen zu gelangen, ist, so bedauerlich dies auch sein mag, nie ganz auszuschließen. Das bedeutet nicht, dass die eine Behörde nach objektiven Kriterien verfährt und die andere sich von politischen Zwecken leiten lässt, wie einige behaupten könnten, sondern vielmehr, dass wir Fakten unterschiedlich bewerten und die Folgen eines Zusammenschlusses unterschiedlich einschätzen.“
Der Kommissar bescheinigt beiden Behörden Objektivität
und unterstreicht gerade so, dass unterschiedliche
Bewertungen und Einschätzungen
, also
entgegengesetzte nationale Kalkulationen
ausschlaggebend waren. Die amerikanische Behörde zeigt
sich zunächst verärgert und erhebt den harten Vorwurf des
Verstoßes gegen ein gemeinsames Anliegen – „competition“
– zugunsten von Sonderinteressen – „competitors“ –
„die klare und lange bewährte amerikanische Anti-Trust-Politik geht davon aus, dass das Wettbewerbsrecht den Wettbewerb (competion) schützt und nicht die Wettbewerber (competitors). Die heutige Entscheidung der EU zeigt einen signifikanten Punkt der Abweichung“ –,
lenkt dann aber ein: Die EU-Kommission habe bei ihrer Begründung auf einen Wirtschaftstheoretiker des vorigen Jahrhunderts zurückgegriffen, woraus sich eine Nicht-Übereinstimmung bei den „theoretischen Grundlagen“ ergeben habe. Um künftige „Abweichungen“ zu vermeiden, müsse an deren Vereinheitlichung gearbeitet werden. Mit dieser diplomatischen Einlassung gibt die amerikanische Seite zu verstehen, an der gemeinsamen Sache festhalten zu wollen, und man einigt sich darauf, den Casus für die Ausnahme einer ansonsten harmonischen Zusammenarbeit in Sachen ‚weltweite Fusionen‘ zu halten. Dass das die Sache nicht so recht trifft, beweisen nicht nur die recht scharfen Töne, die im Dialog der Kontrahenten zwischenzeitlich aufgekommen sind; dafür steht allein schon das Abkommen selbst: Mit solchen Ausnahmen wird gerechnet, Konfliktstoff in dieser Sphäre ist ständig vorhanden, zugleich aber auch der Wille, schon ‚im Vorfeld‘ zu einem einvernehmlichen Umgang mit diesem zu gelangen.
*
Die EU-Wettbewerbsbehörde interpretiert ihre Aufgabe der Betreuung des Wettbewerbs – und die amerikanische hält es genauso – als fördernde Begleitung des notwendigen und wünschenswerten Zentralisationsprozesses des Kapitals:
„Die logische Folge des Wettbewerbs ist eine ständige Ressourcenumschichtung von niedergehenden zu aufstrebenden und rasch wachsenden Unternehmen oder Sektoren… Es ist von größter Bedeutung, diese Reallokation der Mittel nicht aufzuhalten, denn nur so können Wandel und Umstrukturierung reibungslos durch Fusionen, Gemeinschaftsunternehmen und Übernahmen vonstatten gehen. (…) In einem Kontext, der durch die wachsende Ausdehnung der Märkte sowie dadurch gekennzeichnet ist, dass es einer immer größeren kritischen Masse bedarf, um als Marktteilnehmer eine aktive Rolle zu spielen, haben Anzahl und Komplexität der von der Kommission zu untersuchenden Fusionen und Allianzen ständig zugenommen.“ (Weißbuch 2000 der Kommission, S.9)
Zugleich kennt die Kommission aber auch Schattenseiten
dieser an sich begrüßenswerten
Ressourcenumschichtung
und Reallokation der
Mittel
, und auf diese wirft sie ein kritisches Auge:
Keineswegs immer muss es bei einer Fusion um das Ergebnis
einer gewachsenen Kapitalproduktivität und einen Hebel zu
deren weiterer Steigerung handeln. Es kann sich im
Gegenteil hinter ihr auch deren Ersatz, eine
Unterbindung der sich wechselseitig
anstachelnden Konkurrenz verbergen – wenn es nämlich
einzelnen gelingt, sich als konkurrenzlos zu
positionieren. Nicht nur Wandel
und
Umstrukturierung
sind dann die Folge, sondern mit
ihnen unterbleibt auch der Kampf um die Senkung des
Kostpreises – weil die einen den anderen monopolistische
Preise aufdrücken und denen wie von ihnen abhängigen
„Marktteilnehmern“ damit die Behauptung im Markt
unmöglich machen können. Das ist zum einen eine Störung
der „organischen“ Entwicklung der Kapitalakkumulation
einer Nation. Zum anderen gerät der Staat selbst in
Mitleidenschaft, da er von solchen (über-)mächtigen
Kapitalen erpresst werden kann, sein rechtlicher Zugriff
an Wirksamkeit verliert. Eindeutige Kriterien und daraus
abzuleitende Handlungsnormen, wann eine Fusion o.ä. „dem
Wettbewerb“ schadet oder „Wandel und Umstrukturierung“
ihm dient, gibt es allerdings nicht und kann es nicht
geben. Pro und Contra verfügen in der Regel über
volkswirtschaftlich vernünftige Gründe, die von der
Wettbewerbsbehörde frei gewürdigt werden und über die sie
im Rahmen eines weitgesteckten Ermessensspielraumes
entscheidet. Dieser Rahmen erhält jedoch eine eindeutige
Orientierung, wenn sich der Blick nach außen richtet,
also darauf, welche Anforderungen die nationale
Wirtschaftskraft erfüllen muss, wenn es um ihre Bewährung
auf dem Weltmarkt geht: Da kann eine Nation vom weltweit
geschaffenen Reichtum nicht profitieren und in der
internationalen Politik nicht mitmischen, wenn sich nicht
auf ihrem Boden möglichst kapitalmächtige Konzerne
herausbilden, sich durch internationale Allianzen zu
Multis auswachsen und sich an die Eroberung des
Weltmarkts machen – und eben so dem heimischen Standort
das entscheidende imperialistische Gewicht verleihen. Das
ist die andere Seite des Schutzes des Wettbewerbs
:
Selbst wenn der nationale Nutzen auch hier nicht vorab
und eindeutig bemessen werden kann, so sieht der Staat
seine Aufgabe doch darin, darin, den Zug zum
Monopol in jedem Fall zu befördern und so dafür zu
sorgen, dass „seine“ Konzerne sich in der internationalen
Konkurrenz behaupten können. Dabei bleibt deren
nationale Anbindung insofern erhalten, als
solche Multis schon nicht vergessen, wer „ihr“ Staat ist:
Er ist die erste Adresse, wenn es um Wegbereitung und
Begleitschutz bei den Abmachungen mit auswärtigen
Herrschaften geht, die ihnen erst den lohnenden Zugriff
auf deren Reichtümer eröffnen und dann auf Dauer
garantieren. Andererseits ist in der Förderung eines
internationalen Geschäftslebens eingeschlossen, dass auch
auswärtige Multis Anspruch auf zuvorkommende Behandlung
haben, ihnen – zumindest im Grundsatz – die
Geschäftstätigkeit auf dem eigenen Territorium, das
Profitieren an der eigenen Volkswirtschaft, zu erlauben
ist – worüber sich die Unterscheidung zwischen „eigenen“
und „fremden“ Konzernen auch wieder einigermaßen
relativiert. Ob und wie die Freiheit der „eigenen“ wie
der „fremden“ zum Vorteil eines Staates ausschlägt, ist
die jederzeit offene Frage, weswegen der Verdacht, solche
internationalisierten Konzerne würden Schutz und
Förderung durch ihren Staat zusammen mit ihrer Freiheit
zur internationalen Betätigung nur zur Auslagerung ihres
Geschäfts verwenden und gar zur „Kapitalflucht“
übergehen, nicht verschwinden will. Ebenso wenig wie das
Ressentiment, wonach ausländische Konzerne nur
Vergünstigungen und Sonderangebote mitnehmen, um die
heimische Wirtschaft ihrer eigenen
Entwicklungsmöglichkeiten zu berauben, sie zu
„überfremden“, ohne sich auf einen dauerhaften Dienst auf
dem und am Standort verpflichten zu lassen. Was die
großen Standorte angeht, so herrschen dort die
‚gewachsenen Beziehungen‘ vor. Da wissen Staat und –
„seine“ – Multis, was sie aneinander haben, die Furcht
vor „Kapitalflucht“ ist ausgestorben und der darauf
gerichtete Katalog restriktiver Maßnahmen verstaubt. Da
ist auf die Kombination von nationalem Stand- und
internationalem Spielbein Verlass, und englisch
radebrechende Manager deutscher Weltfirmen lassen an
ihrer nationalen Treue keinen Zweifel aufkommen; es soll
sogar schon vorgekommen sein, dass ein deutschnationaler
Multi die Tatsache, dass er einem ausländischen Konzern
mit deutschem Tarnnamen ein spanisches
Einkaufspreisdrückungsgenie samt Disketten stibitzt hat,
zur notwendigen Aktion im Rahmen eines – so wörtlich –
Krieges zwischen Deutschland und Amerika
erklärte…
Aber auch für den Rest der Staatenwelt gilt, dass
Bedenken gegen das Wirtschaften von Multis nur noch in
seltenen Ausnahmefällen praktisch wirksam
werden. Es hat sich eben als „Einsicht“ durchgesetzt,
dass der staatlich geförderte Siegeszug der Multis zwar
manche Abhängigkeit mit sich bringt, ohne sie
die Nation aber gleich gar keinen Stand in der
internationalen Konkurrenz hat. Aber maßgeblich sind
diese Staaten mit ihrer Auffassung sowieso nicht. Und die
maßgeblichen Staaten, die mit ‚G7‘ ziemlich erschöpfend
benannt sind, bestehen in ihrer gemeinsamen Herrschaft
über den Weltmarkt eben auf der unbedingten
Freiheit des Kapitals – um sich dann daran zu machen, die
Bedingungen dieser Freiheit unter sich
auszuhandeln. Denn daran besteht erheblicher Bedarf, wenn
mit der Ausbreitung ihrer „global players“ sich zunehmend
die Frage stellt, welcher von denen – und damit auch:
welche Nation – denn nun das Kommando übernimmt. Das
erfolgreiche Gemeinschaftsunternehmen drängt immer mehr
auf wechselseitigen Ausschluss von der
gemeinsamen Eroberungsmasse, was wiederum die Haltbarkeit
der Kooperation auf harte Proben stellt. Jetzt ist der
Fall eingetreten, dass die EU-Wettbewerbshüter sich
genötigt sehen, der Internationalität des
Kapitals, wie sie sich die USA wünschen, eine
euro-nationale Schranke zu setzen.
*
Denn wer durch das Verbot der Fusion geschützt werden
soll, ist kein Geheimnis: Immerhin machen alle
Komponenten, die nach der Fusion von GE hätten angeboten
werden können, zusammen 50 Prozent des Werts eines Airbus
aus.
(SZ, 4.7.)
Das Monopol, das Europa auf seinem Territorium
errichtet hat, seine ‚Europäische Luft- und
Raumfahrtindustrie‘ (EADS), will es nicht in Abhängigkeit
von einem amerikanischen Vorlieferanten geraten lassen.
Es hat viele Jahre und sehr viel Staatsgeld gebraucht, um
gegen das existente Monopol Amerikas in Gestalt
von Boeing ein europäisches Gegenmonopol
aufzubauen. Dieses Gegenmonopol braucht Europa, um sich
in fundamentalen Bereichen der Rüstung
unabhängig zu machen, und es erfüllt diesen Anspruch in
der anspruchsvollen Art, wie sie führenden
kapitalistischen Nationen eigen ist: Es funktioniert als
kapitalistisches Geschäft, also mit dem
„dual-use“-Nutzen, für den eigenen Gebrauch wie für den
Export nützliche Rüstungsgüter zu produzieren; es
produziert diese zusammen mit Flugmaschinen, die es auf
dem weltweit bedeutsamen Markt der zivilen
Luftfahrt zu respektablen Ergebnissen gebracht haben; und
es setzt der früheren Übermacht Boeing mittlerweile
heftig zu, verspricht also tatsächlich, den
Gründungsanspruch – Unabhängigkeit und Rendite –
einzulösen.
Da haben es Europa und Amerika also in dieser
„Schlüsselindustrie“ soweit gebracht, dass sie den
Weltmarkt mehr oder minder unter sich „aufteilen“ – wobei
von Teilung nicht die Rede sein kann: es handelt sich
schon eher um eine Art ‚Endkampf‘, wie ihn sich W. I.
Lenin in früherer Zeit, als er die Konkurrenz der
Nationen in einem „höchsten Stadium“ wähnte, vorgestellt
haben muss. Dass die Kommission in einem bislang
einmaligen Schritt
, nämlich einseitig die
Fusion verbietet, ist daher kein Wunder: In das bisherige
„Gleichgewicht“ dieses Endkampfes greift nun die
beherrschende Stellung
(Begründung der Kommission) eines
dritten Monopolisten ein, der dem Ganzen eine
eindeutige US-Schlagseite verleiht. Damit droht das von
Europa aufgebaute Gegenmonopol unter amerikanische
Fuchtel zu geraten, was ein Schaden ist, der an die
Substanz geht: Dies würde Europas Weltmarktposition und
-ambition überhaupt erschüttern.
So ist die Fusion ein exemplarischer Fall, wie auf einem
sehr hohen Niveau konkurrierende Wettbewerber
Grundsatzfragen aufwerfen, die die politischen
Konstruktionsprinzipien ihres Wettbewerbs betreffen, und
genau für diesen Konfliktfall haben sich die
Weltmarktführer gewappnet, als sie ihr „Agreement“
aufsetzten. Einerseits betreiben die Blöcke ihren
internationalen Verdrängungswettbewerb mit aller
Entschiedenheit; andererseits räumen sie sich
wechselseitig das Recht ein, dagegen ihr
Veto einlegen zu können: Das aktuelle Vorgehen
der EU ist nicht vertragswidrig, sondern beruht auf einem
gemeinsam vereinbarten Abkommen; neu ist nur, dass von
dem vereinbarten Recht bislang noch nicht Gebrauch
gemacht wurde. So wird zwar eine Fusion, die nach
Auffassung der US-Behörde im nationalen Interesse der USA
liegt, weil sie dieser Nation gerade gegenüber einem
Hauptkonkurrenten Vorteile verschaffte, von der EU in
rechtlichem Einvernehmen mit den USA erfolgreich
verhindert. Dass allerdings die EU mit ihrer Berufung auf
wettbewerbsrechtliche Verfahrensfragen unmittelbar auch
noch andere sehr grundsätzliche Fragen aufwirft, ist
allen Beteiligten bewusst. Wenn sich die Parteien
verpflichten, jedes bei sich eröffnete Fusionsverfahren
der anderen Partei zu melden – jede Partei soll die
andere in jedem Fall davon in Kenntnis setzen, wenn ihre
Wettbewerbsbehörden bei ihrer Rechtsprechung wichtige
Interessen der anderen Partei berühren
–, dann gehen
sie erstens von einer wechselseitigen ‚Durchdringung‘
aus, bei der alle Mal „wichtige Interessen“ zumindest
berührt, wenn nicht angegriffen werden, wenn Kapital
zentralisiert wird. Zweitens weiß jede Partei von der
Macht der anderen, eine missliebige Fusion praktisch
unwirksam machen zu können – wobei für die EU gilt,
dass die sich ihre Macht erst einmal erobern musste,
weswegen das Abkommen nicht zufällig mit der Schaffung
des europäischen Binnenmarktes zusammenfällt. Beide
Seiten kommandieren Märkte, die für jede von ihnen
unverzichtbar sind – die also, wenn sie
verschlossen werden, auch das mit der Fusion
intendierte Geschäft verunmöglichen. Zu einem
solchen Zerwürfnis soll es aber erst gar nicht kommen,
weil alle Beteiligten über den Schaden, der aus der
Einleitung wirtschaftspolitischer Kampfmaßnahmen
entsteht, eines auf jeden Fall wissen: Er ist
unkalkulierbar. Aus diesem Grund haben die
Kontrahenten das spezielle Kapitel der
Außenhandelsdiplomatie eröffnet, in dem sie diesen
speziellen Konfliktfall verrechten und sich
wechselseitig von solchen Kampfmaßnahmen
abhalten wollen. Mit dem Vetorecht ermitteln sie
sozusagen, wo die Schmerzgrenze verläuft: Seine Androhung
oder gar Anwendung ist die klare Auskunft, was die eine
Partei sich nicht gefallen lassen kann und wovon
die andere tunlichst Abstand nehmen sollte. Das
beschneidet natürlich nicht im geringsten die Freiheit,
auf exakt die Situationen hinzuarbeiten, die diese
Anrufung des Vetorechts provozieren – im Gegenteil: Man
hat sich ja nun die Rechtsnorm geschaffen, solche aus der
Konkurrenz gegeneinander quasi naturwüchsig erwachsenden
Konfliktfälle zu bewältigen.
Damit ist unterhalb des Vetorechts, das so etwas
wie einen Schlusspunkt setzt, für viel diplomatischen
Verkehr gesorgt. Nicht zu Unrecht spielt in der
Zusammenarbeit der Behörden die Kategorie
Vertrauen
eine große Rolle. Das ist nämlich in der
Form vorhanden, dass beide einander einen
berechnenden Willen zur Konfliktvermeidung
unterstellen; weil die Berechnung aber immer
darauf zielt, das Einverständnis der Gegenpartei
zu einer gegen sie gerichteten Maßnahme zu
erlangen, muss es auch beständig hergestellt
werden. Die Sache läuft im Kern auf einen – in einem
formalisierten Verfahren niedergelegten – Tauschhandel
hinaus, in dem die Parteien eruieren, wie und warum sich
für sie jeweils zu große Zumutungen ansammeln; wo sie
sich mit ihren Güterabwägungen bekannt machen
und ermitteln, ob und wie sie mit denen gemeinsam im
Geschäft bleiben können, dabei gleichzeitig neue
ermitteln, und sie aneinander ausprobieren. Der übliche
Kompromiss besteht in einem Verlangen nach „Abhilfen“
(„remedies“), also nach Abstrichen, mit denen
Einzelheiten oder Teile einer Fusion nach dem eigenen
Bilde umgewandelt werden sollen. Das Aushandeln solcher
„Abhilfen“ hat darüber hinaus die methodische Qualität,
dass der Abstimmungsprozess selbst ein Test darauf ist,
inwiefern die andere Seite, was die Gestaltung des
Verfahrens angeht, Respekt vor eigenen
Vorstellungen aufbringt – oder auf einer härteren Gangart
beim Austragen des Konflikts besteht. Das geht
schließlich bis zur Gestaltung des Klimas, in
dem sich diese Repräsentanten einer wichtigen Sache ihrer
Nationen treffen und an dem sie „arbeiten“, was durchaus
als Ausweis dessen genommen werden kann, wie es zwischen
den Nationen überhaupt steht. Wenn es nach all
den Güterabwägungen, Verfahrensregel- und Klimaarbeiten
dann doch zu einem Einspruch kommt, dann ist
alles vorbereitet für die Frage, ob noch einmal von einer
‚Ausnahme‘ gesprochen werden kann – oder ob die damit
schon eingetretene Verschlechterung der
Beziehungen nicht gleich ausgesprochen werden muss.
Im vorliegenden Fall sind die Konkurrenten noch
entschlossen, ihren Gegensatz als Streit um die
„Verfeinerung“ des Regelwerks dieser speziellen
Außenhandelsdiplomatie auszutragen. Und das geht dann so,
dass man den Vorschlag, die gesamte Materie an die
nächste WTO-Runde zu überweisen, mit der Begründung
zurückzieht, diese ohnehin schon überfrachtete
Normensetzungs- und Streitschlichtungsinstanz der
imperialistischen Konkurrenz könnte ein wenig sehr viel
Streitregelungsbedarf akkumulieren und darüber endgültig
überfordert
werden…