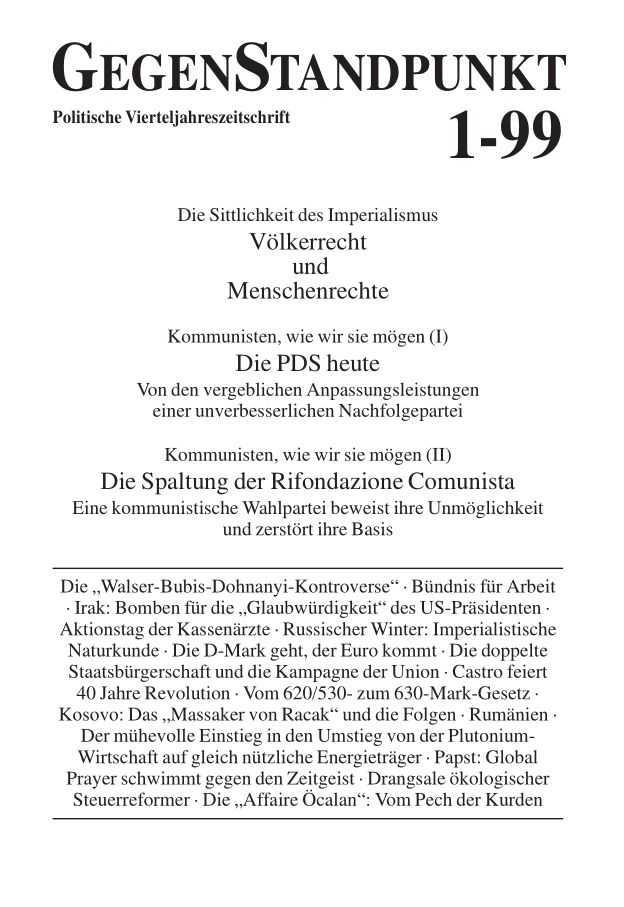Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Zur Fusion von Hoechst und Rhône-Poulenc
Geschäftsgeist, Zeitgeist, Lokalpatriotismus und ein bisschen deutsche Betriebsratskultur
Zwei Großfirmen lassen die Konkurrenz gegeneinander und sparen Kosten beim Faktor Arbeit – bei sich und / oder damit anderswo. Da kommt frischer Wind in die gemütlichen Werkshallen – applaudiert die professionelle Öffentlichkeit – nur Lokalpatrioten leiden, weil Auswanderung fällig ist. Und die Gewerkschaft achtet auf sozialverträglichen Stellenabbau und sorgt sich um die gewerkschaftlich mitbestimmte patriotische Betriebskultur.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Zur Fusion von Hoechst und
Rhône-Poulenc
Geschäftsgeist, Zeitgeist,
Lokalpatriotismus und ein bißchen deutsche
Betriebsratskultur
Der Aufsichtsrat der Hoechst AG beschließt die Abspaltung und den Verkauf einiger Geschäftsabteilungen und will den Restkonzern mit der französischen Rhône-Poulenc fusionieren, um „eine sehr schlagkräftige und wettbewerbsfähige Einheit“ (Handelsblatt, 26.11.98) im Kampf um die Aufteilung des Weltmarktes für „Pflanzen- und Tierschutz“ zu bilden. Die Firmenleitung verspricht sich, d.h. ihren Aktionären davon enorme „Synergieeffekte“: Einsparungen in allen Sektoren, vom Einkauf bis zur Werbung. Sachkundige Beobachter prüfen die versprochenen Vorteile skeptisch in aller Öffentlichkeit hin und her – ein kleiner Service für die vielen virtuellen Aktienspekulanten im Lande und auf jeden Fall viel kritische Information für ein nationales Publikum, das von seiner Kapitalistenklasse gebieterisch deren gelungene Bereicherung fordert. Am Ende kommt dann so sicher wie das Amen in der Kirche – als kleine Grußadresse an diejenigen, die von den Konkurrenzmanövern ihrer Firma wieder einmal den Schaden haben – die zweifelnde Frage, ob „Fusionen nicht auch mehr und mehr zu Arbeitsplatzkillern werden“ (SZ, 29.12.98).
Ein schönes Bedenken! Woher sollen die versprochenen Einsparungen denn sonst kommen, worin sollen die „Synergieeffekte“ anders bestehen, als daß die Firmen für den zusammengelegten und gemeinsam gesteigerten Umsatz weniger Löhne zu zahlen brauchen, weil sie Arbeitskräfte überflüssig machen?! Bloß für ein bißchen mehr Einkaufsrabatt schließen Großkonzerne sich bestimmt nicht zusammen. „Jobkillende“ Maßnahmen sind allemal das Mittel der Wahl, um „Synergieeffekte“ zu erzielen. Und auf der anderen Seite führen die angestrebten Erfolge, wenn sie denn eintreten, bei den Konkurrenten erst recht zu „Arbeitsplatzabbau“. Denn denen sollen schließlich Marktanteile weggenommen werden: Es geht um die Entscheidung, wer mit seinen „rentablen Arbeitsplätzen“ den Weltmarkt für Pestizide und ähnliche Genußmittel erobert.
*
Um diese Entscheidung geht es immerzu, auch bisher schon, und offenbar so ultimativ, daß sich die zwei Großfirmen glatt gedrängt dazu sehen, ihre Konkurrenz gegeneinander zu lassen und gemeinsam gegen die verbleibenden Dritten vorzugehen. Das Bedenken, ob die „Fusionitis“ nicht am Ende „Arbeitsplätze vernichtet“, liegt daher auch andersherum gesehen voll daneben: Arbeitsplätze werden „gekillt“, weil der kapitalistische Konkurrenzkampf überhaupt und immerzu mit dem Mittel der immer ergiebigeren Ausbeutung des „Faktors Arbeit“ geführt, von dessen Lieferanten also ein immer geringeres Quantum benötigt wird. Speziell die Firma Hoechst hat es hier schon in der Vergangenheit an nichts fehlen lassen und sich seit 94 von einem Kostenfaktor in Höhe von einigen -zigtausend Entgeltempfängern getrennt. Ziemlich albern also die Vorstellung, die jetzige Fusion wäre womöglich daran schuld, wenn demnächst weitere Hoechst-Beschäftigte überflüssig gemacht werden: So geht kapitalistischer Fortschritt allemal vonstatten, und nur so. Fusionen sind nicht mehr und nicht weniger als ein zusätzliches Hilfsmittel, um mit den rentabelsten Arbeitsplätzen weltweit am besten im Geschäft zu bleiben.
Insofern ist es auch nur gerecht, nämlich der Blödheit des Bedenkens gegen den „Arbeitsplatzkiller Fusion“ angemessen, wenn der Firmenvorstand dreist darauf besteht, die Fusion wäre ein einziger „Beitrag zur globalen Beschäftigungssicherung“: Natürlich geht es keiner Firma einfach um die Beseitigung von Arbeitsplätzen, sondern um produktivere; also um eine ertragreichere Ausbeutung des „Faktors Arbeit“ da – an den „Plätzen“ –, wo er noch gebraucht wird; folglich um Arbeitsplätze, mit denen sich sicherer als bisher Gewinn erwirtschaften läßt. Und wenn einmal akzeptiert ist, daß das die einzige „Sicherheit“ ist, die es für einen beschäftigten Arbeitnehmer gibt: an solchen Plätzen gebraucht zu werden, dann geht die absurde Gleichung auf: Dann läßt die Firmenkalkulation sich so ausdrücken, daß es darin um gar nichts anderes ginge als um die Sicherung der Arbeitsplätze, die im Zuge der geplanten „Synergieeffekte“ nicht wegrationalisiert werden. Dann wird aus dem „Jobkiller“ im Nu eine „Beschäftigungsgarantie“ – und nicht nur das: „Ist der Konzern aber erst einmal ‚optimal‘ aufgestellt, führt die neu hinzugewonnene Stärke zumeist auch zu Neueinstellungen“ (SZ, 29.12.). Zumeist – und wenn überhaupt, dann natürlich auf Kosten der Arbeitsplätze bei der Konkurrenz.
*
Mit dieser trostreichen Botschaft mag sich zufrieden geben, wer will; dem Zeitgeist am Ende des 20. Jahrhunderts ist damit keineswegs Genüge getan. Dieser öffentliche Geist will gar nicht dahingehend beruhigt werden, der „Arbeitsplatzabbau“ würde auch und gerade im Fall größerer Firmenzusammenschlüsse letztlich nur im Interesse gesicherter oder sogar neuer Arbeitsplätze betrieben. In den Notwendigkeiten, wie sie jetzt ja wohl feststehen, will man sich ganz genau auskennen, und so steht das sachverständige Urteilswesen längst auf dem Standpunkt, daß jede Arbeitskraft, die morgen eventuell wegrationalisiert wird, gestern schon zuviel war, ihre Benutzung also ein Fall von verdeckter Arbeitslosigkeit; es werden Töne laut, denen zufolge es sich bei regelmäßiger Fabrikarbeit um so etwas wie eine Pfründe für Lohnempfänger handeln muß; die offenbar gemeint haben und von ihrer Firma, die den Zug der Zeit glatt verschlafen hat, sogar in dem Glauben belassen wurden, sie könnten es sich auf ihrem Arbeitsplatz „bequem einrichten“. Daß nunmehr einiges an Entlassungen ansteht und einiges an Absenkung des Arbeitsentgelts außerdem – in Zukunft, weiß „Der Spiegel“, wird bei Hoechst „nach Leistung bezahlt“, so daß mancher „mit Gehaltseinbußen rechnen“ muß –, wird überhaupt nicht als – ‚unvermeidliche‘ – Härte bedauert, sondern mit fundamentalistisch gläubiger Befriedigung begrüßt: als längst fällige „Neuausrichtung der Betriebskultur“ im besonderen und als Modernisierung eines verträumten bundesdeutschen „Heimatkapitalismus“ im allgemeinen: „Damit wird der Wind in den Unternehmen rauher. Die deutschen Unternehmen, bislang stark von den Interessen der Mitarbeiter geprägt, nehmen nun Abschied vom rheinischen Harmonie-Kapitalismus“ (Wirtschaftswoche, 3.12.98). Eine Art Steinzeitphase bundesrepublikanischer Wirtschaftsgeschichte geht also endlich zuende, in der „Firmen mit vorbildlichen Sozialleistungen als ‚Familie‘ galten“ (SZ, 3.12.98). Schluß auch mit den rührenden Sentimentalitäten alter Gewerkschaftler, „die die gute alte Zeit umtreibt, … die Sehnsucht nach einer Ära, in der die paritätische Mitbestimmung nicht umstritten war und in der die Arbeiter sich auch über die Mitsprache an Entscheidungen mit der Firma identifizierten“ (ebd.). Das alles ist extrem unmodern. Arbeitnehmer sind Anhängsel und Manövriermasse ihrer Arbeitgeber; darüber soll sich und denen niemand mehr etwas vormachen, so als gäbe es an unserer sowieso alternativlosen kapitalistischen Klassengesellschaft irgendetwas Anrüchiges, was man besser verschweigen oder schönfärberisch ableugnen sollte. Wer meint, ein Arbeitnehmer müßte von seiner Arbeit wenigstens halbwegs gesichert existieren können, hängt einem total veralteten und überholten „Arbeitsbegriff“ an und vertritt eine „Anspruchshaltung“, die einfach nicht mehr in die Zeit paßt.
*
Dennoch, auf ein einhellig positives Echo darf das Hoechst-Management nicht rechnen. „Bild“ legt eine zehnteilige Serie „Frankfurt und Hoechst: 135 Jahre mit dem Chemiegiganten“ auf, geht die Belegschaft besuchen und ermittelt im Betrieb „Unsicherheit, Depression und miese Stimmung“ (Bild, 10.12.98), der das Arbeiterblatt eine öffentliche Stimme verleiht.. Den guten Leutchen „reicht es nämlich“ aus einem höchst ehren- und anerkennenswerten Grund: Da hat man 135 Jahre lang eine Art Familienbetrieb – gegründet mit 4 Mann! – aufgebaut, den Namen „Hoechst in aller Welt verbreitet“, mit „Pflanzenschutz und Tierschutz unter gutem deutschen Namen“ alle Welt beglückt, und dann legt die Firma ihren Namen ab, fusioniert mit dem alten französischen Konkurrenten Rhône-Poulenc(!), nennt sich in Zukunft „Aventis“ (!!) und verlegt ihren Firmensitz nach Straßburg (!!!).Wenn das kein Verrat am deutschen Standort ist! Doch darüber kann sich der wahre abhängig beschäftigte Auskenner „schon lange nicht mehr wundern“: „Globalisierung, Filettierung, Zergliederung, Outsourcing – das geht doch in Ansätzen seit Jahren so!“ (SZ, 3.12.98, die auch dem Volk aufs Maul schaut). Dem obersten Hoechst-Chef Dormann geht es doch bloß um die „Zerschlagung eines Weltkonzerns“; systematisch verwandelt er die geschichtsträchtige Chemiefabrik in ein „heimatloses Konglomerat“ (ebd.); skrupellos agiert er als bloßer „Kaufmann, nicht als Bewahrer eines Traditionsunternehmens“ (FAZ, 2.12.98).
Bei soviel lokalpatriotischer Begeisterung für seine Firma muß am Ende der Chef vom Dienst selber doch auch einmal daran erinnern, wie sein Unternehmen jahrzehntelang der Heimat seiner „Mitarbeiter“ mitgespielt hat, und daß „die Gefühle, die die Menschen dem Namen Hoechst entgegenbringen, doch auch immer mit gelbem Regen und Betriebsunfällen verbunden waren“ (Bild, 18.12.98). Doch wer will davon heute noch etwas wissen? Wann soll das überhaupt gewesen sein?
*
Die organisierten Vertreter der Arbeiterinteressen, Betriebsrat und Gewerkschaft, sind auch nicht zufrieden. Zwar verstehen sie alles und billigen das Bemühen der Firma um „Synergieeffekte“:
„Die Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat der Hoechst AG hat sich grundsätzlich mit der anstehenden Umbaumaßnahme des Gesamtkonzerns und der Fusion mit der französischen Rhône-Poulenc einverstanden erklärt.“ (SZ, 9.12.98)
Dem Firmenchef Dormann, der „derzeitige Angaben über Arbeitsplätze grundsätzlich für unverantwortlich“ hält (SZ, 3.12.98), wird jedoch mutig und nicht ohne Kampfbereitschaft die Zusage abgetrotzt, „die Restrukturierung sozial verträglich zu halten“. Dafür ist er genau der richtige Mann; schließlich hat er seit seinem Dienstantritt die Mitarbeiterzahl der Hoechst AG bereits sozial und verträglich von etwa 170000 auf etwa 95000 umstrukturiert.
Gefahr sieht die Gewerkschaft allerdings noch von ganz anderer Seite drohen:
„Die IG Chemie fürchtet, daß auf diesem Wege die Mitbestimmung nach deutschem Muster ausgehebelt wird… Die Arbeitnehmervertreter wollen eine Mitbestimmungslösung für das neue deutsch-französische Pharma-Unternehmen erreichen.“ (SZ, 9.12.98)
Diese Sorge fällt für die kritische demokratische Öffentlichkeit in dem Fall interessanterweise nicht einfach unter die Rubrik ‚Gewerkschafter-Nostalgie‘. Man weiß nämlich, Zeitgeist hin oder her, was das globalisierte deutsche Kapital an seiner deutschen IG Chemie hat und was unter französischem Firmenschild droht:
„In Deutschland gilt die IG Chemie seit langem als eine kooperationsbereite, von ideologischen Schlacken befreite Gewerkschaft, während sich die bei Rhône-Poulenc führende CGT noch nicht völlig vom geistigen Erbe des Klassenkampfes befreit hat.“ (FAZ, 2.12.98)
Und diese „klassenkämpferischen“ Überbleibsel könnten, so hat das Handelsblatt tags zuvor herausgefunden, glatt dazu führen, daß aus dem Deal überhaupt nichts wird. Die CGT hat nämlich angekündigt,
„daß sie alles tun wird, um die Fusion zum Scheitern zu bringen. Es handle sich nach Auffassung der CGT eher um eine Übernahme von Rhone-Poulenc durch Hoechst. Die Gewerkschaft bevorzugt eher eine nationale Lösung durch die Zusammenführung aller Pharmaaktivitäten in Frankreich.“ (HB, 1.12.98).
Dagegen ist der weltoffene Geist des bundesdeutschen Gewerkschaftspatriotismus, der vieles erträgt, aber von seinem nationalen Recht auf Mitbestimmung partout nicht lassen will, doch ein einziger Segen für unsere „global players“… Die öffentliche Meinung in der deutschen Demokratie weiß fein zu sortieren: Dem Standpunkt der gewerkschaftlich mitbestimmten patriotischen Betriebskultur gibt sie Recht, wo er gegen den unhandlichen Patriotismus französischer Arbeiterorganisationen steht und den national gebilligten Konkurrenzinteressen des Kapitals in die Hände arbeitet; ansonsten, nämlich wo sich die Hoffnung auf so etwas wie materielle Existenzsicherheit für brave Arbeitnehmer damit verbinden könnte, gehört er auf den Misthaufen der Geschichte.
*
So weit ist es also gekommen: Die gewerkschaftlichen Rechtsanwälte des proletarischen Personals, und zwar in Frankreich wie in Deutschland, mißtrauen zehnmal eher den betrieblichen und betriebsgewerkschaftlichen Sitten ihrer nächsten europäischen Nachbarnation als den Ansprüchen ihres heimischen Ausbeutungsgewerbes und klammern sich an die Segnungen, die sie sich von ihrem kapitalistischen Vaterland versprechen. Derweil fusionieren ihre Arbeitgeber – ein wohlberechnetes Stück „internationale Solidarität“ als Waffe für ihren globalen Konkurrenzkampf.