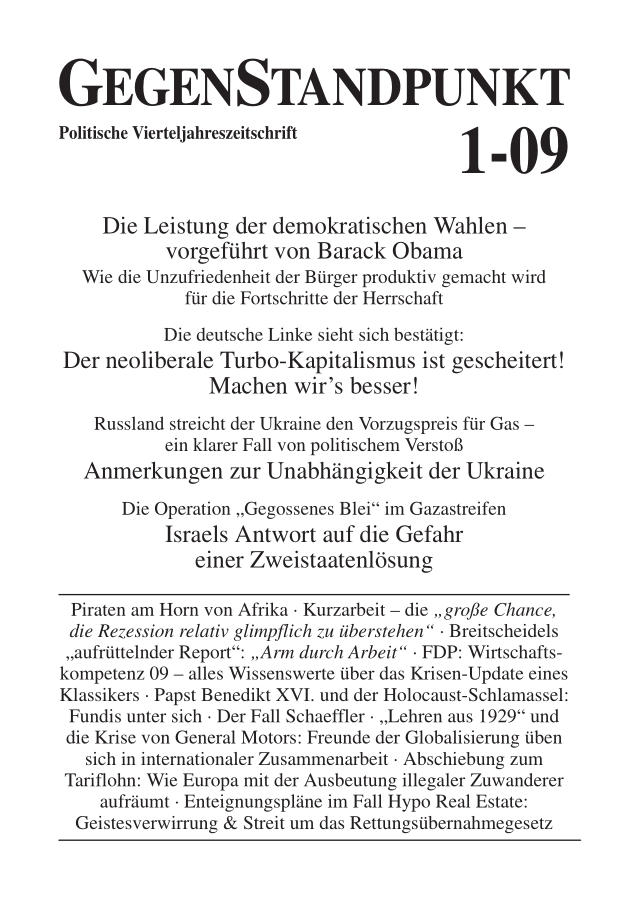Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Der Fall Schaeffler:
Gewerkschaftlicher Einsatz für Beschäftigung in drei Akten
Das Familienunternehmen Schaeffler, ein Zulieferer der Automobilindustrie, erobert in einer feindlichen Übernahme mit Hilfe trickreicher Aktienoptionen und zweistelligen Milliardenkrediten von Großbanken die viel größere Aktiengesellschaft Continental. Spekuliert wird von der Eigentümerin und ihren finanzkapitalistischen Helfern auf künftige Erträge, die die Sache für alle lohnend machen: auf eine erfolgreiche Zukunft des vergrößerten Unternehmens dank gesteigerter Marktmacht und ‚Synergieeffekten‘, auf den steigenden Aktienwert des eroberten Unternehmens; den Banken winken satte Zinseinkünfte, und mit Verbriefungen wollen sie die vergebenen Kredite gleich wieder in verfügbares Bankvermögen ummünzen: Alles in allem eine der ‚Übernahmeschlachten‘ und finanzkapitalistischen Manöver, die zur Konkurrenz der feindlichen Brüder dazugehören. Die Betriebsbelegschaften sind bei all dem selbstverständlich als Manövriermasse eingeplant; sie sind ja der hauptsächliche Kostenfaktor, an dem sich besagte ‚Synergieeffekte‘ erzielen lassen: Die Arbeitsplätze werden rentabler durchorganisiert, manche doppelte Arbeit entfällt, Arbeitskräfte werden überflüssig gemacht, das sorgt für Kosteneinsparungen, verspricht gesteigerte Gewinnmargen und beflügelt die finanzkapitalistischen Erwartungen. Das ist niemandem ein Geheimnis, auch nicht den Gewerkschaften.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Der Fall Schaeffler:
Gewerkschaftlicher Einsatz für Beschäftigung in drei Akten
Das Familienunternehmen Schaeffler, ein Zulieferer der Automobilindustrie, erobert in einer feindlichen Übernahme mit Hilfe trickreicher Aktienoptionen und zweistelligen Milliardenkrediten von Großbanken die viel größere Aktiengesellschaft Continental. Spekuliert wird von der Eigentümerin und ihren finanzkapitalistischen Helfern auf künftige Erträge, die die Sache für alle lohnend machen: auf eine erfolgreiche Zukunft des vergrößerten Unternehmens dank gesteigerter Marktmacht und ‚Synergieeffekten‘, auf den steigenden Aktienwert des eroberten Unternehmens; den Banken winken satte Zinseinkünfte, und mit Verbriefungen wollen sie die vergebenen Kredite gleich wieder in verfügbares Bankvermögen ummünzen: Alles in allem eine der ‚Übernahmeschlachten‘ und finanzkapitalistischen Manöver, die zur Konkurrenz der feindlichen Brüder dazugehören. Die Betriebsbelegschaften sind bei all dem selbstverständlich als Manövriermasse eingeplant; sie sind ja der hauptsächliche Kostenfaktor, an dem sich besagte ‚Synergieeffekte‘ erzielen lassen: Die Arbeitsplätze werden rentabler durchorganisiert, manche doppelte Arbeit entfällt, Arbeitskräfte werden überflüssig gemacht, das sorgt für Kosteneinsparungen, verspricht gesteigerte Gewinnmargen und beflügelt die finanzkapitalistischen Erwartungen. Das ist niemandem ein Geheimnis, auch nicht den Gewerkschaften.
Angesichts der um sich greifenden Krise gerät die Übernahme dann doch anders als geplant: Die Geschäfte der Automobilindustrie, also auch das des Zulieferers Schaeffler laufen schlecht, die Aktie von Conti bricht ein, und damit schmelzen die Sicherheiten dahin, die Schaeffler den Banken für ihre Kredite gestellt hat. Den Banken selbst gelingt es nicht, die vergebenen Kredite zu verbriefen. Die Übernahme wächst sich also zu einer Verlustgeschichte aus, milliardenschwere Schuldenverhältnisse zwischen Schaeffler und Banken werden prekär. Das ruft die IG Metall auf den Plan.
1. Akt: Im Namen der Beschäftigten: Gewerkschaftliche Ansprüche ans unternehmerische Schuldenmanagement
„Es ist nicht akzeptabel, dass Schulden der Schaeffler KG, die sich aus der Finanzierung des Aktienkaufs ergeben, auf die Continental AG übertragen werden. Die hieraus neu entstandene Schuldenlast haben ausschließlich Manager und Eigentümer zu verantworten. Deswegen wehren wir uns gegen alle Versuche, den Schuldendienst der Banken auf die Beschäftigten abzuwälzen.“ („Gemeinsame Erklärung von Gewerkschaften und Betriebsräten bei Continental und Schaeffler“, IG Metall Bayern online, 13.1.08)
Es ist schon interessant, wann der Gewerkschaft einfällt, dass die Zeche vor allem die Beschäftigten zahlen müssen
. Was gehen die Beschäftigten eigentlich die Kreditverhältnisse der Betriebe an, in denen sie arbeiten? Seit wann zahlen ausgerechnet sie die Bankschulden? Oder andersherum: Wenn schon, dann stehen sie immerzu mit ihrer Arbeit für die Gewinnrechnung ihres Unternehmens ein, egal wie hoch oder niedrig dessen Schuldenstand ist. Wie alle Überschüsse der Firma erwirtschaften sie auch den Schuldendienst. Es ist ja immer dieselbe Geschäftsrechnung, in der sie als Kostenfaktor verbucht sind und wegen der mit mehr oder weniger Kredit ein enormer Aufwand getrieben wird, um ihre Arbeit für ihre Anwender lohnender zu machen. Macht es für die Belegschaft einen Unterschied, wie sich Management und Kreditgeber verständigen oder streiten, wieviel vom erwirtschafteten Ertrag am Ende in die Taschen der Unternehmerfamilie fließt, wieviel die Banken in Form von Zins und Tilgung einstreichen? Es kann den Belegschaften doch gleichgültig sein, ob sie unter dem Diktat einer Schuldenlast oder zum Zwecke der Absicherung oder Steigerung der Konkurrenzfähigkeit „ihrer“ Firma in Anspruch genommen werden: In keinem Fall liegt irgendeine der Berechnungen in ihrer Hand oder in ihrem Interesse.
Die IG Metall weiß es besser. Sie mischt sich in die geschäftlichen Alternativen ein, die Management, Eigentümer und Kreditgeber mit- und gegeneinander ausstreiten; sie zerbricht sich im Namen der Beschäftigten den Kopf der Arbeitgeber und optiert auf der Ebene von deren Alternativen für gute und gegen schlechte Geschäftspolitik:
„Vorrangig für die Beschäftigten ist ... ein ausgewogenes Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital, so dass sie nicht unter der Schuldenlast zusammenbrechen.“ (ebd.)
Die Schulden von Schaeffler sind unsere Schulden! Sie dürfen nicht zu groß geraten, damit wir sie tragen können! Die IG Metall erklärt die Probleme der Eigentümer-Familie, der das Wachstum ihres Firmenimperiums nicht schnell genug gehen konnte, ganz und gar zu den ihren und stellt sich hinter die Schaefflers, die ihre Belegschaft für einen Gewinn antreten lassen, der nun definitiv nicht der ihre ist.
Für diese Gewerkschaft ist es selbstverständlich, sich in Fragen von Schuldenmanagement und Firmenübernahmen, im Streit zwischen Eigentümer und Banken zu engagieren. Sie hat dafür einen Grund: Ihre Leute sind von allem, was der Arbeitgeber im Interesse seines Profits treibt, betroffen, bedroht, beschädigt. Sie aber stellt sich nicht gegen dieses Interesse und seine Konsequenzen, sie stellt es in Rechnung. Ausgerechnet wegen dieser negativen Betroffenheit ihrer Leute will sie alles mitverantworten und mitentscheiden; deswegen tut sie so, als könnte sie bessere und schlechtere Wege der Profitmacherei und der Ausbeutung der Arbeitskraft unterscheiden, die guten befördern, die schlechten den Kapitalisten aber ausreden. Ihr Zauberwort ist „Arbeitsplatz“. In diesem Wort, das jeder versteht, ist die Not der auf Lohnerwerb Angewiesenen zusammengeschlossen mit dem Interesse der Kapitaleigner an der rentablen Benutzung der Arbeit. Die Formel „Arbeitsplatz“ funktioniert als die Drehtür, durch die man mit den Sorgen der Arbeitskräfte reingeht und mit den Sorgen der Kapitalisten rausgeht. Zu allem, was Unternehmer in ihrem Interesse treiben, – auch zu ihren finanzkapitalistischen Kunststückchen – trägt die IG Metall deshalb gute Ratschläge bei; und für alles das verlangt sie Anteilnahme und Engagement von denen, die sie vertritt. Weil in den Konkurrenz-Strategien des Kapitals über ihr Schicksal entschieden wird, haben die Beschäftigten die eine oder andere Alternative dieser Strategien besser zu finden und sich für sie stark zu machen.
Was die gewerkschaftlichen Co-Manager in ihrer Sorge ums Betriebswohl an betriebswirtschaftlichen Weisheiten von sich geben, ist einerseits nur lächerlich: ein ausgewogenes Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital!
– Da schau her! Wer hätte wohl eine Schieflage empfohlen? Und wie viel Schulden sind gute Schulden, nützliches Fremdkapital
, dessen Bedienung keine Last auf dem Rücken der Belegschaft darstellt? Wo beginnt die Überschuldung? Hat Frau Schaeffler etwa Überschuldung herbeiführen wollen, vor der sie nun der Sachverstand der IG Metall bewahrt? Auf die Qualität der Ratschläge kommt es andererseits gar nicht an, sondern auf die Ebene, auf die Denken und Interesse der Belegschaft festgelegt werden: Weil das Scheitern der fränkischen Expansionsstrategie und ein Auseinanderbrechen des neuen Konzerns selbstverständlich Entlassungen mit sich bringen würde, fordert die Gewerkschaft von der Geschäftsleitung nicht mehr und nicht weniger als kapitalistischen Erfolg – so als würde die es an Einsatz für ihre eigene Sache fehlen lassen und müsste daran erinnert werden, worum es in einem kapitalistischen Betrieb geht. Konkurrenzfähigkeit, Solvenz, finanzielle Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
, das ist der Kapitalist dem Arbeiter schuldig – als Bedingung der Möglichkeit von Arbeitsplätzen.
Im Interesse der Arbeitsplätze ist der Abbau von Arbeitsplätzen dann selbstverständlich gerechtfertigt und nötig. Damit hat die IG Metall kein Problem. Gerade jetzt, wo das Unternehmen mit der Überschuldung ringt, in die es die riskante Großspekulation der Eigentümer stürzt, wird Zukunftsfähigkeit
nicht ohne Umstrukturierung
zu haben sein. Die IG Metall stellt sich darauf ein und fordert, man solle sie dabei mitreden lassen!
„Für den Fall, dass Umstrukturierungen erwogen werden, müssen diese im Einvernehmen mit den Betriebsräten ... sowie den Arbeitnehmervertretern im (Conti-)Aufsichtsrat ... erfolgen“. Es muss aufhören, dass die Arbeitervertreter „zu bloßen Zuschauern ... verdammt“ sind „beim Duell der Alpha-Tiere, der Eigentümer und Banken – trotz der Mitbestimmung im Conti-Aufsichtsrat“. (Schaeffler-Nachrichten der IG Metall, 23.1.)
Einige Tage später ist es dann vorbei mit dem bloßen Zuschauen.
2. Akt „Wir sind Schaeffler!“: Eine Großdemonstration für „die Chefin“
Schaeffler sucht beim Staat um eine Bürgschaft von mehreren Milliarden für seine Schulden nach, selbstverständlich mit Berufung auf seine wichtige Rolle für die Arbeitsplätze und den nationalen Standort: Dadurch behalten Tausende von hochqualifizierten Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz in Deutschland
(Schaeffler junior, Handelsblat, 23.2.).
Volle Unterstützung für diesen Standpunkt findet das Unternehmen bei Belegschaft und IG Metall. Unter der Demo-Parole Auch wir sind Schaeffler
stellen sie sich hinter die Forderung, der Staat solle den Coup der Schaefflers decken und ihre Eigentümerschaft über das Unternehmen retten. Arbeiter, Kleinhändler und Wirte einer fränkischen Kleinstadt fordern Staatsknete für die Milliardärs-Familie. Demonstriert wird gegen die Sparsamkeit des Finanzministers und für die „Chefin“. Die lässt sich höchstpersönlich blicken, um ihrerseits zu demonstrieren, wie sehr sie denen dient, die ihren Kapitalinteressen dienstbar sind. Sie gibt ‚ihren‘ Leuten Gelegenheit, vorzuführen, dass sie voll hinter ihr stehen: Rührend wird von beiden Seiten die Ideologie vom ‚Arbeitgeber‘ in Szene gesetzt:
„Maria-Elisabeth Schaeffler trat aus dem Haupttor heraus und winkte unter Tränen ihren Mitarbeitern zu. Von den Demonstranten wurde sie mit Jubel empfangen. Die Chefin umarmte daraufhin einen Mitarbeiter des Betriebsschutzes, der bereits seit mehr als 30 Jahren für das Unternehmen arbeitet. ‚Ich bin ergriffen, beeindruckt und dankbar. Das gibt mir Kraft, weiter für das Unternehmen zu kämpfen.‘“ (SZ, 19.2.) „Die Milliardärin avanciert zur Kult-Figur des Protestes,“ (BILD), die in der BamS erklären darf, was sie fühlt, wenn sie um ihr Kommando über die Firma kämpft: „Seit mehr als 40 Jahren ist mein Leben aufs Engste mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern verbunden. In einer schwierigen Situation, wenn die Menschen so eindrucksvoll zueinander stehen, kann schon mal eine Träne fließen. Dafür muss man sich nicht schämen. ... Ich will und muss bei dieser Demonstration mitlaufen. Ansonsten könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen.“
‚Die mitdemonstrierende Chefin‘ präsentiert sich selbstbewusst als die Instanz, von der Wohl und Wehe ihrer Mitarbeiter abhängt. Die dürfen sich glücklich schätzen, dass Frau Schaefflers anspruchsvolle Vermögensbildung ihnen die Chance eines Auskommens bietet. In ihrer Person wird das kapitalistische Abhängigkeitsverhältnis zur patriarchalischen Vormundschaft über Schutzbefohlene, um die sich die Chefin unermüdlich kümmert: Reichtum hat nichts mit Glücklichsein zu tun... Er ist eine Verpflichtung und eine Verantwortung.
(BamS, 22.2.)
Ausbeutung als heilsames Betriebsregiment und Fürsorge für ‚ihre‘ Leute! Kapitalismus als Zusammenwirken eines verantwortungsbewussten Dienstherren und einer ihm persönlich verbundenen Dienstmannschaft – das stößt die so Angesprochenen nicht ab. Im Gegenteil, von unten stimmt man das Lob der menschlichen Chefin an:
„Sie ist von allen geachtet, kümmerte sich um die Belegschaft, erkundigt sich nach dem Befinden einzelner Mitarbeiter, lädt Azubis aus ganze Europa ein, versäumt kaum ein Rentnertreffen.“ (SZ, 25.2.)
So bekennen sich Arbeiter und Angestellte zur ihrer unselbstständigen, abhängigen Existenz: Unser Schicksal liegt in Unternehmerhand, und weil das so ist, sind wir der Anwenderin unserer Arbeitskraft dankbar und verpflichtet. Die Angestellten demonstrieren für das Eigentum ihrer ‚Chefin‘, dafür dass sie im Schaeffler-Conti-Verbund statt ‚anonymer‘ Banker weiterhin das Sagen hat – so als ob die Banken, wenn sie das Kommando hätten, grundsätzlich anders Profit machen würden als die Chefin. Ausgerechnet den Bereicherungsfanatismus und den ungebrochenen Eigentumsanspruch dieser Dame schätzt die Belegschaft als beste erreichbare Garantie für die Fortführung ihres Beschäftigungsverhältnisses. In dieser Hinsicht ist sie richtig radikal: Wenn Arbeitsplätze durch Geschäftskalkulationen in Frage gestellt werden, gerät der Ruf nach ihrer Rettung ja immer zur Parteinahme für genau die Rechnungen, die die Arbeiterexistenz unsicher machen; in Herzogenaurach geht man weiter: Hier versteigt sich die ohnmächtige Hoffnung auf Fortbestand der Arbeitsplätze zu einem persönlichen Treuebekenntnis gegenüber einer Milliardärin, die ihre Leute arbeiten lässt und rauswirft, wie ihr Geschäft es braucht.
Die IG Metall hält einen solchen Aufmarsch nicht für eine anti-gewerkschaftliche Aktivität, sondern organisiert ihn mit, sammelt Unterschriften für eine Petition an Frau Merkel und tritt im Verein mit den Schaefflers als Bittsteller beim Staat auf. Ob die Regierung den Wunsch der Gewerkschaft erfüllt, steht noch nicht fest, einen Erfolg kann sie aber auf jeden Fall verbuchen.
3. Die Patriarchin gewährt Mitbestimmung, Beteiligung, Transparenz
Frau Schaeffler, bisher entschiedene Gegnerin der Gewerkschaft in ihrem Laden, hat aus ihrer Gesinnung nie einen Hehl gemacht und das Unternehmen strikt als ‚ihres‘ geführt. In ihrer Not entdeckt sie jetzt die Gewerkschaft und deren Einfluss auf die Politik als geeigneten Helfer beim Versuch, ihr Kommando über das Unternehmen durch staatliche Finanzhilfe zu retten. Sie holt die IG Metall, die sowieso will, ins Boot, und bietet ihr für ihre politische Rückendeckung eine neue ‚Transparenz‘ bezüglich der streng geheim gehaltenen Unternehmensbilanz, Mitbestimmung wie in Aktiengesellschaften sowie für später, wenn es wieder ‚aufwärts geht‘, eine Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter an. Nach diesem Handel tritt der IG Metall-Vorsitzende mit der „Chefin“ vor die Öffentlichkeit und bekräftigt mit einem doppelten Wir
seine Unterstützung für deren Anliegen:
„Die IG Metall hat ein fundamentales Interesse daran, dass die Schaefflers als entscheidende Ankerinvestoren tätig bleiben.“ (Huber, FAZ, 24.2.) „Wir sind gegen eine Zerschlagung der Schaeffler-Conti-Gruppe. Wir sind beide der festen Überzeugung, dass Bund und Länder sich bei Schaeffler engagieren sollen.“ (Huber, SZ, 24.2.)
Als Chef der Metall-Gewerkschaft nimmt er höchstpersönlich dem Antrag der Schaefflers den Ruch des bloß privaten Kapitalisteninteresses; nein, deren Interesse an der Rettung ihres Vermögens ist auch das Interesse von 66 000 Lohnabhängigen – und als solches würdig, von der Regierung in den Rang einer nationalen Standortfrage erhoben zu worden. Bertold Huber präsentiert seine IG Metall als nationale Kraft und ruft die staatstragenden Parteien, denen sie das Vertrauen der Metaller sichert, in die Pflicht: Rettet Schaeffler!
So viel Verantwortung verpflichtet. Huber, der hier deutsche Industriepolitik betreibt, anerkennt, dass eine langfristig ‚tragfähige Zukunft‘ ebenso wie die kurzfristig benötigte Staatshilfe für den frisch geschmiedeten Großkonzern nur zu gewinnen ist, wenn das Unternehmen, das sich übernommen hat, eine kräftige Sanierung in Angriff nimmt. Ihm ist klar, dass diese „Arbeitsplätze kostet“, und er stellt die Belegschaften auf das ein, was auf sie zukommt Conti kündigt harte Einschnitte an: ‚Wir reduzieren unsere Belegschaft‘.
Frau Schaeffler handelt er das Versprechen ab, auf betriebsbedingte Kündigungen möglichst verzichten zu wollen. Und er hat nichts dagegen, dass in diesem Versprechen zugleich angekündigt wird, dass man die Belegschaft auf jede andere mögliche Wiese verringern werde – ab jetzt in Absprache mit Gewerkschaft und Betriebsrat. Das mag die Dame hart ankommen, für die Gewerkschaft ist es das, was die Chefin unentwegt für sich reklamiert: ‚Verpflichtung und Verantwortung‘. Aus Verantwortung will der Chef dann auch die im Mai anstehende Tariferhöhung verschieben: Wir lieben das nicht, wenn es aber erforderlich sein sollte, werden wir das im Extremfall tun.
(Huber bei der öffentlichen Präsentation des Übereinkommens von Schaeffler und IG Metall) Neben Lohnverlust durch massenhafte Kurzarbeit steht also tariflicher Lohnaufschub an; wichtiger als Lohn ist der Gewerkschaft eben, dass die Eigen- und Fremdkapitalverhältnisse wieder in Ordnung kommen.
Frau Schaeffler hat – wenn auch nur der Not gehorchend – begriffen, wozu eine Gewerkschaft heutzutage bereit und nützlich ist; und die IG Metall zögert nicht, sich zu dieser Leistung ihrer Mitbestimmung zu bekennen: Durchs Mitbestimmen erhebt sie das Privatinteresse der Kapitalisten am Erfolg ihrer Geschäfte zum ersten und wichtigsten Interesse der von ihnen abhängigen Arbeitskräfte und damit zum nationalen Gesamtinteresse – jedenfalls so wie der Unternehmer und seine Belegschaftsvertretung es sehen. Das muss die Regierung nicht unbedingt teilen; SPD-Arbeitsminister Scholz jedenfalls sieht sich in der Schaeffler-Sache durch die Koalition von Kapital und Gewerkschaft unangenehm unter Druck gesetzt und wehrt ab: Man kann nicht im Nerzmantel nach Staatshilfe rufen
(Scholz). Oh doch, man kann – an der Seite der IG Metall schon gleich: Dafür hängt sich die elegante Milliardärin auch mal einen roten Schal um – und lässt sich vom Gewerkschaftschef an den Arm fassen. Beide gewinnen an Statur: die eine als Retterin ihres kapitalistischen Lebenswerks, der andere als verantwortlicher Vertreter der nationalen Arbeitskraft.