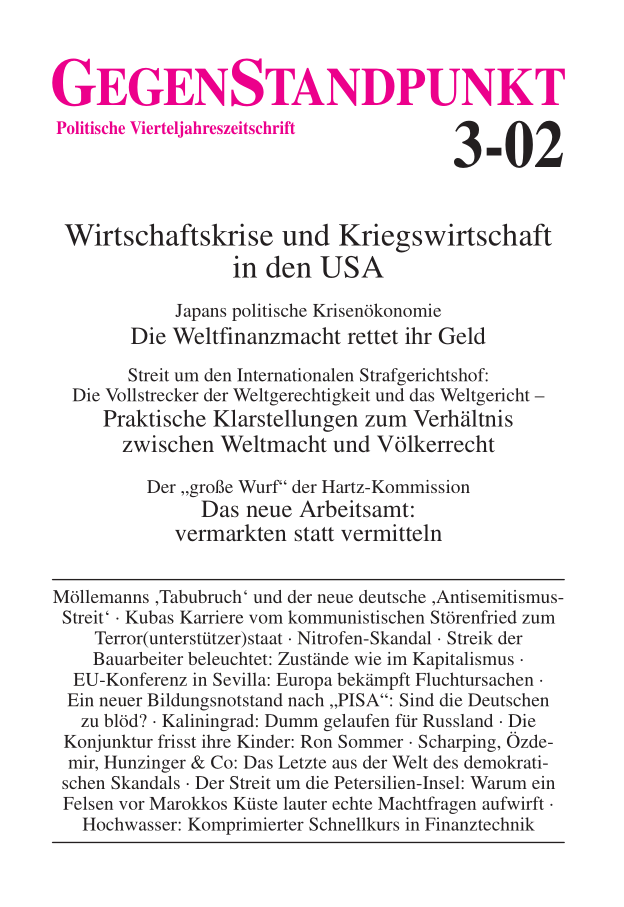Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Scharping, Özdemir, Hunzinger & Co.:
Das Letzte aus der Welt des demokratischen Skandals
Die Wahrheit der Skandale: Scharping stolpert über das nationale Leiden über den minderen Status Deutschlands als Militärmacht, der dem Minister als persönliches Versagen angekreidet wird. Özdemir fällt dem Image der Grünen als Saubermannpartei zum Opfer, die an ihm den Schein demonstrieren, dass moralische Ansprüche an ihre Politiker ohne Berechnung gelten. Gysi inszeniert seinen Rücktritt als zerknirschtes Ringen um seine persönliche Anständigkeit als Politiker, um den Glauben daran zu retten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Scharping, Özdemir, Hunzinger &
Co.:
Das Letzte aus der Welt des
demokratischen Skandals
Die größeren oder kleineren Korruptionsaffären und sonstigen zweifelhaften Machenschaften, die laufend in den politischen Chefetagen der Republik anfallen, sind den Vertretern der „vierten Gewalt“, der demokratischen Öffentlichkeit, ohne die die Skandalisierung solcher Ereignisse gar nicht stattfände, stets Anlass, mit besonderem Eifer ihrer staatstragenden Aufgabe nachzugehen: die Tätigkeit der Politiker nach deren eigenen Maßstäben der Überparteilichkeit und Rechtmäßigkeit zu prüfen, um Art und Umfang aufgeflogener Pflichtverletzungen darzulegen und im Zuge des üblichen ideellen Normenkontrollverfahrens zu beurteilen. Dabei werden sie gerne ein wenig nostalgisch und wollen bemerkt haben, dass
„die alte Generalklausel ‚So etwas tut man nicht‘ keine Substanz mehr hat. Der Maßstab dafür, was man nicht tut, ist verloren gegangen…“ (SZ, 29.7.02)
Entgegen der Tendenz solch kulturpessimistischer „Feststellungen“, die ohnehin nur als Mahnung zu „alten“ Tugenden gemeint sind, hat deren Einforderung wie ihre praktische Verletzung schon immer zum üblichen Geschäft des demokratischen Regierens gehört. Das weiß eigentlich auch jeder, und das wird allein schon durch die einschlägigen Verbots- und Strafvorschriften in Strafgesetzbüchern, Parteien- und Abgeordnetengesetzen oder der Geschäftsordnung des Bundestages liebevoll illustriert. Nicht weniger traditionsreich ist es aber, bei der moralischen Beurteilung öffentlich gewordener Verstöße des Herrschaftspersonals, ja schon bei deren Ermittlung die Erfolgsbilanz des betreffenden Amtsinhabers zwanglos einfließen zu lassen. Die kann bei der Abwägung von nationalen Verdiensten und Verstoß letzteren in milderem Licht erscheinen lassen, gelegentlich sogar solch praktische Wucht entfalten, dass sich bei einem bestimmten Umfang der Machtfülle gleich gar niemand mehr findet, der sich mit deren Inhaber anlegen, ihm glaubhaft Verstöße gegen das Wohl der Nation vorwerfen oder solche bezeugen möchte. Franz-Josef Strauß als erster Nachkriegs-Prototyp dieser Machart, oder Helmut Kohl, sein kongenialer Nachfahre, haben sich so lange in ihren Ämtern gehalten und allein damit schon den Beweis ihrer Erfolgstüchtigkeit geführt, dass die Aufdeckung ganzer Serien von Skandalen in ihrer Amtszeit ihnen nicht viel anhaben und die Zahl ihrer Bewunderer kaum reduzieren konnte. Umgekehrt haben Skandale schon immer nur solche öffentliche Figuren das Amt gekostet, die nach allgemeiner Einschätzung den im Amt fälligen Erfolg schuldig geblieben sind.
*
Im „Fall“ des entlassenen Verteidigungsministers Scharping sind insofern nur wenige – skandaltechnisch gesehen – neue Nuancen im politischen Leben der Republik zu konstatieren: Hier hat sich die Erfolglosigkeit einer Politikerfigur ihren längst fälligen, endlich für den Abgang ausreichenden Skandal gesucht und ihn unter tätiger Mithilfe diverser Journalisten, Datenklauer, „Kontaktmakler“ und sonstiger PR-Schaffender irgendwann doch noch zielsicher gefunden. Dabei ist die Inszenierung des inkriminierten Verhaltens als Rücktrittsgrund und seiner Aufdeckung allseits gewusst, wird öffentlich besprochen, tritt aber so hinter ihr allgemein begrüßtes Resultat – den Rücktritt des längst für „unmöglich“ gehaltenen Ministers – zurück, dass sie selbst gar nichts Skandalöses mehr an sich hat. Scharping als akutes Musterbeispiel eines erfolglosen, unhaltbar gewordenen und für den Kanzler nur mehr blamablen und belastenden Regierungsmitgliedes ist einfach überfällig.
Das soll nicht heißen, dass man dem Verteidigungsminister Scharping eine Vernachlässigung seiner Pflichten bei der politischen Verwaltung der deutschen Kriegsmaschinerie und ihrer laufenden Umrüstung für die Bedürfnisse der neuen postsowjetischen Weltlage ernsthaft vorhalten könnte. Im Rahmen der neuen Weltordnung und der ihm im Haushalt zugeteilten Mittel wird er schon das Nötige für den „Umbau der Bundeswehr“ getan haben: Von einer wichtigen Bündnisarmee an der prospektiven Front eines großen antikommunistischen Landkrieges soll sie zu einer Truppe für „neue Aufgaben“ werden; für Aufgaben, die sich entweder – auf die Tagesordnung gesetzt von den USA und unter deren Führung – immer erst von Fall zu Fall „ihre Bündnisse suchen“ oder erst noch darauf warten, von Europas ehrgeizigen Imperialisten entdeckt, d.h. definiert und einer „Lösung“ zugeführt zu werden. Aber: Die ganze nationalistische Unzufriedenheit mit der am Thema des kriegerischen Vermögens immer wieder schmerzhaft demonstrierten Drittklassigkeit des deutschen Imperialismus; das Leiden an der unverhüllten Verachtung der Amerikaner für die deutschen „Fähigkeiten“ auf dem Balkan oder in Afghanistan und an dem mit alledem verbundenen Rangverlust in der Hierarchie der imperialistischen Weltordner; der ganze Unwille über die demütigende Inferiorität der deutschen Machtmittel in einer Weltlage, in der für die Rangliste der Nationen die Militärgewalt mehr zählt denn je: Dieser gesammelte Unmut über die Lage richtet sich aus der Truppe selbst wie aus der Öffentlichkeit, der Opposition und auch aus den Regierungsparteien gegen den politischen Verwalter dieser, an den nationalen Ansprüchen gemessen, so unzulänglichen Militärmacht. Die Unzufriedenheit findet in ihm die Figur, der man die Lage als politisches Versagen ankreidet und zu deren Lasten man das politische Versagen mit seinem moralischen Grund ausstattet: Scharping ist schuld. Und das nicht nur an der „chronischen Unterfinanzierung“ der Bundeswehr oder an den Kompetenzstreitigkeiten mit dem Parlament bei der Beschaffung neuer Transportflugzeuge oder Panzer. Die ihm zur Last gelegte politische Unfähigkeit entdeckt man an ihm konsequent gleich noch als ganz persönliche Unzulänglichkeit. Er macht angeblich eine rundum so katastrophale Figur, dass er als politischer Führer kaum mehr auszuhalten sein soll: Er beschließt, sein „Image“ neu gestalten zu lassen, und „kommuniziert“ dafür ohne Gespür für Peinlichkeit die „menschliche Seite“ des Politikers Scharping, die er mit bestellten Illustriertenfotos seines privaten neuen Liebesglücks bebildern lässt; fliegt, während geschossen wird, nicht zu „seinen“ Soldaten, sondern – mit Bundeswehrflieger – zu seiner Tussi in Urlaub; gleicht das durch besonders markige Erklärungen zu aktuellen Krisen wieder aus, und muss sich von amerikanischen Dementis mehrfach als ahnungsloser Schwätzer hinstellen lassen. Kurzum: Scharping habe, so lautet der Vorwurf, ein Bild von seiner Person, die für die deutsche Militärpolitik steht, entstehen lassen, das ihn als lächerlichen Hanswurst in einem „Schlüsselressort“ der mit schlechten Umfragewerten kämpfenden Regierung erscheinen lässt. Damit kontaminiert er auch das Bild dieser Politik und des für sie oberzuständigen Kanzlers.
Wer einer Armee vorsteht, die innerhalb weniger Jahre vom
wichtigsten Vorposten an der Grenze zum Feind und
„partner in leadership“ zum verzichtbaren Laufburschen
der Supermacht herabgestuft wird, und es dabei nicht
schafft, der Nation eine neue und glaubhafte
Machtperspektive aufzuzeigen, der muss erleben, dass der
demokratische Personenkult gegen ihn ausschlägt:
Statt bedeutend zu sein, strengt
sich
Scharping nur – vergeblich – an
, so zu erscheinen;
verkrampft
dabei so sehr, dass er nicht einmal
mehr gehen, sondern nur mehr stolzieren
kann;
merkt das alles noch nicht einmal und wird dabei zur
tragikomischen
Figur, an der sich z.B. die
Glossenschreiber des SZ-„Streiflichts“ mit der Perfidie
und der Respektlosigkeit delektieren, die dem
enttäuschten Wunsch des demokratischen Gemüts nach
überzeugender Führung entspringt und dem Wissen, es mit
einer zum politischen Abschuss freigegebenen Gestalt zu
tun zu haben.
Wem so penetrant der Geruch des Scheiterns anhängt, mit
dem sind seine „politischen Freunde“ dann auch irgendwann
endgültig „fertig“: Ein paar zehntausend Mark
Vorauszahlung für ein „Buchprojekt“ von einem angeblich
„dubiosen“ Lobby-Aktivisten, ein paar Vortragshonorare
und ein dicker Packen ministrabler Anzüge, bezahlt von
demselben professionellen Kontaktvermittler, sind, ohne
dass die Vorschriftswidrigkeit dieser
Geschäftsbeziehungen schon feststünde, der Anlass,
Scharping als einer die Wahlaussichten der SPD
belastenden Figur ein jähes Ende auf dem politischen
Schafott
zu bescheren, die SPD aufatmen
(SZ, 19. und 20./21.7.02) und
den Kanzler Tat- und Entschlusskraft beweisen zu lassen.
*
Wo Scharpings Abgang noch den alten Kriterien der demokratischen Karrierekultur gehorcht – Erfolg macht unverwundbar, Misserfolg ist tödlich – und nur durch das unbekümmerte Besprechen der Methode während ihrer Anwendung auffällt, gibt der Rücktritt des Grünen-Abgeordneten Cem Özdemir, des wahrscheinlich bestassimilierten Deutschtürken der Welt, kleine Rätsel auf: Er hatte Kontakte zu Hunzinger, zu dem viele seiner Kollegen Kontakte haben und der seinerseits eben dies, Kontakte zu haben, als sein legales „PR“-Gewerbe betreibt. Er hat sich von ihm einen – ebenfalls ganz legalen – Darlehens-Gefallen erweisen lassen und hat darüber hinaus, umtriebiger, immer im Dienst befindlicher Vielflieger, der er ist, ein paar Mal nicht bemerken wollen, wo seine höchstwichtige Abgeordnetenpersönlichkeit aufhört und seine Privatheit anfängt und ist deshalb mit dienstlichen Bonusmeilen über diese Grenze hinweggejettet. Das wird, einerseits wegen der überparteilichen Verbreitung dieser Praxis, andererseits wegen deren unklarer rechtlicher Fassung als nur „freiwillige Selbstverpflichtung“, von den meisten Politiker-Kollegen und Medien, mit Ausnahme der wahlkämpferisch-investigativen Bild-Zeitung natürlich, als eher „lässliche Sünde“ betrachtet.
Özdemir hat seine Aufgabe, an seinem Platz, als
Parlamentarier einer kleinen, aber immerhin
Regierungspartei, seinen Beitrag zur Förderung des
politischen und geschäftlichen Erfolges der Nation zu
leisten und dabei unparteiisch gegenüber
konkurrierenden Einzelinteressen zu bleiben, nach
übereinstimmender Auffassung nahezu aller Beobachter sehr
ernst genommen. Als innenpolitischer Sprecher seiner
Fraktion hat er eine herausgehobene Stellung inne und
bemüht sich auch sonst erfolgreich darum, als grüne
Führungsfigur wahrgenommen zu werden. Dabei wirkt er
pflichtgemäß auch mit der Geschäftswelt zusammen, die
umgekehrt auch an Leuten wie ihm interessiert ist: sind
diese doch entweder als Mitentscheider oder zumindest als
Transporteure von Wünschen aus „der Wirtschaft“ an die
„richtigen Stellen“ bedeutend. Bekannt und erlaubt ist
es, dass Wirtschaftsleute oder von ihnen teuer bezahlte
Hunzingers ihre Kontakte zur Politik pflegen und die
Politiker, die sie immer wieder brauchen, mit Spenden und
allerlei Aufmerksamkeiten bei Laune halten (lassen).
Ebenfalls bekannt, aber streng verboten ist es dagegen,
dass in dieser Zone des gedeihlichen Zusammenwirkens
zwischen Reichen und Mächtigen die ersteren manchmal
dafür sorgen, dass die zweiteren ganz persönlich auch ein
wenig reich werden und nicht immer „nur“ mächtig sein
müssen, wenn sie ihre Macht richtig einsetzen. Und die
schwierige Abgrenzung eines verbotenerweise politisch
geförderten Eigennutzes vom pflichtgemäßen
Voranbringen des staatlichen Gemeinnutzens, der
ja wiederum nur durch die Entscheidung zu Gunsten von
Einzelinteressen verwirklicht wird, macht gerade das
„Graue“ an dieser ominösen Zone der Kooperation zwischen
Politik und Kapital aus. Aber: Dass der schwäbische
Özdemir sich korrupt im Rechtssinne verhalten habe, sich
also irgendeine Entscheidung oder Einflussnahme habe
abkaufen lassen, wirft ihm niemand vor, auch wenn sein
Darlehensverhältnis zu Hunzinger, der immer betont, dass
es in der Welt der Netzwerke auf die Dauer keine
Leistung ohne Gegenleistung gibt
(Der Spiegel, 30/02), ein
moralisches „Gschmäckle“ haben soll.
Wieso lassen also die Grünen so kurz vor der Wahl eine
ihrer Erfolgsfiguren, einen der grünen Politstars
(Der Spiegel, 32/02), einen
aus ihren – zumindest dem Bekanntheitsgrad nach – Top
Ten, so locker über die Klinge springen, hängen die
Affäre zu hoch
und setzen Özdemir erkennbar unter
Druck
, obwohl er sich nur eine politische
Eselei
(SZ, 23.7.02)
geleistet hat, ohne sich ernsthaft etwas zuschulden
kommen zu lassen?
Kurzzeitig wird ein doppelter Verdacht ventiliert: War
der smarte
Abgeordnete manchen Parteikreisen
vielleicht ein wenig zu smart? Hat er sich
vielleicht ein wenig zu sehr in den Vordergrund gespielt,
so dass parteiinterne Konkurrenz begonnen hatte, an
seinem Stuhl zu sägen, sein Erfolg als
Multikulti-Star der Grünen sich also schon dem Ende
zuneigte? Oder wissen die Grünen etwas Schlimmes von Cem
Özdemir, das noch niemand sonst weiß? Die Schnüffelei der
Medien bleibt zunächst ohne Ergebnis, so dass es ganz
danach aussieht, als hätten die Grünen, ganz im Sinne der
Logik demokratischer Skandale und ihrer Bewältigung,
mitten im Umfragetief für Rot-Grün am Fall Özdemir eine
etwas verzweifelte Methode des Wahlkampfes exekutiert:
Sie beweisen ihre haushohe Überlegenheit über die
Konkurrenz in politischen Anstandsfragen dadurch, dass
sie ihre politmoralischen Maßstäbe eben nicht am
Erfolg einer auffällig gewordenen Figur relativieren und
hoffen, dass das von einem Teil der Wählerschaft
honoriert wird. Umgekehrt lässt sich die Botschaft ans
Wahlvolk auch noch zu Gunsten der Grünen lesen: Wie
erfolgssicher muss eine Partei sein, die sich so kurz vor
der Abstimmung solchen moralischen Rigorismus gegenüber
einem wichtigen Funktionsträger leistet! So verhalten sie
sich wie die Bewohner einer belagerten Stadt, die, obwohl
vom Hunger bedroht, ein fettes Rindvieh über die Mauer
werfen, um den Belagerern mit ihrer blendenden Lage
Eindruck zu machen. Die Grünen wollen eben erfolgreich
und moralisch blitzsauber wirken, und haben
offenbar versucht, diese Wirkung am „Fall Özdemir“ zu
erzielen.
Dass sich das nicht beliebig oft wiederholen lässt, weil einem sonst die fetten Rindviecher wirklich ausgehen, zeigt sich spätestens, als auch der Fraktionsvorsitzende Schlauch seine Bonusmeilensünden beichten muss und die Regierungsmitglieder Trittin und Vollmer desselben Vergehens beschuldigt werden. Da wird dann doch ziemlich schnell unter Verweis auf die mindere Wichtigkeit der Verfehlung nachgezahlt und zur Tagesordnung übergegangen oder einfach dementiert.
*
Wo es den Grünen auf die moralische Überlegenheit ihrer
Partei über die Konkurrenz ankommt, nimmt Gregor
Gysi, der Berliner PDS-Wirtschaftssenator, die
Herausforderung ganz persönlich an. Er ist
nämlich auch mit dienstlichen Bonusmeilen durch die Welt
gedüst und hebt eilig den Finger zur Selbstanzeige: An
moralischer Sauberkeit lässt sich eine
demokratisch-sozialistische Persönlichkeit wie Gysi
einfach von niemandem übertreffen. Er hat ja in jüngster
Zeit, vor allem seit der Übernahme des Senatorenamtes für
Berlinischen Kapitalismus, einiges durchgemacht: Er hat
es übernommen, die weitere haushälterische
Reichtums-Umverteilung in Berlin von unten nach oben, zu
Gunsten der Wiederbelebung des totspekulierten örtlichen
Finanzkapitals, mit sozialistischer Tatkraft anzupacken;
hat seine Partei und die Berliner auf die
Alternativlosigkeit von Entlassungen im
öffentlichen Dienst und weiterer Verarmung auch aus
sozialistischer Sicht eingeschworen; und er hat sich
dabei weiterhin als Anwalt der Benachteiligten im Osten,
genauer: als Anwalt der nationalen
Integration der benachteiligten Ossis ins
gesamtberlinische und gesamtdeutsche Gemeinwesen, zur
Verfügung gehalten. Aber bei aller Belastung: Die Praxis
einer klassenstaatlichen Haushaltsführung, die
wirtschaftspolitische Betreuung des Kapitalerfolges am
Standort Berlin und die ideologische Agitation dafür, was
eben das Amt des Wirtschaftssenators so mit sich bringt,
das, so teilt Gysi bei der Erklärung seines Rücktrittes
der Presse mit, sei eine schöne
und
interessante Aufgabe
gewesen, bei der er gerne
Erfolg gehabt
, aber auch schon einiges auf den Weg
gebracht
und mit der er einigen Ehrgeiz
(n-tv, 2.8.) verbunden habe.
Die Aufgaben seines neuen Amtes haben in ihm
offenbar keine Befürchtungen aufkommen lassen, er
werde so, wie ich nie werden wollte.
Womit er aber
nicht so gut umgehen könne
, das sei, dass er
begonnen habe, Privilegien als Selbstverständlichkeit
hinzunehmen
, eben der leidige Fehler
mit den
Bonusmeilen, den er sich nicht verzeihen wolle.
Wo
Gysi der Mehrzahl der Berliner allen Anlass gibt, seine
Maßnahmen als Wirtschaftssenator zu fürchten, da beginnt
der Senator in seiner moralisch sensiblen Art plötzlich,
sich selbst zu fürchten: Er fürchte sich vor seinen
eigenen Persönlichkeitsveränderungen
(SZ, 1.8.). Nun sind sie ihn los, seine
Wähler, von denen er sich entfernt
(SZ, ebd.) hat. Und ob sie je wieder
einen Wirtschaftssenator bekommen, der so skrupulös an
ihrer Verarmung mitwirkt, ist fraglich.
Die Grünen sehen ihre eigene Aktion mit Özdemir durch
Gysis Knaller entwertet und spucken Gift und Galle:
Gysi bringe sich in eine Märtyrerrolle, die ihm nicht
zustehe
(SZ, ebd.),
vermeldet die grüne Fraktionschefin Klotz; und CDU und
FDP wollen das ganze Moralgetue des PDSlers gleich gar
nicht gelten lassen: Der habe „es“ nicht gekonnt, dann
eben keine Lust mehr gehabt und deswegen einfach
politische Fahnenflucht
(Der
Spiegel 32/02) begangen. Das mit dem „Können“ muss
bezweifelt werden: Schließlich kann man nachweislich mit
dem Intellekt eines Staubsaugers nicht nur eine Stadt,
sondern eine komplette deutsche Kulturnation oder gleich
eine ganze Weltmacht regieren. Der
demokratisch-sachverständige „Schluss“ vom Rücktritt auf
Erfolglosigkeit im Amt greift aber auch hier – und
alternativ die Gehässigkeit der alten Stasi-Vorwürfe,
denen Gysi sich habe entziehen wollen. Dabei ist es ja
vielleicht wirklich so, dass Gysi einfach keine
Lust mehr hatte, auf die Dauer einen kaputten
kapitalistischen Stadthaushalt mitzuverwalten. Es steht
durchaus zu befürchten, dass die aufwändige
psychohygienisch-moralische Begründung seines Rücktritts
gar nicht, wie ihm vorgeworfen wird, geheuchelt, sondern
ehrlich war: Bei Leuten wie Gysi kommt es eben
auch noch inmitten der härtesten „Sparaktionen“ zu Lasten
anderer Leute entscheidend darauf an, wie man sich dabei
fühlt.
*
Durch die gezielten Wahlkampfaktivitäten der Bild-Zeitung
gegen rot-grüne „Freiflugsünder“ zieht sich die
Meilen-Chose in die Länge und entgleist dadurch ein
wenig. Sie bekommt in moralischer Hinsicht ein Gewicht,
das den altgedienten Kommentatoren millionenschwerer
Parteispenden-Tricks, Vermächtnis-Lügen,
Landesbank-Schiebungen etc. unter der Regie von Kohl,
Koch, Stoiber oder der NRW-SPD irgendwie als unangemessen
erscheint. Die Sorge um die politische Kultur
des
Landes, der „die künstliche Skandalisierung
mehr schadet als das Fehlverhalten“, weil der
Grundton der Häme zu einem regelrechten Feindbild
Politiker geführt
habe (Bundesratspräsident Thierse im
Spiegel-Interview, 32/02), lässt den
verantwortungsbewussteren Teil der Medienmannschaft nach
einigen Tagen die ideell staatsschützerischen
Verteidigungsstellungen beziehen: Allen voran glaubt H.
Prantl von der SZ, der, weil gelernter Jurist, den
Vergleich politischen Handelns mit dem dafür
einschlägigen Gesetz für Kritik hält und sich mit dieser
Methode der blitzsauber subsumierenden Sorge um das
Gemeinwesen den Ruf eines profilierten Kritikers erworben
hat, es sei nun Zeit für eine Verteidigung der Politik
gegen ihre Verächter. Die Politik ist besser als ihr
Ruf.
(SZ, 29.7.02) Und
nachdem er den Fleiß der Politiker nicht genug
rühmen kann (ackern rund um die Uhr
), andererseits
doch eine gewisse moralische Verschlampung der
politischen Sitten beklagt, nimmt er die Politiker vor
der hysterischen Heuchelei
ihrer Wähler in Schutz.
Ihnen schreibt er, frei nach dem berühmten Gernhardtschen
Diktum, die größten Kritiker der Elche seien in der Regel
selber welche, ins Stammbuch, sie verlangten von den
Politikern das Unmögliche, nämlich stellvertretend für
sie moralisch
zu sein:
„Das ist bequem: Die Ansprüche, die man selber zu erfüllen nicht in der Lage ist, sollen die Politiker einhalten… Im Übrigen hilft es bei der Beurteilung der Politik, wenn jeder Wähler den bekannten Kennedy-Satz selbstkritisch umwandelt, also: ‚ich bin ein Politiker‘- und den Satz auf sich selbst anwendet.“ (SZ, ebd.)
So etwas gefällt natürlich den in Schutz genommenen
Politikern, weshalb sie sich unter Führung des
Bundestagspräsidenten der Kritik an ihren Kritikern gerne
anschließen: Überhaupt ist es unlauter, von Politikern
zu verlangen, sie sollten so ganz anders sein als die
Mitglieder dieser Gesellschaft – Heilige am liebsten,
…
(Der Spiegel, 32/02);
deshalb solle die Gesellschaft an Politiker nicht
andere Maßstäbe anlegen als an sich selbst.
(SZ,5.8.02)
Das sitzt: Bevor man seine Obrigkeit kritisiert, soll man sich als Wähler, oder als „Gesellschaft“, erst einmal selber anständig benehmen. Und wenn man das nicht fertig bringt, sollte man lieber die Schnauze halten. So lebensnah und pragmatisch kann Kritik in der Demokratie sein. Wenn man schon dem regierenden Personal seine berufsbedingte Charakterlosigkeit und die Neigung zur Bereicherung im Amt nicht austreiben kann, dann sollten die anfallenden Skandale wenigstens dem Volk Anlass sein, moralisch an sich zu arbeiten. Dafür könnte es dann – im Erfolgsfall – mit einem einwandfreien Recht zur Kritik bedacht werden!
*
Neben dieser kleinen Lektion in demokratischer
Antikritik am Stoff der aktuellen Affäre widmen
sich bald alle verantwortlichen Organe der
Öffentlichkeit, Unterstützer wie Gegner des
Regierungslagers, unter strikter Beachtung der
Logik des Skandals der abschließenden und
nutzbringenden Verwendung des Falles für den Fortgang der
Parteienkonkurrenz. Dazu werfen alle, einschließlich der
Bild-Zeitung, die die Angelegenheit wochenlang am Köcheln
gehalten hat, die Frage auf, ob wir denn keine anderen
Sorgen
hätten, als diesen Bonusmeilen-Kleinkram,
wir alle
, im Angesicht von Arbeitslosigkeit,
Wirtschaftskrise und Kriegsgefahr!
Dabei spekulieren die Sympathisanten der Regierung
darauf, mit dem Herbeizitieren der anerkannten
Menschheitsgeißeln dem Vorwurf der moralisch-rechtlichen
Verfehlung gegen Rot-Grün die Spitze zu nehmen und das
Publikum auf das zweite Prüfkriterium für gutes
Regieren verweisen zu können: den Erfolg
bei der sachlichen Bewältigung der Drangsale
der Nation. Da, so meinen die der
Regierung eher Wohlgesonnenen, könnten Schröder und die
Seinen doch etwas vorweisen, was dem Vergleich mit der
Opposition standhalten und den Verdruss über die
Skandalgeschichten relativieren könnte. Die Feinde der
Regierung fordern die Rückkehr zu den Sachthemen
aus genau dem gleichen Grund, nur mit der
entgegengesetzten Berechnung: sie setzen darauf, der
moralischen Beschädigung der Koalition in den
Augen der Wähler, auf die es bei der Inszenierung des
Skandals ankam, die Blamage durch das Deuten auf
die Erfolglosigkeit bei der Bewältigung aller
Probleme
der Nation hinzu zu fügen.
„Andere Sorgen“ haben Demokraten im
Wahlkampf tatsächlich nicht.