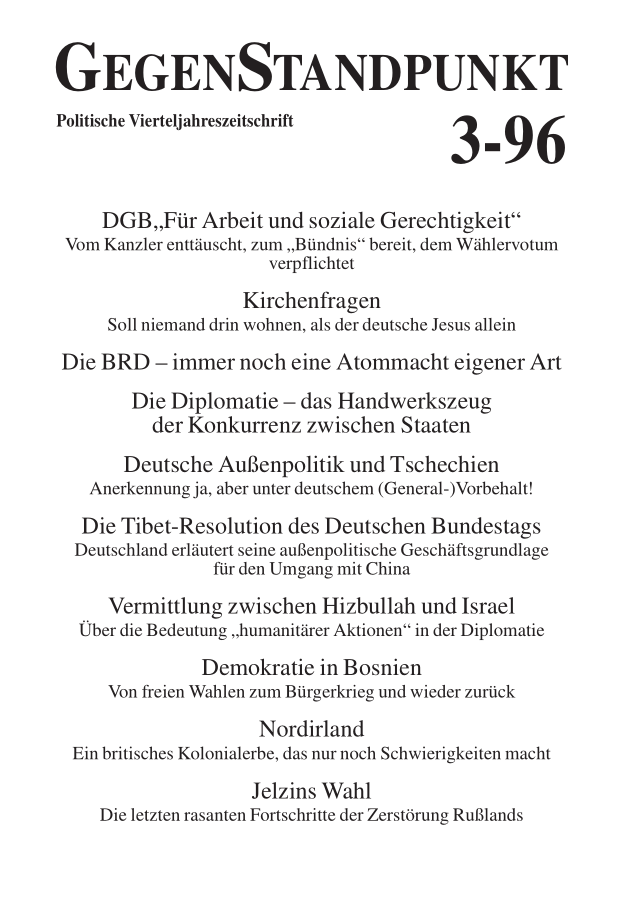DGB-Demonstration „Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ in Bonn
Vom Kanzler enttäuscht, zum „Bündnis“ bereit, dem Wählervotum verpflichtet
Im „Bündnis für Arbeit“ hat sich der DGB verpflichtet, für „Arbeitsplätze“ die Rentabilität der Arbeit durch niedrige Lohnabschlüsse zu erhöhen. Die Leistung der Gegenseite – Arbeitsplätze – bleibt aus, woraufhin sich die Gewerkschaften genötigt sehen, zur Rettung des guten Anliegens „Standortsicherung“ zu demonstrieren und dem Kanzler ausgerechnet mit dem Entzug von Wählerstimmen zu drohen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Länder & Abkommen
DGB-Demonstration „Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ in Bonn
Vom Kanzler enttäuscht, zum „Bündnis“ bereit, dem Wählervotum verpflichtet
Ein demokratischer Dialog:
„Es imponiert mir gar nicht, wenn ich weiß, wieviele Leute zum Demonstrieren nach Bonn kommen“. Der Kanzler.
„Wer diese Versammlung abqualifiziert, beleidigt seinen eigenen Wählerstamm“. Die Gewerkschaft.
Der Kanzler braucht auch gar nicht zu wissen, daß da am 15. Juni 1996 in Bonn bei der „größten Demo der Nachkriegsgeschichte“ 350000 Leute zusammengekommen sind. Er braucht sich auch keine Sorgen darüber zu machen, daß da gewerkschaftlich organisierte Lohnarbeiter unterwegs sind: Leute, aus deren alltäglicher Arbeitsleistung die in Bonn beheimatete Regierung die materiellen Grundlagen für die Ausübung der Staatsmacht bezieht; die somit in ihrer Abhängigkeit durchaus über Mittel verfügen, das regierungsamtliche Programm des Sparens an tariflichen Löhnen und sozialstaatlichem Lohnersatz in einer Weise abzulehnen, die dem Kanzler imponieren würde. Der sieht aber zu Sorgen um den ungeschmälerten Bestand seiner Macht einfach keinen Anlaß. Er gibt sich demonstrativ und provokant unbeeindruckt, ein Musterbild von Arroganz der Macht. Das kann er sich risikolos leisten und weiß das auch: Er kennt seine Pappenheimer.
Wie richtig er liegt, zeigt die Reaktion der Gewerkschaft. Die droht mit den von ihr mobilisierten Mitgliedern – aber gar nicht als Arbeitern, die sich eine Schädigung ihrer Interessen nicht gefallen lassen und ihre Macht dagegen setzen, sondern als politisierten Staatsbürgern. Sie bringt ihre Demonstranten als Wähler ins Spiel und damit als Leute, die zu ihrer eigenen materiellen Lage einen regierungsamtlichen Standpunkt einnehmen und bloß mitentscheiden möchten, wem sie sich und ihre Sorgen überantworten sollen – Wähler schauen nämlich als von der Politik Betroffene „von unten“ darauf, was die Zuständigen „da oben“ ihnen an Maßnahmen und Alternativen auftischen, sortieren danach ihre politischen Vorlieben und begnügen sich damit, sich mit einem bescheidenen Wahlkreuz in den Gang der Dinge einzumischen. Daß jetzt Kohls Wähler sich einem anderen Kohl anvertrauen könnten, davor warnt der DGB den Adressaten seines Auflaufs in Bonn mit dem Hinweis auf dessen „eigenen Wählerstamm“; so kriegt man nebenbei auch noch mitgeteilt, daß der Kanzler in den Reihen derer, die gerade gegen ihn demonstrieren, viele Anhänger hat.
Eine Demo aus Enttäuschung über einen „Kanzler gegen Arbeit und soziale Gerechtigkeit“
Die Betroffenheit des DGB über den Kanzler, der ihre Versammlung „abqualifiziert“ und der seine eigenen Wähler „beleidigt“, setzt die Enttäuschung über ‚die da oben in Bonn‘ fort, die die Gewerkschaft nach eigenem Bekunden überhaupt erst zum Protest gezwungen hat. Die Enttäuschung bezieht sich auf eine Hoffnung, die sie einerseits immer schon hegt, deren aktuelles Aufflackern sie andererseits genau zu datieren weiß: auf den 23. Januar 1996. An diesem Tage verabredeten die Bundesregierung, die Spitzenvertreter der deutschen Unternehmerverbände und die Gewerkschaftsführung ein „Bündnis für Arbeit und zur Standortsicherung“.[1] Nach Auffassung des DGB bekannte sich die Regierung damit zu der Verantwortung, die die Gewerkschaft mit ihrem Werben für ein „Bündnis für Arbeit“ monatelang von den Zuständigen händeringend eingeklagt hatte: Sie erklärte die Schaffung von Arbeitsplätzen zur „Chefsache“ und wies den Gewerkschaften und der Wirtschaft die Aufgabe zu, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten der „Beschäftigungssicherung“ als neuem nationalem Gemeinschaftswerk zu Diensten zu sein. So sah der DGB sich endlich in einen streng überparteilichen „Gesellschaftsvertrag“ einbezogen, wie er ihn schon längst gefordert hatte: Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit
.
Daß alle Beteiligten diese hohen Ziele ganz gegensätzlich interpretieren, der ganze Pakt also nichts wert ist, hat sich schnell herausgestellt und die deutschen Gewerkschaften ganz traurig und im Rahmen ihrer Möglichkeiten wütend gemacht. Aber was sind das auch für Forderungen!
„Für Arbeit…“
einzutreten und dies zum Zielpunkt gewerkschaftlichen Forderns zu erklären, das ist nicht einmal eine defensive Art, die Lohninteressen der arbeitenden Klasse zu vertreten, sondern bloß noch eine proletarische Abhängigkeitserklärung. Die Gewerkschaft möchte Beschäftigung überhaupt aushandeln, pocht also bei den zuständigen Instanzen darauf, daß Arbeitskräfte angewendet werden mögen – und erklärt damit genau das zur vernachlässigenswerten Nebensache, was für auf Arbeit angewiesene Menschen einfach nicht zu vernachlässigen ist: wie und mit welchem Lohn ihre Anwendung stattfindet. Und sie will etwas aushandeln, also in Vertragsform bzw. in eine vertragsähnliche „Bündnis“-Form bringen, den „Umfang“ von „Beschäftigung“ nämlich oder sogar genaue Beschäftigten-Ziffern, was sich in der Marktwirtschaft von Haus aus gar nicht aushandeln und festlegen läßt. Denn die Grundlage für Beschäftigung – die Gewerkschaft weiß und respektiert das – heißt Kapital, und das befindet sich in der Verfügungsgewalt der Privateigentümer an den Produktionsmitteln. Die Entscheidung, wo wieviele Arbeitskräfte zur Anwendung gelangen, ob entlassen oder neu eingestellt wird, fällt demgemäß ganz in deren freies Eigentümerrecht. Wir können keine Arbeitsplätze gründen
, bekennt der DGB-Vorsitzende Schulte selber.
Für Arbeitsplätze kann die Gewerkschaft also eingestandenermaßen nichts tun, sondern nur an Arbeitgeber und Politiker appellieren, die möchten doch bitteschön einen Bedarf an Arbeitskräften entwickeln. Das unterscheidet eben der Ruf nach „Arbeit!“ von der vertraglichen Aushandlung von Lohn und Arbeitszeit: Soweit die „Arbeitgeber“ ihre „Arbeitnehmer“ brauchen, sind sie auch – wie beschränkt und bedingt auch immer – unter Druck zu setzen und auf Gegenleistungen für die verlangte Arbeit festzulegen. Von solchem Druck wollen die Gewerkschaften freilich selber nichts mehr wissen, wenn sie das Gesuch um Arbeit zur ersten und Hauptforderung erheben. Indem sie die Bedingung einklagen, unter der sie überhaupt erst eine Verhandlungsposition haben, erklären sie sich für außerstande, in Sachen Lohnsteigerung und Arbeitszeitverkürzung etwas zu bewirken, was diesen Namen verdient.
Und nicht nur das: „Zurückhaltung“ in diesen Fragen halten die Mitgliedsvereine des DGB für ihre sittliche Pflicht – der vielen Arbeitslosen wegen, die von besseren Arbeitsbedingungen ja gar nichts hätten; denen solche Verbesserungen womöglich sogar schaden, weil sie dann erst recht gar nicht erst zu irgendeiner Arbeit herangezogen werden… In tiefer Verantwortung für „das Beschäftigungsproblem“ unterwerfen sich die Gewerkschaften dem kapitalistischen Verfahren, die Arbeitslosen, die die Unternehmen selber geschaffen haben, als Druckmittel gegen Lohnansprüche zu benutzen: Daß die Existenz einer industriellen Reservearmee zu Lohnsenkung und Leistungssteigerung zwingt, erkennen sie als Sachzwang an; und daß der nicht zu korrigieren ist, nehmen sie nicht etwa als schlagendes Argument gegen das System der abhängigen Arbeit, in dem die wachsende Armut der Arbeitslosen der gute Grund für die Verarmung der in Arbeit Stehenden sein soll, so daß sich das Proletariat drinnen wie draußen kontinuierlich schlechter stellt, sondern als Selbstverständlichkeit, um die gerade sie als Interessenvertretung aller Arbeitsleute nicht herumkommen. Die in jeder Hinsicht widrige Bedingung für das Auskommen des Lohnarbeiters, den nach Unternehmerbedarf beschaffenen oder abgeschafften Arbeitsplatz, macht das gewerkschaftliche Drängen auf „Arbeit!“ zum positiven Interesse der Arbeiter, die im DGB ihren Interessenvertreter haben.
Damit hat sich der Arbeiterverein die Standort-Logik der deutschen Wirtschaft voll angeeignet und dem standortpolitischen Befund der Regierung angeschlossen: Tariflich ausgehandelte Löhne, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen sind Hindernisse „für Arbeit“, die rentabel sein muß, und ebensoviele Hindernisse für das Interesse des Staates, über einen „attraktiven“, d.h. wettbewerbsfähigen Kapital-Standort zu gebieten. ‚Lieber ärmer als arbeitslos‘: Auf diese ebenso trostlose wie verkehrte Berechnung, mit einer Alternative nämlich, die überhaupt nicht zur Verfügung steht, kürzt sich der gewerkschaftliche Ruf nach Arbeit praktisch zusammen.
In diesem Sinne hat der DGB in der Bündnis-Vereinbarung mit Kanzler und Arbeitgebern zugesagt, im Rahmen seiner Handlungsautonomie
, also auf dem Felde gewerkschaftlicher Tarifpolitik, dem staatlichen Gebot zur Arbeitskostensenkung nachzukommen. Den zuständigen Instanzen hat er damit einen Freibrief ausgestellt. Den nutzen die Unternehmer mit stets verschärften Forderungen an die Gewerkschaften und die Politiker mit immer neuen „Spargesetzen“; nicht erst seit dem 23.1., aber seit dem 23.1. unter Berufung auf die gemeinschaftliche Vereinbarung. Und verweigern sich glatt der Gegenforderung der Gewerkschaft, daß der alternativlosen Abhängigkeit ihrer Mitgliedschaft vom „Besitz“ eines Arbeitsplatzes mit Beschäftigungsgarantien oder doch zumindest mit der Vermeidung von Entlassungen entsprochen werden müßte. Der werbende Hinweis, das müßte doch auch, wenn schon vielleicht nicht im Interesse der Unternehmer, so doch ganz sicher im Interesse der Politiker liegen müßte – Aus arbeitslosen Leistungsempfängern wieder Steuer- und Beitragszahler machen!
, untertitelt der DGB das von ihm verfaßte Standortsicherungsprogramm –, läßt die angesprochenen Politiker kalt. Nicht, daß sie nicht liebend gerne wieder mehr Steuer- und Beitragszahler hätten; das Ansinnen jedoch, dafür in die gesetzliche Eigentümer-Autonomie einzugreifen, weisen sie als kontraproduktiv und – mit dem ihrem Beruf eigenen Hang zur Häme – als „beschäftigungshemmend“ zurück. Dem gewerkschaftlichen frommen Wunsch nach Konsens und wechselseitiger Rücksichtnahme setzen dessen staatliche Adressaten ihre Konfliktbereitschaft entgegen – und können das ja auch unbestritten. Denn wo die Gewerkschaft mit ihrem Antrag auf „Arbeit“ das gar nicht freibleibende Angebot zum Lohnverzicht macht, sorgt sie selbst dafür, daß sich diejenigen, an die dies Angebot gerichtet ist, definitiv nicht mehr um ihre Anliegen kümmern müssen.
Ihre entsprechend schlechten Erfahrungen mit der Gegenseite quittiert die Gewerkschaft freilich, konsequent unbelehrbar, mit dem Seufzer: Trotzdem wir zu Zugeständnissen bereit sind, zeigt sich die Regierung stur!
Warum sollte die wohl Entgegenkommen zeigen, wenn sie von der Gewerkschaft alles offeriert bekommt, was sie will? Die DGB-Logik von Vorleistung und Nachziehpflicht ist haltlos; in Bezug auf den Staat genauso wie in Bezug auf die Unternehmer: Letztere haben im Senken des Lohns ihr Mittel, warum sollten die sich in der Lohnfrage mäßigen, wenn ihr Kontrahent ihnen von sich aus Lohnsenkungen zugesteht? Eine andere Art, sich konstruktiv fordernd „einzubringen“ und Berücksichtigung einzuklagen, steht der Gewerkschaft allerdings gar nicht zu Gebote. Und so ist dann auch der zweiten Teil der Forderung beschaffen, hinter der sie im Bonner Hofgarten Hunderttausende versammelt hat:
„…und für soziale Gerechtigkeit“
Und zwar beim „Sparen“! Diesen Titel für den staatlichen Kampf um mehr nationale Erträge aus dem weltweiten Wirken des Kapitals führt die Gewerkschaft selber ständig im Munde – und gibt dadurch zu erkennen, daß sie sich auch der gemeinten Sache: „Runter mit den Sozialkosten!“ verpflichtet weiß; schließlich heißen auch bei der Gewerkschaft die auf Arbeitslosengeld angewiesenen Proletarier „Leistungsempfänger“ und weisen den Mangel auf, daß sie kosten statt zahlen. Das, was manche Gewerkschafter als „Kröte“ zu bezeichnen wußten, die man beim Bündnis des 23. Januar schlucken mußte – es war ihnen aufgefallen, daß ihre Teilnahme die grundsätzliche Zustimmung zu den Maßnahmen der Regierung bedeutete –, ist eben gar nicht der Preis für die vorgestellte gute Sache – „Arbeit“ –, sondern deren Konsequenz. Der staatliche Wille, „für Arbeit“ dem Kapital Beschäftigungshemmnisse aus dem Wege zu räumen, beinhaltet ja gerade den Beschluß, den Sozialstaat so zu reformieren, daß er das Kapital möglichst wenig, die Arbeiter und Arbeitslosen um so mehr kostet. Dieser Wille war in jener Vereinbarung unmißverständlich zum Ausdruck gebracht und von der Gewerkschaft förmlich anerkannt. Bloß – so ihr Zusatz, so als wäre der eine Relativierung und nicht die explizite Bestätigung des staatlichen Standortprogramms – müsse dieses Programm sozial gerecht ausfallen, die Regierung also bei den Lasten, die sie verordnet, ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen. In das Bündnis interpretierte sie damals ihre Genugtuung hinein, auch dazu habe sich der Kanzler jetzt endlich herbeigelassen.
In der Sache ist die Idee einer Symmetrie der gerechten Lastenverteilung, in der marktwirtschaftlichen Arbeitswelt überhaupt und bei einer Sache wie dem „Sparpaket“ im besonderen, ein Unsinn: Die kapitalistische Gerechtigkeit verlangt mit gleicher Hoheit von den Unternehmern, daß sie erfolgreich reicher werden, von ihren Arbeitnehmern, daß sie dafür billig und ausnutzbar sind, und von den Ausgemusterten, daß sie noch billiger sind und nicht stören; dementsprechend hält ein „sozial ausgewogenes Sparpaket“ für die einen die Last der Verantwortung fürs Gewinnemachen und dementsprechend verbesserte Bedingungen für die Vermehrung ihres Reichtums bereit, für die anderen genau deswegen verschlechterte Bedingungen für ein Leben in sozialstaatlich betreuter Armut. Die in der Sache ganz unpassende Idee, Sozialpolitik im Kapitalismus wäre so etwas wie ein gerechter Lastenausgleich, ist dennoch nicht unnütz: Ihre ideologische Leistung, die Opfer des Systems auf ihre Staatsgewalt zu verpflichten, ist beachtlich. Die Politik ist nämlich zu jeder Beschränkung von Interessen berechtigt und unwidersprechlich befugt, wenn sie nur Gerechtigkeit dabei obwalten läßt – was allemal eine Frage des Gesichtspunkts ist, den berufsmäßige Heuchler immer in ihrem Sinne bei der Hand haben. Die Politik und sonst niemand hat dann auch den Nutzen davon, wenn die Geschädigten des Systems ihre Sorgen als Frage von Recht und Gerechtigkeit auffassen und auf deren berufene Anwälte bauen. Den Gerechtigkeitsfanatikern vom DGB ist dieser Zusammenhang vor allem in seiner negativen Fassung geläufig, und so gefällt er ihnen, weil sie damit einen besonderen Nachdruck hinter ihre Anträge auf sozialen Ausgleich meinen setzen zu können: Gerechtigkeit muß sein, weil sonst die Bereitschaft der Massen leiden könnte, zu ihrem Staat zu halten und die Klassengesellschaft als proletarische Heimat anzuerkennen. Das erzählt der DGB dann auch noch denen, vor deren potentieller Staats- und Gesellschaftsverdrossenheit er warnt, und legt seinen Demonstranten die Forderung ans Herz, die Regierung möchte sie doch bitte davor bewahren, zu einer Gefahr für den inneren Frieden im Klassenstaat zu werden:
„Wachsende Armut vieler und großer Reichtum weniger spalten die Gesellschaft. Der soziale Friede ist bedroht… Darum wollen wir soziale Gerechtigkeit.“ (Demo-Aufruf).
Die Praxis des Bündnisses – ein einziger Verstoß gegen seine guten Absichten
Ein paar Monate gehen ins Land, und der DGB ist keine einzige Täuschung los, sondern zutiefst enttäuscht. Er wähnte sich nämlich mit dem Bündnis in einer lange angemahnten, jetzt endlich hergestellten Übereinstimmung mit dem staatlichen Interesse an Beschäftigung und an der Reform des Sozialstaats. Seither muß er immer wieder feststellen, daß er gar nicht in Übereinstimmung ist.
Das hat nichts damit zu tun, daß der Kanzler und seine Ministerriege etwas versprochen hätten, was sie jetzt nicht einhalten würden. Versprochen war ja nun wirklich nichts anderes als die konsequente Fortsetzung der Politik zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte
. Und auch die Verknüpfung des gewerkschaftlichen Mottos „Bündnis für Arbeit“ mit dem politischen Schlachtruf „…und zur Standortsicherung“ gab das staatliche Anliegen und die aus ihm folgende praktische Umsetzung unmißverständlich zu Protokoll: Das Bündnis sollte neue Handlungsspielräume für standortsichernde Investitionen
schaffen; und die kommen allesamt dadurch zustande, da bließ kein Zweifel, daß der Preis der Arbeit, also das Einkommen der Leute, nicht so bleiben kann, wie es ist. Die Gemeinsamkeit, die die Regierung weniger versprochen als vielmehr verordnet hat, weist den Parteien die ihrer marktwirtschaftlichen Funktion entsprechenden Aufträge zu: den Unternehmern das verbilligte Unternehmen und der Gewerkschaft die Verpflichtung, in ihrem Verantwortungsbereich, der tariflichen Ausgestaltung von Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, für die Korrekturen zu sorgen, die die besagte Verbilligung herbeiführen. Als Partner des Bündnisses sind der DGB und seine Einzelgewerkschaften dazu angehalten, den immer neuen Spartaten der politischen Führung flankierende Schützenhilfe zu geben. Dafür – und nicht, um der Gewerkschaft einen Gefallen zu erweisen – hat die Bundesregierung deren Drängen auf ein Bündnis für Arbeit nachgegeben. Eben so, daß sie ihm ihre Stoßrichtung verliehen hat.
Und darüber ist es nun doch zu einem Dissens zwischen Regierung und Unternehmerverbänden auf der einen, Gewerkschaften auf der anderen Seite gekommen. Nicht als ob die deutsche Arbeitervertretung sich den Aufgaben entzogen hätte, die ihr im Rahmen des „Bündnisses“ zugeteilt worden sind. Alle Tarifverträge des Jahres 96 heißen „Bündnis für Arbeit“ und sehen auch so aus: Keine Lohnerhöhung, dafür Streichung von allerlei „einmaligen“ Lohnbestandteilen, Freiheiten für untertarifliche Bezahlung, flexible Arbeitszeiten… Dennoch: Immer wieder haben die Arbeitervertreter sich ausgegrenzt gesehen durch eine vorab ausgemauschelte Einheitsfront von Politik und Wirtschaft. Sprachregelungen, an denen sie maßgeblich mitgewirkt hatten – etwa über die Erfolgsaussichten von Beschäftigungsinitiativen –, wurden öffentlich desavouiert. Und dann kamen noch die Regierungsbeschlüsse zur Erleichterung von Kündigungen und zu Eingriffen in Tarifrechte bei der Einschränkung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, mit denen gewerkschaftliche Positionen vom Tisch gefegt wurden. Dabei hat es der DGB an Entgegenkommen in der Sache auch da nicht fehlen lassen; zur „Senkung des Krankenstandes“ z.B., damit die Unternehmer für ihr gutes Geld Arbeitszeit kriegen und nicht für Lohnfortzahlung ohne Arbeit blechen müssen, ist den Gewerkschaftsvertretern als erstes eingefallen, daß das Anliegen in Ordnung geht und ihr Verein schön längst wegweisende Vorschläge dazu gemacht hat. Solches Entgegenkommen war bloß überhaupt nicht gefragt. Und dabei war nicht der Punkt, daß es in der Sache hinter den Forderungen der Gegenseite zurückblieb – so haben die DGB-Vereine es immer gehalten, sind mit „Maximalpositionen“ in Verhandlungen eingestiegen, um dort zuzugestehen, was verlangt war, und ihre Kontrahenten sind darauf eingegangen. Im „Bündnis für Arbeit“ jedoch wurden die Einsprüche der Gewerkschaft nicht, dem gewohnten „Ritual“ gemäß, begutachtet, zurückgewiesen, schließlich in eine akzeptable Sprachregelung und eine inakzeptable Sachforderung zerlegt und dementsprechend beschieden, sondern in aller Form verworfen. Den gewerkschaftlichen Verhandlungswünschen hat der Kanzler seine Richtlinienkompetenz entgegengesetzt und unter Mißachtung gewerkschaftlicher Einwände Gesetzespakete schnüren lassen. Und in der Zurückweisung gewerkschaftlicher Beschwerden über dieses ungewohnt rohe Verfahren hat Kohl es seinerseits auf den Punkt gebracht: Er hat die „Grenzen der Konsensdemokratie“ ausgerufen und klargestellt, daß „wir eine Republik und kein Verbändestaat“ sind.
So hat sich das „Bündnis für Arbeit“ zum Gegenteil dessen entwickelt, was die Gewerkschaften damit beabsichtigt hatten: Die wollten als Urheber eines nationalen Gemeinschaftswerks aus der Position des defensiven Interessenvertreters herauskommen und in ihrem Anspruch, auch in den neuen Zeiten die unentbehrliche „Säule der Demokratie“ zu sein, offizielle Anerkennung finden. Die Regierung hat die Gelegenheit ergriffen, ihnen genau diese Approbation als demokratischer Machtfaktor zu versagen. Gegen das gewerkschaftliche Drängen auf „sozialen Konsens“ hat die Regierung den Anspruch auf demokratische Unterwerfung ohne viel Wenn und Aber gesetzt, gegen die Gepflogenheiten des herkömmlichen „sozialen Friedens“ den Willen zur Gleichschaltung und zum öffentlichen Dissens mit gesellschaftlichen „Kräften“, die in Fragen von nationalem Belang noch so etwas wie Autonomie in Anspruch nehmen.
Die Reaktion des DGB zeigt, wie genau diese Regierungsoffensive ihn in seinem essentiellen sozialen Anliegen getroffen hat – und daß er gar kein anderes hat: Enttäuscht und trotzig besteht er – auf dem Konsens, den er nicht kriegt. Die Hoffnung, die er in das Bündnis gesetzt hat – nämlich als Nagelprobe auf das gedeihliche Zusammenspiel von wirtschaftlicher Vernunft, sozial gerechtem Staat und gewerkschaftlicher Ordnungsmacht –, erklärt er zum guten Geist des Bündnisses, dem dessen Praxis zuwiderlaufe. Den Geist klagt die Gewerkschaft jetzt ein und geht für ihn protestieren. Aus nationaler Verantwortung, wie sie glaubhaft beteuert. Den „Marsch in eine andere Republik“ will sie verhindern – für so gänzlich wohlgeraten hält sie die bestehende. In diesem Sinne kennt sie ein Opfer und viele Schuldige dafür, daß aus dem Bündnis nicht das wird, was sie sich darunter vorstellt.
Das „Opfer“, von dem sie spricht, hat mit den Opfern unter ihrer Mitgliedschaft, die das geschmiedete Bündnis anrichtet, nichts zu tun. Es heißt „soziale Demokratie“ und hat sich laut DGB als Standortsicherungs-„Rezept“ bislang bestens bewährt. Denn es hat verbürgt, worauf es doch allen ankommt: einen konkurrenzfähigen Standort, einen wohlhabenden Staat und eine sozial befriedete Arbeitnehmerschaft. Das mit garantiert zu haben, lobt sich die Gewerkschaft. Das weiter zu garantieren, bietet sie sich an. Und muß erleben, daß man sie in dieser Rolle nicht mehr will. So probiert sie es mit der negativen Fassung ihres Selbstlobs und warnt vor der Gefahr, die neuen Sozialgesetze könnten kontraproduktiv wirken und sie selber womöglich zu einer kontraproduktiven Kraft werden, die sie gar nicht werden will:
„Die Kürzung der Lohnfortzahlung wird die davon erwartete Senkung des Krankenstandes nicht bringen, könnte aber zu erheblichen Konflikten in den Betrieben führen… Radikalisierung der Tarifvertragsparteien und der Gesellschaft.“ (IG Chemie-Vorsitzender Hubertus Schmoldt).
Indem sie die Arbeitervertretung ausgrenzt, setzt die Regierung ihre schöne Republik aufs Spiel. Erklären kann die Gewerkschaft sich das nur, indem sie die Schuldigen namhaft macht. Nämlich in erster Linie egoistische, also unsoziale und antinationale Unternehmer, die noch nicht einmal ihr eigenes Metier beherrschen:
„Nieten in Nadelstreifen … schädigen die Volkswirtschaft an einem Tag mehr als alle Blaumacher in den letzten 10 Jahren zusammen!“ (DGB-Vorsitzender Schulte in Bonn)
Die sägen am nationalen Gemeinschaftswerk. Und fatalerweise ist die Regierung Kohl unter deren schlechten Einfluß geraten.
Womit andererseits auch schon klar ist, wofür und gegen wen der gewerkschaftliche Kampf zu führen ist: für ein besseres als das jetzige „Kabinett des Kapitals“, gegen den zu groß geratenen Einfluß der Reichen und Schmarotzer im Lande. Sogar die amtierende Regierung bekommt noch eine Chance: Könnte sie nicht wenigstens die „Spitzen des Sparpakets“ abmildern und die Sache mit der Einschränkung der Lohnfortzahlung und des Kündigungsschutzes als Zeichen ihres guten Willens und der Anerkennung gewerkschaftlich wahrgenommener Standort-Verantwortung noch einmal überdenken? Das fordert der DGB in seinen „Protestwellen“ des Sommers 1996. Und wenn das nichts hilft, dann bleibt immer noch eins:
In der Wahlurne die Verhältnisse ändern!
Die demonstrative Äußerung seiner unverwüstlich guten, aber leider frustrierten Auffassung von den Aufgaben der Regierung bürgt für zwei Konsequenzen, die dem regierungsamtlichen Lauf der Ereignisse im Standort Deutschland nicht nur keinen Abbruch tun, sondern ihm gute Dienste erweisen.
Die erste betrifft die auffällige Trennung zwischen dem praktischen Mitziehen der Gewerkschaft in Kohls Standortrepublik und dem Kundtun ihres Frusts in einem „heißen Sommer“, eine Trennung, auf die sie in Wort und Tat großen Wert legt. Und die ihren Grund darin hat, daß, wer enttäuscht ist, vom Gegenstand seiner Zuneigung einfach nicht abzubringen ist. Der DGB will zurück zum „Konsens“ der Kanzlerrunde vom 23.1. und läßt es an konstruktiven Beweisen seiner Bündnis-Fähigkeit nicht mangeln. Wenn die anderen schon ihre Verpflichtungen nicht einhalten, dann blamiert sie eben der Eifer des Arbeitervereins mit dem Einhalten seiner Verpflichtungen. Daß er auf diese Weise in praktizierter Bündnis-Treue den politischen Vorgaben nachkommt, ist natürlich ganz im Sinne der Bonner Erfinder.
Zum zweiten ist dem DGB sonnenklar, daß zu seinem Ärger über die undankbare Bonner Regierung eines unter Garantie nicht paßt: eine Nötigung, eine Ausübung von Druck – wofür das gewerkschaftliche Mittel des Streiks ja immerhin zu Gebote stünde. Doch das erscheint ihm selber kontraproduktiv zu seinem Quengeln nach Beschäftigung und zu der von ihm selbst beanspruchten sozialstaatlichen Funktion, befriedete Verhältnisse beim „notwendigen Umbau“ des Standorts Deutschland zu verbürgen. Kaum war das häßliche Wort vom Streik gefallen, dann mit der Möglichkeit eines Generalstreiks kokettiert worden, war ein hochoffizielles Dementi des Vorsitzenden fällig:
„Die deutschen Gewerkschaften werden keinen Generalstreik gegen eine gewählte Regierung führen. Über Regierungen entscheidet in einer Demokratie das Volk am Wahltag. Und da gehört die Entscheidung hin.“ (Schulte)
So waren die gewerkschaftlichen Selbstwarnungen vor einem Druck auf den gewählten Souverän des deutschen Volkes um ein Vielfaches lauter als der kaum vernehmliche Ruf nach solchem Druck.
Auch das hat der gewählte Souverän seiner Gewerkschaft jedoch nicht gedankt. Stattdessen hat er einmal mehr die Gelegenheit ergriffen und der autonomen Tarifpartei ihre demokratische Pflicht um die Ohren geschlagen, der Regierung – gewählt, wie sie ist! – nicht in die Quere zu kommen: Nie werde er, Kohl, sich dem Druck der Straße
beugen – eine leichte Übung, wo „die Straße“ selbst zu erkennen gibt, daß sie zu solchem Druck nicht aufgelegt ist.
Auf solch gesicherter Grundlage kann Kohl dann der Gewerkschaft auch mit der regierungsamtlichen Version ihres ureigenen Rufs nach Arbeit kommen: Demos schaffen keine Arbeitsplätze!
Dieser saublöde Spruch macht eine bedingungslos konstruktive, um ihre konstruktive Rolle kämpfende Gewerkschaft schwer betroffen; denn er erinnert sie nicht nur an den nötigen Respekt vor den wirtschafts- und sozialpolitischen Anliegen des Staates und vor der Zuständigkeit der Unternehmer fürs Schaffen von Arbeitsplätzen, sondern nagelt sie auf ihrem Widerspruch fest: Eine Gewerkschaft, die nichts als Garant des sozialen Friedens sein will, um über die Tugend der Unterwürfigkeit den Standort zu sichern – Stichwort für beides: „Arbeitsplätze“! –, schießt sich selbst ins Knie, wenn sie ihre Anerkennung in dieser Funktion mit Drohungen und Aktionen, die die Regierung als „zivilen Ungehorsam“ zu definieren beliebt, erkämpfen will. Sie soll sich ihre eigenen Mitglieder zum Vorbild nehmen, die Unterwerfung pur praktizieren und gar nicht erst auf die Idee kommen, dafür eine autonome Macht darstellen zu wollen:
„Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute sind weiter als ihre Interessenvertreter.“
Damit strebt der „demokratische Dialog“ seinem Höhe- und Endpunkt entgegen. Der DGB bemüht sich um den Nachweis, daß er als Interessenvertreter schon lange so weit ist wie jene „Leute“, die der Kanzler zitiert hat, um die Verpflichtung auf den Willen der Regierung einzufordern. Nein, es ist der Kanzler, so lautet seine Retourkutsche, der die Leute guten Willens von ihrem Glauben an eine gerechte Politik abbringt. Getreu dem Diktum seines Vorsitzenden, daß die einzige „Einflußmöglichkeit“ von Arbeitern und ihrem Verein der Stimmzettel ist und sein darf, gibt der DGB seiner Demo das Gewicht von 350000 Stimmzetteln ohne Ankreuzmöglichkeit und meldet als Erfolg, daß ihm damit die Bildung einer neuen „sozialen Bewegung“ geglückt ist, nämlich eine solche von Wählern. Seine nächsten Demos im September nennt er dann passenderweise „Mehrheit für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“, denn auf Mehrheiten kommt es an in einer lebendigen Demokratie. Der nicht ganz neue Begriff der sozialen Bewegung ist damit unmißverständlich vom Geruch der Einmischung unzufriedener Leute in den Ablauf der Politik befreit und konnotiert mit dem Status von Leuten, die sich ihrer Inkompetenz für die Verfolgung ihrer Interessen bewußt sind:
„Als Bürgerinnen und Bürger werden sich die Gewerkschaftsmitglieder überall zu Wort melden… Wenn es in den Parlamenten keine Mehrheit gibt, dann suchen wir sie in der Gesellschaft.“ (Schulte)
Auf daß sich irgendwann und irgendwie vielleicht doch im Parlament eine Mehrheit gegen das vorliegende Gesetzespaket finden möge. In diesem Sinne organisiert der DGB nach seiner Großdemo „Protestwellen“, die sich nach dem Bonner Fahrplan für das parlamentarische Durchziehen der Spargesetze richten und demgemäß den 13. September, den angekündigten Tag der endgültigen Verabschiedung im Bundestag, als vorläufigen Endpunkt anpeilen. Das Ziel: Fünf Abgeordnete der Regierungsparteien dazu zu veranlassen, gegen Teile des „Sparpakets“ zu stimmen und damit die Kanzlermehrheit zu Fall zu bringen. Wenn das nicht gelingt (Abgeordnete sind ja bekanntlich ihrem Gewissen und nicht dem Hofgarten verantwortlich), will der DGB nicht ruhen und rasten bis 1998: Dann geht es um die Mehrheit für den oder einen anderen Kanzler. Dafür wird an den wählenden Staatsbürger im Arbeiter appelliert und die Kunst der untertänigen Beschwerde geübt, nämlich die Vorführung enttäuschten Vertrauens in die Regierung, deren Beruf es eigentlich doch wäre, den „kleinen Leuten“ und ihren Gewerkschaftsfunktionären Gutes zu tun:
„Wir haben im Vertrauen auf den Gesetzgeber darauf verzichtet, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall tarifvertraglich abzusichern. Dieses Vertrauen mißbraucht der Kanzler und damit treibt er die Gewerkschaften auf die Straße.“ (Schmoldt)
Und wem in die Arme? Wenn der Kanzler nicht besser aufpaßt: am Ende seinem Konkurrenten von der SPD. Das muß dem Mann doch Eindruck machen… Dabei macht sich der DGB noch nicht einmal darüber etwas vor, daß auch in der SPD die Zeiten längst vorbei sind, in denen demonstrative Gewerkschaftsnähe noch als Wahlargument benutzt wurde und vielleicht sogar etwas genützt hat.
So kämpft die Gewerkschaft konsequent demokratisch gegen sonst nichts, aber gegen ihre demokratische Demontage durch die regierenden Demokraten. Und bewährt sich so als gute demokratische Arbeitervertretung: Bis zuletzt – und ungeachtet aller Schäden, die die vertretenen Arbeiter hinzunehmen haben – tut sie alles, um ihre Leute im demokratischen Sandkasten der Republik einzuhausen, ihnen die Illusion zu erhalten, zumindest eigentlich wäre die Nation samt Regierung und Sozialgesetzen für ihre Ernährung da, und so dem Klassenstaat Gegnerschaft zu ersparen.
[1] Siehe hierzu den Artikel: Politische Krisenbewältigung. Die Entdeckung des nationalen Lohnniveaus als Konkurrenznachteil des deutschen Standorts und die sozialen Maßnahmen seiner Sanierung (GegenStandpunkt 1/2-96, S.111).