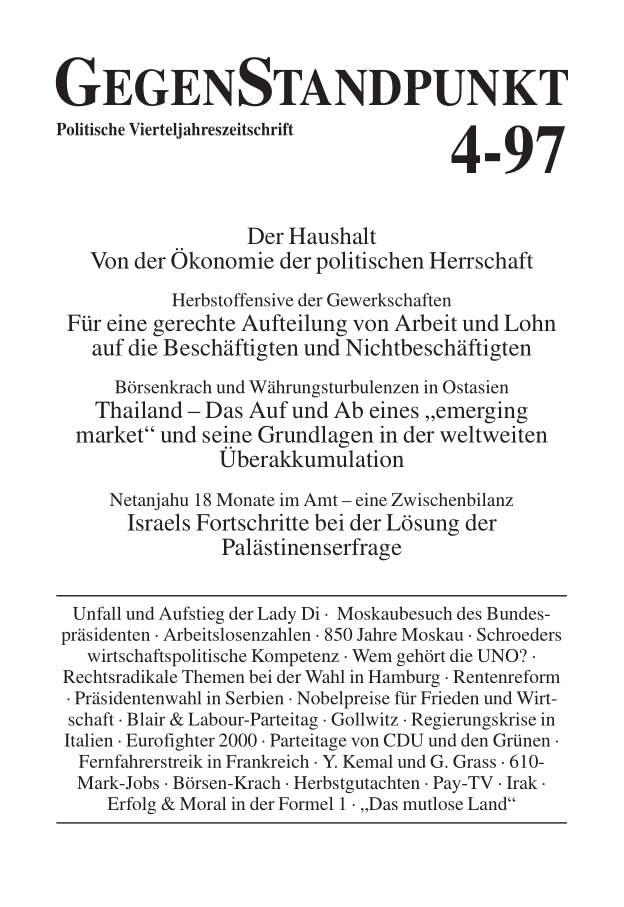Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Der Labour-Parteitag in Brighton
Blair lässt einen Ruck durchs Land gehen
Die Begeisterung der Untertanen, die eine politische Führerfigur auf sich zieht, würdigt die demokratische Öffentlichkeit interessiert als Leistung der besonderen Politikerpersönlichkeit. Dabei kann diese nur abrufen, was das Wahlvolk ihr entgegenbringt: staatstreuen Nationalismus und den Glauben daran, dass bei dieser Figur die Macht in den besten Händen ist.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Der Labour-Parteitag in
Brighton
Blair läßt einen Ruck durchs Land
gehen
Seit Clement Attlee, dem ersten Nachkriegs-Premier,
hat kein Labour-Chef die Regierungspartei so dominiert
wie Tony Blair diese Woche im Seebad Brighton
(FR). Er ist heute so
unangefochten wie Margaret Thatcher nach ihrem
Falklandkrieg
(SZ). Er
verfügt über eine beispiellose Popularitätsrate im
Lande von 93 Prozent
(FR). Als würden Jugendliche einem
Rockstar huldigen
(SZ),
rastet ein Volk in Begeisterung über seinen neuen Führer
aus.
Hierzulande, wo Demokraten der schreibenden Zunft die
Dinge mit deutscher Nüchternheit zu analysieren pflegen,
nimmt man den Jubel der Briten über ihren Superman
(Der Spiegel) mit einigen Zweifeln an der Glaubwürdigkeit
der Verheißungen zur Kenntnis, die Blair seiner Nation
im Stile eines evangelistischen Heilsbringers
(SZ) macht; mit Verwunderung
über den massenhaften Zuspruch, den ein Polit-Manager
erfährt, der seinen Landsleuten bei Licht besehen nichts
als harte Entscheidungen
ankündigt; aber auch mit
schlichter Bewunderung für den Mann, der es geschafft
hat, seine Partei und seine Volksmassen beachtlich
geschlossen hinter sich zu bringen: Man weiß zu
berichten, daß er über besondere Fähigkeiten verfügt, ein
politisches Talent
ist, attestiert ihm eine
unwiderstehliche Überzeugungskraft
(FR) und untersucht seine Reden auf die
rhetorischen Kunstgriffe hin, die er als packender
Redner
(SZ) auf Lager
haben muß. Würde er sonst so ankommen? Daß das irgendwie
an seiner Person liegen muß, ihrem Geschick, sich
darzustellen und anderen Leuten etwas vorzumachen,
darüber sind sich die Kommentatoren weitgehend einig. Am
Gelingen des Kults, den demokratische Führer um sich
veranstalten, liegt ihnen nämlich so viel, daß sie den
Hut vor deren Person ziehen, wenn die widerwärtige
Veranstaltung gelingt. Und indem sie das tun, tragen sie
das Ihre zu dieser Veranstaltung bei.
Dabei zeigt sich gerade am Fall des um Blair
veranstalteten Spektakels der Superlative
, daß die
Person zuallerletzt der Grund dafür ist, wenn es einer
politischen Führungsfigur gelingt, die Begeisterung ihrer
Untertanen auf sich zu ziehen. Deutlich wird an diesem
Fall, daß es wirklich keine Kunst ist, diese Begeisterung
abzurufen, wenn einer – erstens – erst einmal
unangefochten die Macht innehat und sich mit der
seinem staatstreuen Volk präsentiert. Jeder andere würde
als hemmungsloser Wichtigtuer dastehen oder sich zur
Einweisung in eine Anstalt empfehlen, wenn er in
salbungsvollem Tonfall die Worte Ich habe eine Vision
von Britannien
in die Runde wirft. Ein Machthaber,
der so seine Absicht bekundet, die Geschicke seiner
Nation zum Besseren zu wenden, trifft hingegen auf eine
Zuhörerschaft, die gespannt ist, was nun kommt: Wir
können niemals die Größten sein, vielleicht nie wieder
die Mächtigsten, aber wir können die Besten sein.
Die
Ansprache – wir
– ist schon die ganze Mitteilung.
Mit ihr erfahren seine Untertanen, daß sie einen Führer
vor sich haben, dem es um dieselbe, gemeinsame
Sache wie ihnen geht und der sich für diese Sache
auf seinem Posten ebenso einzusetzen verspricht, wie er
von ihnen verlangt, daß sie auf ihrem Posten ihre Pflicht
tun. Offenbar rechnet auch ein britischer Regierungschef
nicht damit, daß die Angesprochenen Zweifel an der
gemeinsamen Sache bekommen, wenn er ihnen klarmacht, daß
mit der Postenverteilung eine Arbeitsteilung gemeint ist,
in der er die einschneidenden Entscheidungen
trifft, die sie auszuhalten haben. Im Gegenteil: Er geht
davon aus, daß seine Ankündigung, den Wohlfahrtsstaat
gründlich auszumisten
– die Familie stärker für den
Unterhalt ihrer Angehörigen einzuspannen, Studenten für
ihr Studium bezahlen zu lassen, alleinstehenden Müttern
die staatliche Unterstützung zu streichen, Rentner im
Regen stehen zu lassen usw. –, als Beweis genommen wird,
wie ernst er es meint mit seinem Einsatz für die
gemeinsame Sache. Er teilt seinen Untertanen mit, daß
diese Sache ihren Preis hat, und verläßt sich dabei
darauf, daß sein Publikum von einer Prüfung des
Preis-Leistungs-Verhältnisses absieht. Ansprüche, die das
materielle Wohl seiner Bürger betreffen, bedient er
einfach nicht. Seine Vision
stellt er ihnen in
ihrer ganzen Schäbigkeit vor Augen: ein Britannien, in
dem kein Kind hungert, in dem die Jungen Arbeit haben und
die Alten geliebt und geehrt werden bis ans Ende ihrer
Tage
; eine Nation, deren Insassen in der Kindheit
gerade mal was zum Futtern haben, um dann ein Leben lang
für andere arbeiten zu müssen, damit sie als Lohn im
Alter dann – wenn schon keine Rente – so doch wenigstens
Anerkennung genießen, ist alles, was seine visionäre
Kraft hergibt. Und mehr muß sie auch nicht hergeben. Er
will nämlich überhaupt nur Leute ansprechen, die ihren
Stolz daraus beziehen, arm, aber ehrlich ihrer Nation zu
dienen, und denen nichts wichtiger ist, als einer
großen Nation anzugehören. Mit dem Versprechen,
ein Land zu formen, das mit erhobenem Haupt als
Vorbild für einen entwickelten Staat im 21. Jahrhundert
dienen kann
, bringt er auf den Punkt, wessen es zur
Ansprache ans Volk – zweitens – bedarf: Einer
Deutung der Macht als die gemeinsame Sache, um
deren Erfolg es dem Ober- und den Unterbriten
gleichermaßen geht. Der ganze Witz dieser Deutung liegt
darin, daß der Regierungschef die Macht, die er ausübt,
als Herzensanliegen und einziges Bedürfnis seines Volks
ausdrückt und demonstriert, wie einig er sich mit seinem
Volk darin ist: Ihr habt den Glauben an uns
bewahrt, und wir den Glauben an euch.
Dabei macht es
gar nichts, daß die Affigkeit der Veranstaltung bemerkt
wird. Wenn sich der neue Premier an sein Volk mit den
Worten wendet: Macht, daß das Gute in unser aller
Herzen zu unser aller Besten dient
, dann macht
er sich mit solchen Sprüchen nicht unmöglich:
Im Unterschied zu den gelegentlichen Versuchen seines
glücklosen Vorgängers John Major aber, Familienmoral und
Nationalgefühl zu beschwören, klang Blairs Aufruf zu
bürgerlichen Werten keineswegs lächerlich.
(FR) Immerhin geht aus so
einem Kommentar hervor, daß man in der Demokratie mit
solchen Sprüchen erst einmal ankommen muß und auch als
Machtinhaber nicht davor gefeit ist, mit ihnen den Spott
der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Dies entscheidet
sich tatsächlich – drittens – an der
Glaubwürdigkeit der Person, an der Frage
nämlich, ob das Wahlvolk ihr abnimmt, was sie verspricht:
daß bei ihr die Macht in den besten Händen ist. Daß ihr
das abgenommen wird, liegt wirklich nicht an ihr. Schöner
als ein Kommentator von der Süddeutschen Zeitung kann man
das gar nicht ausdrücken: Blair bekommt seine standing
ovation. Da ist soviel Überzeugungskraft, und es braucht
schon einen klaren Kopf, sich nicht mitreißen zu
lassen.
In der Demokratie ist Überzeugungskraft
offenbar nicht auf einen klaren Kopf berechnet, der sich
prüfend zu den ihm dargebotenen Argumenten stellt. Wenn
da die auf einem Parteitag anwesenden Massen im Jubel
über ihren Führer ziemlich durchdrehen, dann will auch
der Schreiber der seriösen Zeitung nicht länger elitär
auf seinem klaren Kopf bestehen. Dann drängt sich auch
ihm die Annahme auf, daß ein Politiker, der soviel
Beifall erhält, für überzeugend gehalten werden darf.
Deswegen geht es auch ganz in Ordnung, daß sich –
ebenfalls laut Mitteilung der SZ – einer Umfrage zufolge
inzwischen zwei Millionen Wähler mehr erinnern, für
ihn gestimmt zu haben, als die Statistik ausweist
.
Das sind doch mal grundsolide Auskünfte darüber, was an
einer Politikerpersönlichkeit dran ist, die das Volk
mitreißt
, weil sie glaubwürdig ist.