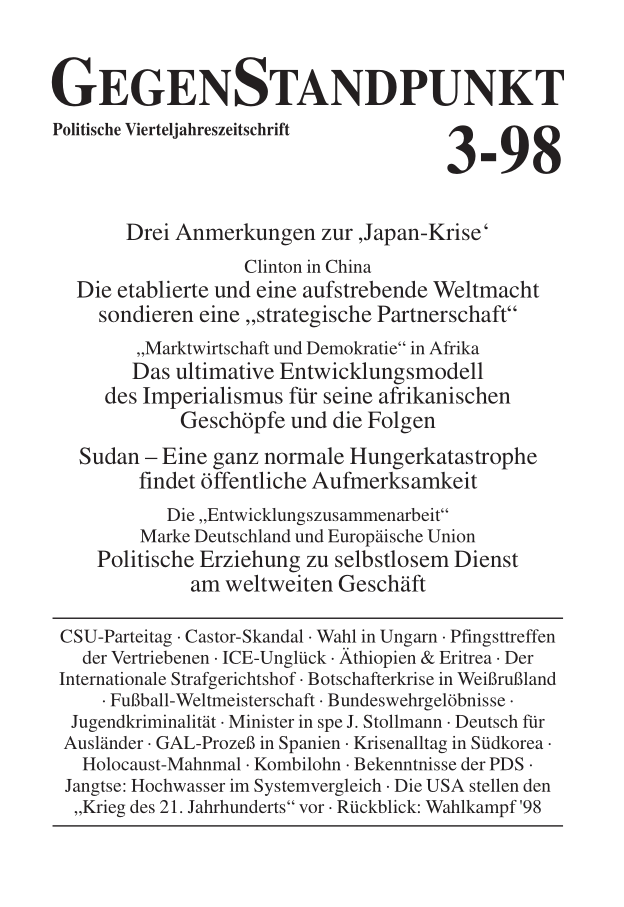Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Vom ‚kleinen Parteitag‘ der CSU in Nürnberg
Klarstellungen zur politischen Kultur in der Demokratie
Die „Exzesse“ der demokratischen Wahlkampfkultur –Denunziation des politischen Gegners, Hass gegen linke Abweichler, Polemik gegen unerwünschte Ausländer – gehen für Nationalisten als parteitaktische Berechnungen in Ordnung. Und sie passen haargenau zu der Sache, um die da gekämpft wird. Die Wahrung der Macht der Regierenden, die das Wahlkreuz des Volkes ins Recht setzen soll.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Vom ‚kleinen Parteitag‘ der CSU in Nürnberg
Klarstellungen zur politischen Kultur in der Demokratie
Da versammeln sich erwachsene Menschen, um ihrem Parteichef zuzujubeln, wenn er den Kanzlerkandidaten der SPD als Versager, Heuchler, Blender und verkappten Kommunistenfreund beschimpft. Die Kommunisten ihrerseits – gemeint sind die braven Typen von der PDS – werden abwechselnd als „kriminelle Vereinigung“ und als Bazillen im deutschen Volkskörper charakterisiert, und Waigels Gefolgschaft ist begeistert: Die Töne möchte man hören. Zur Herabwürdigung des Wahlkampfgegners ist eine Sorte Hemmungslosigkeit gefragt, die sich ein halbwegs anständiger Mensch im normalen bürgerlichen Leben nie gestatten würde; was feinfühlige Intellektuelle im Sprachgebrauch der Faschisten als das „Wörterbuch des Unmenschen“ ausfindig gemacht haben, ist gerade scharf genug. Zu steigern ist der Jubel der Parteirepräsentanten noch, wenn der Münchner Vorsitzende den Ausländerhaß im Saal mit dem Scherz von den zwei deutschen Schulkindern bedient, die in ihrer Klasse 20 Ausländerkinder „integrieren“ sollen: Im Unterschied zu gewissen von Natur gemischtrassigen Balkanvölkern haben Bayerns Deutsche ein Recht auf ethnisch saubere Verhältnisse und mögen es, wenn ihre christliche Staatsparteiführung sich dafür stark macht.
Die demokratische Öffentlichkeit findet so etwas nur zum Teil gut und zutreffend, auf alle Fälle aber völlig normal. Manche Liberale empfinden den demonstrativen Nachdruck, mit dem da Gegner verteufelt und „Fremde“ ausgegrenzt werden, als geschmacklos; ernst nehmen sie ihn nicht: Es sei „nun einmal“ Wahlkampf, das Herumpöbeln die „leider“ dazu gehörige „Rhetorik“, alles „bloß“ auf Wirkung beim Wähler berechnet. Bedenken gelten allein der Frage, ob die Berechnung im Sinne der CSU aufgeht. Kritisch sind Beobachter, wenn sie das für zweifelhaft halten und zu bedenken geben, womöglich könnten die Falschen, rechtsradikale Protestparteien nämlich, die der „Wahlkampfrhetorik“ entsprechende Regierungstaten vermissen und einklagen, davon profitieren und der CSU mehr Stimmen abnehmen, als die mit ihrer Scharfmacherei gewinnt. Auch solche Skeptiker verstehen es aber gut, daß die bayrische Christenpartei sich geradezu verpflichtet fühlt, rechts von sich keinen Raum für eine andere politische Partei zu lassen. Parteitaktische Berechnungen scheinen unter Demokraten noch allemal die wüstesten Ausfälligkeiten und Infamien zu rechtfertigen!
Nun mag es in der Tat sein, daß Parteichef Waigel mit seiner Identifizierung der PDS als Krankheitserreger anders als Hitler doch nicht die gewaltsame Entfernung dieser Bazillen aus dem deutschen Volkskörper angekündigt haben will und Gauweiler keine ethnische Säuberung über das bereits praktizierte Abschottungs- und Abschiebewesen hinaus, und daß beide sich nach der Wahl mit Schröder und der SPD auch wieder zu jeder nötigen schwarz-roten ‚Kumpanei‘ zusammentun. Es wird schon so sein, daß die demonstrative Maßlosigkeit der Unions-Propaganda auf den Wiedergewinn einer demokratischen Wählermehrheit berechnet ist und nicht auf die Mobilisierung für einen neuen Faschismus. Doch bevor man solche Veranstaltungen deswegen mit der verständnisvoll-abwinkenden demokratischen Lebensweisheit quittiert, daß ein wenig Übertreibung zum Wahlkampfgeschäft einfach wohl dazugehört, ist eine kurze Besinnung ratsam, wofür man da Verständnis hat.
Diese „ganz normalen“ Exzesse der demokratischen Wahlkampfkultur sind nämlich, gerade weil sie auf Wirkung berechnet sind, auch durchaus nicht ohne entsprechende Wirkung; und sie sind auf ihre Art recht aufschlußreich, was den Zweck der Bemühungen betrifft.
- Wenn eine durch und durch christliche Partei keinerlei Rücksicht darauf nimmt, ob ihre Wahlagitation aus Wahrheiten oder Lügen über den Gegner besteht; wenn sie üble Nachrede für ein zulässiges und das unter professionellen Gesichtspunkten einzig taugliche, also gebotene Überzeugungsmittel hält und gezielt einsetzt; wenn sie sich gegen Konkurrenten, die es an Bekenntnissen zu Kohls und Waigels christlicher Republik fehlen lassen, in Vernichtungsphantasien ergeht und regelrechten politischen Haß mobilisiert – dann ist damit zumindest schon mal das eine klargestellt: Anhänger des „Fair Play“ sind demokratische Politiker ganz entschieden nicht. Für die Beherzigung dieser Tugend, die rätselhafterweise als erzdemokratisch gilt – oder insofern gar nicht rätselhafterweise, als eine Tugend allemal der komplementäre schöne Schein einer tatsächlich praktizierten Schäbigkeit ist –, ist ihnen die Sache, um die es ihnen geht, offenbar zu wichtig.
- Und: was ist da Sache? Auf der prinzipiellen Unverbesserlichkeit ihrer Republik bestehen die Regierungschristen schon sehr totalitär, wenn sie bereits die wohlmeinenden Verbesserungsvorschläge und konstruktiven Proteste der PDS als indiskutablen Anschlag auf die demokratischen Grundwerte des Gemeinwesens verteufeln. Es hilft aber auch Schröder und seiner den Christen weiß Gott geistesverwandten SPD nichts, daß sie am gewohnten Gebrauch der Macht im Staat und der Macht des Staates nichts Großes zu ändern gedenken. Daß sie die Bedürfnisse der Marktwirtschaft und die Notwendigkeiten des Standorts mit der gleichen Ausschließlichkeit und Entschlossenheit vertreten wie die amtierende Mannschaft; daß sie in ‚law & order‘-Fragen keine Abweichung von der Regierungslinie erkennen lassen und außenpolitisch voll auf der Höhe des neuen deutschen Weltordnungswillens sind – für die Kämpfer von der Union ist das einerseits das Mindeste, was ein ernsthafter Konkurrent um die Regierungsmacht vorweisen muß; doch wenn die SPD das überzeugend tut, so erkennen C-Politiker darin andererseits die besondere Infamie dieser Partei, weil die es so am Ende glatt hinkriegen könnte, ihnen die Macht aus der Hand zu nehmen. Und das: daß Sozialdemokraten dasselbe machen wie die bisherige Koalition, das ist für deren Häuptlinge kein Trost: Das wäre schon die „andere Republik“, die es mit dem – wieder einmal – „härtesten Wahlkampf aller Zeiten“ unbedingt zu verhindern gilt.
- Die Sache, um die es Waigel und Genossen geht, ist also nicht dieses oder jenes Stück Politik, bei dem es darauf ankäme, daß es gemacht wird, sondern daß sie es machen, also pur ihre Macht. Ihre an Fanatismus grenzende Gehässigkeit gegen den politischen Konkurrenten, ihr politischer Haß gegen linke Abweichler mit einem womöglich ausschlaggebenden Wahlstimmenquantum – das entspringt ihrem unbedingten Herrschaftswillen und macht umgekehrt deutlich, wie wenig dieser Machtwille mit irgendwelchen sachlichen „Gestaltungs“-Aufgaben zu tun hat, wieviel hingegen mit dem höchst persönlichen Anspruch darauf, ausschließend und umfassend über die Potenzen der Nation und die Lebensbedingungen ihrer Insassen zu verfügen. Daß ihre Herrschaft funktionell notwendig ist, um den kapitalistischen Laden beieinander und das dafür unerläßliche Machtmonopol in Gang zu halten, geht die Profis dieses Gewerbes nichts an, setzt jedenfalls kein Maß, an dem ihr Machtwille sich beschränken würde. Die Sache, um die es ihnen geht, ist die „Identität“ der Republik; und die besteht für sie darin, daß das Land exklusives Betätigungsfeld ihrer persönlichen Verfügungsmacht und Basis ihrer auf den Rest der Welt ausstrahlenden Entscheidungskompetenz ist.
- Die hochverehrte demokratische Grundregel, wonach Person und Amt verfassungsrechtlich – und nicht bloß aus Naturgründen… – trennbar verbunden sind, ist für diesen Machtwillen keine Bremse, sondern eine Herausforderung. Zu der erbitterten Anstrengung nämlich, diese Trennung nicht eintreten, also nicht zuzulassen, daß ein Konkurrent sich zwischen die Macht und ihren Inhaber drängt. So ist die Unduldsamkeit, mit der christlich sozialisierte Demokraten sogar gegen ihresgleichen vorgehen, eine einzige Demonstration, warum überhaupt, inwiefern und wie bedingt sie den ganzen freiheitlichen Wahlzirkus respektieren und schätzen: als Mittel, die Macht zu erobern und zu behaupten. Das Risiko, sie auch mal zu verlieren, nehmen sie in Kauf, weil – und solange – sie sich sicher sind, daß die Demokratie den härtesten Herrschaftswillen, der sich im moralischen Fertigmachen des Gegners zu beweisen hat, mit der Macht belohnt – und diese Tugend trauen sie sich zu. Übrigens wie alle anderen auch, die überhaupt zur Wahl und zum demokratischen Kampf um den Wähler antreten; sonst könnten sie nämlich gleich zu Hause bleiben.
- Wahlkampf wird also von den Profis der Demokratie, die sich in diesem Geschäft am erfolgreichsten bewährt haben, in seinen Regeln also offenkundig am besten auskennen und es jedenfalls mit dem höchsten sittlichen Einsatz betreiben, mit dem Mittel der Denunziation bestritten, die den Konkurrenten, einfach weil er der Konkurrent ist, mit dem Verdacht des Hochverrats an der Nation belegt. Der Wähler, angemessen vertreten durch die jubelnde Parteibasis, wird bedient, indem er als Sachwalter dieser einzig zulässigen Kombination von Macht und Inhaber in Anspruch genommen wird: Ihm als dem Objekt der politischen Herrschaft muß es am Herzen liegen, daß sie in den einzig befugten Händen bleibt. Die aufhetzende Ansprache gilt dem Bürger als purem Nationalisten, der kein höheres Anliegen kennt als die Macht der Nation und den Erfolg ihrer Inhaber. Daß er deren Erfolg bestätigt, die Herrschaft wieder in die richtigen Hände legt, ist umgekehrt sein staatsbürgerlicher Auftrag, sein gutes Recht als geborenes Mitglied des nationalen Vereins – und auch schon das ganze Wahlversprechen der CSU.
- Genau das darf der Münchner Bezirkschef seiner begeisterten Parteibasis noch einmal andersherum vorbuchstabieren. Wenn er gegen jeden weiteren Zuzug von Ausländern polemisiert und für mehr ethnische Säuberung in Bayern eintritt, dann appelliert er damit in Reinform an den idiotischen Stolz des eingeborenen Untertanen, allein als solcher – als einer von denen, die laut Gauweiler „zuerst dagewesen“ sind – der staatsbürgerliche Herr im Haus zu sein. Was er dem Wähler zu bieten hat, ist eine Herrschaft, die diesen Stolz bestätigt. So kommen Machthaber und Regierte ohne alle inhaltlichen Umwege miteinander ins Reine.
Was die CSU auf ihrem Nürnberger Staatsparteitag an kämpferischen „Exzessen“ vorführt: ihre haßerfüllten Ausfälligkeiten gegen Konkurrenten und Gegner, kombiniert mit polemischer Ausgrenzung derer, die nicht „von Natur“ dahergehören – das mag alles wahlkampftaktisch berechnet sein. Gerade so charakterisiert es aber die demokratische Sache, die die Partei auf diese Weise betreibt: die Wahrung ihrer Macht per Akklamation durch ein Wahlvolk, das nichts anderes will als das, was die CSU ihm verspricht, nämlich die rechte Herrschaft. Dieses Ziel blamiert sich nicht durch die parteieigenen Methoden, es zu erreichen: Es gebietet sie. Umgekehrt setzen diese Methoden politische Maßstäbe. Dafür nämlich, wie im vereinigten Deutschland demokratisch-zivil um die Macht im Staat gekämpft wird, wo die bedingungslos auszumerzende linke Polit-Kriminalität beginnt und welcher Rechtsstatus unerwünschten Ausländern gebührt.
So macht die CSU mit ihrem Kampf um die Macht im Gemeinwesen die Nation mitsamt ihrer demokratischen Kultur sich immer ähnlicher.