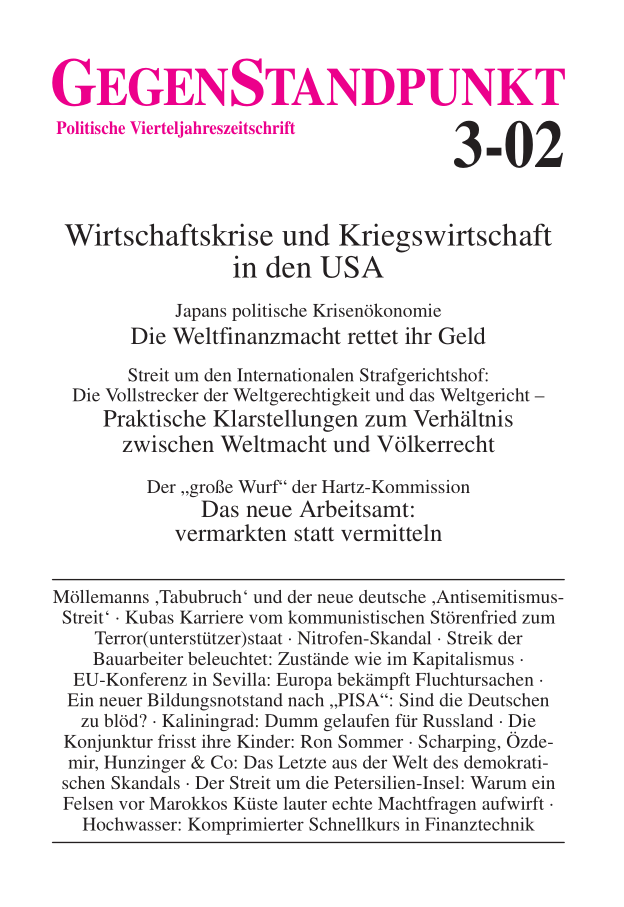Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Ein neuer Bildungsnotstand nach „PISA“:
Sind die Deutschen zu blöd?
Die Ergebnisse der PISA-Studie nimmt der Staat her, um für seine Unzufriedenheit mit den Konkurrenzleistungen des Standorts das „human capital“ und dessen Qualifikation verantwortlich zu machen. Einerseits ist das ein Idealismus, denn er misst die Leistungen der Schule am Erfolg der Wirtschaft, andererseits ist damit klargestellt, dass es bei Bildung um ihre kapitalistische Verwertung zu gehen hat. Der Auftrag an die Schule: eine für die Kapitalbedürfnisse genau passende Masse an ‚richtig‘ ausgebildeten Schülern herzustellen. Die nationale Debatte geht darum, wie dieses Ziel mit welchen pädagogischen und bildungspolitischen Instrumenten umzusetzen geht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die Bildung – eine Ressource der Nation
- Aber nicht die Bildung eines jeden!
- Die Unzufriedenheit mit den Konkurrenzleistungen des Standorts findet einen Sündenbock: Das „Human Capital“ taugt nichts!
- Bildungskrise ist, wenn die Schule für einen Misserfolg des Wirtschaftsstandorts verantwortlich gemacht wird
- Blödsinn und politischer Streitwert einer Bildungsdebatte
Ein neuer Bildungsnotstand nach
„PISA“:
Sind die Deutschen zu blöd?
Ein paar Sommerwochen lang beherrschen zwei Themen die Öffentlichkeit: Das deutsche Abschneiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft einerseits, bei der Pisa-Studie andererseits. Was das idiotische Fan-tum betrifft, so kann es dem offiziellen Deutschland gar nicht radikal genug ausfallen. Die Medien unterlassen jeden Versuch, den fanatischen Nationalstolz zu bremsen oder erzieherisch zu veredeln, den sie in anderem Zusammenhang schon mal dumpf, primitiv, gar gefährlich finden. Beim Fußball darf und soll er hemmungslos ausgelebt werden. Die distanzlose Parteinahme für deutsche Siege samt dem dazugehörigen präpotenten Gehabe und dem Urschrei „Deutschland, Deutschland“ wird als ein wunderbares Lebensgefühl gefeiert. Demonstrative Dummheit steht hoch im Kurs. Zeter und Mordio aber wird geschrieen, wenn ein internationaler Leistungsvergleich der Schulen eine überdurchschnittliche Dummheit der deutschen Jugend enthüllt. Ein Widerspruch? Natürlich nicht. Die eine Dummheit, der Patriotismus, tut Deutschland gut. Die andere, Defizite der geschätzten Patrioten im Rechnen, Schreiben, Lesen steht im Ruf, Deutschland zu schaden.
Die Bildung – eine Ressource der Nation
Der Tatbestand, den „Pisa“ offen legt, ist an sich keine Neuigkeit. Lehrer und Arbeitgeber wissen längst, dass ein beachtlicher Teil der Jugend die Schule nach 8-10 Jahren Unterricht sehr dumm verlässt – ein rundes Viertel kann kaum lesen, schreiben und rechnen und das nächste Viertel kommt über ganz einfache Aufgaben auf diesen Feldern nicht hinaus. Das war lange Jahre kein Skandal. Niemand störte sich groß an der Verwahrlosung dieser „sekundären“, also durch die Schule erzeugten, Analphabeten, denen jeder intellektuelle Zugang zur Welt verschlossen bleibt. Neu ist die Bewertung des Faktums, die sich auf die Pisa-Studie hin einstellt: Mindestens 25% der Schulabgänger sind zu dumm. Wofür? Für die Funktionen und Dienste, die man von ihnen will, – es sind diese Funktionen, nicht die Jugendlichen, die nach allgemeiner Auffassung durch zu viel Dummheit Schaden nehmen. Der internationale Vergleichstest ergibt einen deutschen Tabellenplatz im Leseverstehen, der peinlich ist für ein Land, das sich in jeder Hinsicht zur Spitzenklasse zählt; es belegt den Platz 22 noch hinter Polen und Russland. Öffentliches Erschrecken brandet auf, weil man davon den deutschen Tabellenplatz in einer ganz anderen Disziplin gefährdet sieht. „Wir“ müssen schleunigst, nämlich in höchstens 5 Jahren, auf wenigstens den Platz 5 aufrücken; sonst wird, Arbeitgeberpräsident Hundt zufolge, eine „führende Industrienation im Mittelmaß versinken“; Möllemann bangt um „Reputation und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts“. Man kann dasselbe auch menschenfreundlicher ausdrücken und sich Sorgen um die Erwachsenen von morgen machen, von denen viele schon am Ende ihrer schulischen Laufbahn von allen Lebenschancen abgeschnitten sind und in der modernen Welt keinen Platz finden. Dass sie für sich selbst und ein gescheites Leben zu dumm sind, wird als Problem insofern anerkannt, als es für dieselbe Sorge um ihre kapitalistische Funktionalität steht, die Unternehmervertreter von ihrer Seite her artikulieren: Für die Arbeitswelt in einem modernen High-Tech-Land muss die Jugend schon taugen, sonst taugt sie auch für sich selbst nichts. In der einen wie in der anderen Fassung geht es um die Nützlichkeit des Nachwuchses für den deutschen Kapitalstandort.
Aber nicht die Bildung eines jeden!
Sogar dieser brutale Funktionalismus tut dem dummen Nachwuchs noch zu viel der Ehre an. Die Sorge um Bildung und Standort tut so, als stehe und falle die Nation mit dem Bildungsstand noch des letzten ihrer Bürger. Die Sprüche vom rohstoffarmen Land haben Konjunktur, das von Findigkeit und Kreativität seiner Bewohner lebt. Und wenn schon nicht von jedem Mitglied der „Wissensgesellschaft“ so richtig Wissen verlangt ist, müssten doch wenigstens die elementaren Kulturtechniken von allen beherrscht werden, wenn Wohlstand und Zukunft nicht verspielt werden sollen. Daher seien die Enthüllungen der Pisa-Studie ein wahres Menetekel.
Sieht man sich die tatsächliche Rolle an, die die untere
Hälfte der Schulabgänger im Wirtschaftsleben spielt und
den Maßstab der Funktionalität, dem sie tatsächlich
unterworfen wird, ergibt sich ein anderes Bild. Bei den
Leuten, deren gravierende Defizite im Grundwissen „Pisa“
aufdeckt, kommt es auf das auch nur sehr relativ an. Zwar
schränkt es die Verwendungsfähigkeit einer Arbeitskraft
ein, wenn sie nicht lesen kann; daran mag sich
entscheiden, wo sie eingesetzt wird, ihren Gebrauch –
sofern überhaupt Bedarf da ist – verhindert es nicht.
Beständig verjüngen Betriebe ihre Belegschaften, werfen
ältere Beschäftigte, denen sie Wissen und Erfahrung
zugute halten, raus und ersetzen sie durch Junge. Deren
Vorzüge – jugendliche Konstitution, weniger
Krankheitstage, leichtere Kündbarkeit, niedrigere Löhne –
wiegen das Berufswissen der Alten offenbar ohne weiteres
auf. Schreiben, Lesen und sonstiges Wissen sind eben
nur ein Faktor der Leistungsfähigkeit normaler
Arbeitnehmer. Von ihrem mehr oder weniger gebildeten
Verstand, von der praktischen Betätigung möglichst
weitreichender Kenntnisse und Fertigkeiten, lebt das Land
jedenfalls nicht. Es geht da um eine Leistung anderer
Art, die nicht mit der kompetenten Abwicklung einer
zweckmäßigen Tätigkeit erbracht ist, sondern erst dann,
wenn das Produkt dem Unternehmer Profit abwirft; also
mehr Geld einspielt, als das, welches der Arbeiter als
Lohn nach Hause trägt. Die dafür nötige
Qualifikation
geht nicht auf in intellektuellen
Techniken und Berufswissen, sie wächst auch nicht einfach
durch mehr davon, sondern besteht in dem möglichst
ausgiebigen Einsatz von Muskel, Nerv und Hirn nach dem
Kommando und zum Nutzen des Arbeitsanwenders – und diese
Anwendung der Arbeitskraft durchs Kapital kommt bei einem
nicht geringen Teil der Arbeiterschaft sogar ganz ohne
alle normalen Verständigungsmöglichkeiten aus. Millionen
ausländischer Arbeitskräfte, die der deutschen Sprache
gar nicht mächtig sind, spielen ihre Rolle als
Ausbeutungsobjekte einwandfrei.
Den Klagen über eine unzureichende Brauchbarkeit des Arbeiternachwuchses widerspricht denn auch der tatsächliche Gebrauch, der von der aktuellen Arbeitergeneration gemacht wird. Die Hartz-Kommission der Bundesregierung, die sich mit den Millionen vom Kapital ausgemusterten und nicht gebrauchten Arbeitskräften beschäftigt, jedenfalls klagt nicht über einen Mangel an Elementar- oder Fortbildung bei den Arbeitslosen; sie macht im Gegenteil das überreichliche Berufswissen und die – nicht nachgefragten – und deshalb überflüssigen Qualifikationen, über die diese verfügen und auf die sie Erwartungen an zukünftige Arbeitsstellen und Bezahlung gründen, für die Schwierigkeiten bei ihrer Wiedereingliederung verantwortlich. Schnelle Dequalifizierung, die Zumutung von schlechterer und schlechter bezahlter Arbeit fördern die kapitalistische Brauchbarkeit der „Überqualifizierten“. Gewiss auch die „Unterqualifizierten“ machen den Arbeitsmarktpolitikern Probleme. Dabei wird deren mangelnde Tauglichkeit aber nie anders ermittelt als durch die hartnäckige Nicht-Nachfrage der Unternehmer nach ungelernten Arbeitslosen. Ob und in welchem Maß diese für irgendwelche Anforderungen wirklich untauglich sind, weiß niemand, denn sie sind einfach diejenigen, die übrig bleiben, wenn Unternehmer sich aus einem Überangebot von Arbeitskräften frei bedienen und schon für einfachste Tätigkeiten Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung bekommen können, denen sie dann Hilfsarbeiterlöhne zahlen. Die Abhilfe, auf die Arbeitsmarktpolitiker bei den Niedrigqualifizierten sinnen, besteht denn auch gar nicht darin, ihren Wissensstand zu heben und fehlende Befähigung herzustellen, sondern darin, sie den Unternehmern zu einem Niedriglohn anzubieten, der denen eine zusätzliche Beschäftigung attraktiv machen soll.
Wäre Wissen die bestimmende Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten, dann könnte es davon nie zuviel geben. Auf dem freiheitlichen Arbeitsmarkt aber gibt es nicht nur zu wenig, sondern ebenso gut zu viel Bildung. Sie ist schädlich, wenn ein Arbeitsplatz sie nicht braucht und die angebotene Entlohnung sie nicht berücksichtigt. Im Idealfall gelungener ‚Qualifikation‘ lernen und wissen die Leute genau das, was das Kapital gerade von ihnen braucht, und nicht mehr. Bildung kostet schließlich, sollte also knapp gehalten und nur nach Bedarf verabreicht werden. Bei allen Klagen über die Dummheit des Nachwuchses geht es mithin nur ums rechte Maß von Ausbildung und Unwissen. Nach „Pisa“ herrscht die Sorge, dass dieses Maß bei einem Teil des Nachwuchses allzu sehr unterschritten wird.
Die Unzufriedenheit mit den Konkurrenzleistungen des Standorts findet einen Sündenbock: Das „Human Capital“ taugt nichts!
Woher diese Gewissheit, woher das Maß? Wie viel Analphabeten passen zu einem High-Tech-Kapitalismus? Wie viel Bildung für die breite Masse bzw. wie viel Aufwand dafür lohnt sich? Einerseits gibt die tatsächliche Nachfrage der Unternehmer nach qualifizierten Arbeitskräften eine sehr negative Auskunft: Schon der bisherige Bildungsaufwand lohnt sich nicht, weiterer erst recht nicht: Dass es längst zu viele Bewerber aller Qualifikationsniveaus gibt, dokumentieren sie dadurch, dass sie sich von den vier Millionen Arbeitslosen nur sehr wenige abholen.[1] Mehr Arbeitskräfte, als sie beschäftigen, kann ihre Profitmacherei weder brauchen noch bezahlen. Sie müssen keine Geschäftsgelegenheit auslassen, auf keine Investition verzichten, weil sie die Leute nicht finden können, die sie für die Erledigung bestimmter Arbeiten brauchen.[2] Auf der anderen Seite klagen sie zwar darüber, dass viele Schulabgänger, die sie in die Lehre nehmen, „nicht ausbildungsfähig“ seien; aber diese Klagen sind nicht zum Nennwert zu nehmen und in der Öffentlichkeit bisher auch nicht genommen worden – immerhin sind das Klagen, welche die Lehrlingsausbildung begleiten und nicht beenden. Es wäre ja auch absurd: Ausgebildete Erwachsene können Deutschlands Unternehmer massenhaft nicht gebrauchen, klügere Anwärter auf einen künftigen Arbeitsplatz aber schon?! Im übrigen ist der jeweils aktuelle Bedarf des Kapitals ohnehin kein brauchbares Maß für den Bildungsbedarf der Nation; schließlich soll der die Zukunft des Standorts sichern – und ihre morgige Nachfrage wissen die Unternehmer heute selber noch nicht. Weder aus dem tatsächlichen Gebrauch, noch aus der Nichtbenutzung der Arbeiterbevölkerung, weder aus dem aktuellen noch aus einem vermuteten zukünftigen Arbeitskräftebedarf ist also ein Maß für den nationalen Bildungsbedarf abzuleiten. Und dann soll eine internationale Studie, die sich mit der Frage nach dem rechten Maß an Ausbildung zur Sicherstellung einer kapitalistisch brauchbaren Arbeiterschaft sowieso nicht befasst, sondern mit einem Vergleich der Leistungsfähigkeit nationaler Schulsysteme, auf einmal die Antwort geben. Sie tut es: Nach „Pisa“ bekommen die berufsmäßigen Klagen der Unternehmerverbände plötzlich offiziell Recht und die jahrzehntelange Verwahrlosung Jugendlicher durch Schule und Erziehung gilt jetzt als untragbarer nationaler Missstand. Freilich, in Wahrheit liegt das nicht daran, dass die ‚Erkenntnisse‘ der Studie den Zuständigen jetzt plötzlich die Augen geöffnet hätte. Die Studie – von ihrer Art hat es schon mehrere still abgelegte Vorläufer gegeben – bekommt nationales Gewicht und breite Popularität, weil sich die Elite der Nation von ihr eine Frage beantworten lässt, die sie angesichts von Wirtschaftskrise, stagnierenden Arbeitslosenzahlen und der roten Wachstums-Laterne in Europa umtreibt: Was läuft verkehrt in diesem Deutschland? Bei „uns“ hätte das Wachstum zu klappen, auch wenn es sonst überall auf dem Globus kriselt. Und, so die vom nationalen Erfolgsanspruch diktierte Antwort, das würde es gewiss auch, wenn nicht irgendeine Standortbedingung der Nation den Dienst schuldig bliebe. Dank „Pisa“ weiß man welche: Deutsche Schüler lesen und rechnen schlechter als Finnen, Schweden und sogar Amerikaner – da kann aus Deutschland ja nichts werden. Für diese Einsicht muss man das oben angesprochene Verhältnis nur umdrehen und von der Nachfrage nach Arbeitskräften, welche die Unternehmer nach ihren Konjunkturen ausüben, auf die Qualität des Produktionsfaktors schließen, der da – viel zu wenig – nachgefragt wird. Man schließt vom national-kapitalistischen (Miss-)Erfolg auf die (Un-)Brauchbarkeit des dafür eingespannten Menschenmaterials zurück und lastet der Dummheit der Massen die Wachstumsschwäche des Standorts an.
Bildungskrise ist, wenn die Schule für einen Misserfolg des Wirtschaftsstandorts verantwortlich gemacht wird
Diese verkehrte „Erklärung“ der deutschen Misere wird jetzt zur Richtschnur der Kritik an der Institution, die für die Herstellung eines nützlichen Arbeitsvolkes zuständig ist. Die Schule erledigt ihr Geschäft schlecht, wenn sie der Wirtschaft nicht die richtigen Leute liefert. Sie versäumt es, die Jugend an die Anforderungen des Kapitals anzupassen, bereitet sie also schlecht auf das Leben vor – was ja wohl dasselbe ist. Diese Kritik enthält einerseits ein Eingeständnis hinsichtlich der Rolle des Wissens in unserer modernen „Wissensgesellschaft“. Die gnadenlose Gleichsetzung der kapitalistischen Brauchbarkeit der Arbeitskraft mit Bildung rückt ja das eingangs zitierte Selbstbewusstsein der „Wissensgesellschaft“ einigermaßen zurecht: Während man es immer wieder gerne so sieht, dass das Wissen die Leistungsfähigkeit der Bürger definiert, gehen diese Klagen davon aus und halten es für selbstverständlich, dass der vermutete Bedarf des Kapitals definiert, was als Wissen gilt und deshalb Bildungsauftrag der Schule zu sein hat. Zweitens pflegt die Kritik von dieser Selbstverständlichkeit ausgehend allerdings einen ziemlich anmaßenden Idealismus: Sie misst die Leistungen der Schule an den Wachstumserfolgen der Wirtschaft, die diese Erfolge gar nicht herbeiführen kann; und sie sieht dabei geflissentlich darüber hinweg, dass die Funktionalität des von der privaten Benutzung der Arbeitskräfte getrennten öffentlichen Ausbildungswesens für den nationalen Kapitalismus anderer Natur ist. Seine Produktion von Absolventen ist nicht besser oder schlechter, sondern – qualitativ wie quantitativ – gar nicht auf den aktuellen Bedarf des Kapitals bezogen und bedient ihn gerade dadurch.
Schließlich unterrichten die verschiedenen Schulen Kinder und Jugendliche getrennt von den Anforderungen des späteren Arbeits-Einsatzes, der ja noch gar nicht fest steht, in einem eigenen Kanon der Elementar- und Allgemeinbildung. Der ergibt sich aus den grundsätzlichen Kulturtechniken, dem staatsbürgerlichen Moralkodex und Fertigkeiten wie Schreibmaschineschreiben und Computerbedienung, die in mehr oder weniger allen Berufen dazu gehören. Die Schule tut ihren nationalen Dienst, indem sie die Vermittlung auch des bescheidensten Grundwissens nicht übertreibt und nicht etwa darauf besteht, dass kein Zögling die Schulbank verlässt, ehe er nicht wenigstens dieses einwandfrei beherrscht. Sie konfrontiert die Schüler mit ihrem Angebot und sieht zu, wie gut die einzelnen damit fertig werden. Sie bereitet ihre Zöglinge aufs „Leben“ vor, indem sie der „echten“ Konkurrenz des Erwerbslebens eine schulische Konkurrenz um Noten vorschaltet. Und sie bedient dadurch private und staatliche Arbeitgeber mit vorsortierten Jahrgängen junger Menschen, die in Noten und Abschlüssen dokumentieren, wie gut sie sich an den Anforderungen der schulischen Konkurrenz bewähren konnten. Das Ausbildungswesen berücksichtigt dabei den fiskalischen Standpunkt, dass Bildung kostet, Steuerzahler, Wirtschaft und Staatshaushalt belastet, und daher sparsam zu verabreichen ist. Es vermittelt Wissen nach Maß eines funktionalen Minimums und bildet in seinen hierarchischen Stufen grob die Pyramide der Einkommens- und Verantwortungspositionen der Klassengesellschaft nach, der es dient: wenige oben, viele unten. Die Differenzierung ihrer Schüler erzeugt die Institution dadurch, dass sie schlechte Schüler nicht extra fördert, um deren Lücken auszugleichen, sondern sie am durchschnittlichem Tempo und Erfolg des Wissenserwerbs in der Klasse misst, sie daran scheitern lässt und wegen erwiesener Unfähigkeit von weiterer Unterrichtung ausschließt. Mehr Zeit zum Lernen und Studieren gewährt das System denen, die sich dabei von vornherein leichter tun und geschickter anstellen. Der beschränkte Wissensstand der Mehrheit der Schüler ist kein Versagen der Schule, sondern ihr systemkonformes und legitimes Resultat ebenso wie die Herausbildung einer als ‚gebildet‘ anerkannten Schüler-Elite auf der anderen Seite. Beides ist die passende Zubereitung der Jugend für ihre späteren Rollen. Selektion und gestaffelte Ausbildungszeiten versorgen die Wirtschaft national kostengünstig mit Leuten, die zu dem taugen, wofür man sie haben will – und das sogar mehr oder weniger in den richtigen quantitativen Proportionen.
Wenn dann die tatsächliche Benutzung, die das Kapital von den Produkten des Schulsystems macht, dazu führt, dass die Proportionen der Nachfrage durch die davon getrennte, staatliche Ausbildung nicht voll getroffen sind, hagelt es die ungerechte, und zugleich einzig gültige Kritik, die es am kapitalistischen Ausbildungssektor gibt: Er hat zu viele Leute zu weit kommen lassen oder zu wenige; er hat ihnen das Falsche beigebracht oder überhaupt zu viel oder zu wenig; er hat insgesamt zu viel gekostet oder zu wenig Qualität geliefert. Die Pisa-Studie hat ermittelt, dass das Schulwesen hierzulande die Scheidung zwischen den höher Gebildeten und den halben und ganzen Analphabeten radikaler durchführt als anderswo; das kann von seiner Effizienz zeugen oder vom Gegenteil. Erst die Interpretation der Studie aus dem Geist der Unzufriedenheit mit den Leistungen des Standorts ergibt das eindeutige Urteil: Diese Scheidung fällt zu radikal aus, also Schulversagen auf der ganzen Linie.
Blödsinn und politischer Streitwert einer Bildungsdebatte
Soviel steht damit fest: Die Schule hat sich zu ändern.
Bildungspolitiker fordern die Wiederherstellung eines
Entsprechungsverhältnisses, das es nie gegeben hat;
zwischen einem Bedarf des Kapitals nämlich, der überhaupt
nicht feststeht, und einer Nachwuchsproduktion, die sich
ohnehin nicht daran orientiert und nicht daran
orientieren kann. Das – angeblich verletzte –
Entsprechungsverhältnis übersetzen sie in ein immanentes
Versagen der Schule und leiten aus dieser Diagnose
pädagogische Konzepte, Lehrmethoden und Schulformen zu
ihrer Besserung ab. Zuerst wirft man die Frage nach den
Bildungszielen auf: Was will die Gesellschaft vom
Nachwuchs? Es wäre richtiggehend einfach, wenn es nun
hieße: Alle Jugendlichen sollen gescheit Schreiben, Lesen
und Rechnen lernen; da wüssten die Lehrer wenigstens, was
sie zu tun hätten. Aber die Defizite, die „Pisa“
aufdeckt, stehen ja längst für mehr: Der Nachwuchs taugt
nicht für den Konkurrenzerfolg der deutschen Industrie.
Die elementaren Kulturtechniken werden umgedeutet in
allgemeine Schlüssel zum Erfolg und als solche
propagiert; zunächst als Schlüssel des schulischen
Erfolgs: Schreiben und Lesen werden zur
„Schlüsselqualifikation“ für alle anderen Fächer
aufgewertet, „Kompetenz-Kompetenz“ oder „Lernen-Können“
genannt. Dann, der Mensch lernt schließlich für das
Leben, bekennen sich die Nationalpädagogen dazu, dass sie
weniger auf Schreiben und Lesen, sondern überhaupt mehr
auf diese Universalkompetenz als solche abzielen: Sie
drücken, was die Arbeitswelt den ihr Ausgelieferten
zumutet – unbestimmte, schnell wechselnde Anforderungen –
als Fähigkeit aus, mit ihnen zurechtzukommen; und von
dieser schönen Fähigkeit möchten sie bei der Jugend mehr
sehen. Die Schule soll „Problemlösungskompetenz“
vermitteln, d.h. sie zur flexiblen Anpassung an alle
ihnen aufgemachten Anforderungen befähigen. Von da her
sprechen sich einige Bildungspolitiker dann sogar im
Namen dieser methodisch konstruierten „Fähigkeit“
gegen die Vermittlung von Wissen aus, dessen
generelle Defizite die Pisa-Studie, Kronzeuge aller
Klagen, zum Gegenstand hatte. Der Erwerb von
Lösungskompetenz und Lebenstüchtigkeit ist im
Zweifelsfall wichtiger als die Anhäufung von
Quiz-Wissen
(Der Spiegel 20/02,
S.118). Nur für Ratespiele nützlich findet Frau
Schavan, Kompetenzfrau im Stoiber-Team und
Schulministerin in Baden-Württemberg, Wissen für die
Masse der Hauptschüler, ein Luxus, von dem sich die
Schule längst zu viel leistet. Ihr zufolge kommen wir
mit reinem Faktenwissen nicht weiter, wir brauchen die
Bildung von Persönlichkeiten
mit jenen Werten und
Tugenden, die den braven Dienstmann auszeichnen.
Endgültig wird die Leseschwäche zum Resultat und Sinnbild
einer moralischen Schwäche, der die Schule konsequenter
vorzubeugen hätte: Leistungswille, Leistungsorientierung
und Disziplin fehlen der heutigen Jugend: Dass die
‚Kultur der Leistung‘ weniger entwickelt ist als anderswo
auf der Welt, hat offenbar zu den schweren Rückständen
deutscher Schüler im Schreiben und Rechnen beigetragen;
denn gerade diese Kulturtechniken sind ohne Fleiß und
beharrliches Üben nicht zu erlernen.
(Ebd., S.104)
Der zweite Teil der Reformdebatte befasst sich mit den pädagogischen Wegen, mit denen das schöne Ziel zu erreichen wäre. Die Beiträge sind getragen von einem grenzenlosen Manipulationswillen und -wahn: Man muss, so die Vorstellung, nur die richtigen Motivationen setzen, didaktischen Methoden anwenden und schon zeigt die Jugend die erwünschte Reaktion. Der Pluralismus der Beiträge verrät dann wieder, dass von den beschworenen Mechanismen keine Rede sein kann: Soll die Bildungspolitik die erfolgreichen „Pisa“-Länder zum Vorbild nehmen, in denen ein ordentlicher Drill herrscht, oder lieber interessanten Unterricht verordnen? Sollte die Notengebung schon in den ersten Schuljahren beginnen, damit sich die Schüler an die Leistungsgesellschaft und ihre Niederlagen besser gewöhnen, oder lieber erst später, damit der kindliche Wissensdrang nicht zu früh frustriert wird? Sind Gesamtschulen geeigneter, die Breite eines Jahrgangs zu mehr Leistung zu bringen, oder kann gerade das dreigliedrige System der südlichen Bundesländer jeden auf seinem Niveau besser fordern? Sollten Ganztagesschulen die Kinder länger unter Kontrolle ihrer Lehrer halten; oder sollten lieber ins Schulleben eingebundene Eltern das häusliche Lernumfeld verbessern? Sollte die Politik die Schulen und die Leistungen der Schüler strenger an einem bundesweit einheitlichen Maßstab kontrollieren, oder ihnen mehr Raum zur Gestaltung einer attraktiven Schulidentität lassen? Alle diskutierten „Methoden“ lassen erkennen, dass sie den Umgang der Institution mit Desinteresse und Unwillen der Schüler zu optimieren trachten. Dass die Schule mit ihrer Selektion selbst das größte Hindernis für die Wissensvermittlung ist, kommt dabei sogar vor, gilt aber natürlich nicht als Einwand. Diese Leistung der Schule für die Gesellschaft ist unverzichtbar.
Die Debatte um Techniken der Lenkung und Führung, mit denen der Jugend mehr Leistung entlockt werden soll, kommt so auf ihren Kern: die nationale Führungsfrage, die im Wahlkampf ausgefochten wird. Für den bayrischen Herausforderer beweist „Pisa“ ein Führungsversagen der SPD und die Schädlichkeit ihrer Werte. Er sieht eine linke „Schmusepädagogik“ und einen vermeintlich antiautoritären Erziehungsstil durch den internationalen Leistungsvergleich bloßgestellt, die konservativen Werte – ‚Leistungsorientierung‘, ‚Disziplin‘ – und die in Bayern übliche strikte Trennung der ‚Dummen‘ von den ‚Gescheiten‘ schon nach vier Klassen umgekehrt glänzend bestätigt: Bayrische Schüler bringen auf allen Niveaus mehr Leistung. Die SPD-regierten Bundesländer reden den bayrischen Pisa-Vorsprung klein und legen den Finger auf das schlechte Anschneiden aller deutschen Regionen etwa im Verhältnis zu den Skandinaviern. Der Kanzler verteidigt nichts, sondern beweist Tatkraft bei der Korrektur der Fehlentwicklungen: Er wirft schnell mal 4 Mrd. Euro für die Einrichtung von Ganztagesschulen in den „sozialen Brennpunkten“ einiger Großstädte aus, die von der christlichen Opposition umgehend als Angriff auf ihre Kulturhoheit zurückgewiesen werden. Das führt zu Streit über einen noch höheren deutschen Wert: Ist der Föderalismus in Sache Unterricht und Kultus das größte Hindernis einer gescheiten Bildungspolitik, oder ist er die Voraussetzung eines fruchtbaren Bildungswettbewerbs, wie die CDU ihn haben will?
Das kommt heraus, wenn die politischen Führungsfiguren an Lesen und Schreiben den nationalökonomischen Erfolg thematisieren und sich dabei Versagen vorwerfen. Die Frage, ob die Schüler genug und das Richtige lernen, löst sich voll auf in die grundsätzlichere, wie das Volk anzupacken, zu erziehen, und zu führen sei. Das umso mehr, als Deutschland ja gar kein Problem mit seiner Bildungselite, ihrem Ausbildungsstand und ihrer Leistungsfähigkeit hat, sondern den Bodensatz der Bildungs- und Berufshierarchie bezichtigt, dem Vaterland die fällige Leistung schuldig zu bleiben. Die Bewerber um die politischen Führungsposten streiten vor dem Volk darüber, wie es besser auf die ihm gebührenden Dienste an Wirtschaft und Staat zu verpflichten und zu höherer Leistung zu kommandieren sei. Und das Volk darf wählen, welchem Führer es lieber folgen will. Für diese Entscheidung liefern ihm die Konkurrenten mit ihrer Bildungsdebatte Hilfestellung.
Kein Wunder, dass dieses Wahlkampfthema bald vom Hochwasser und den Vorschlägen der Hartz-Kommission zur ‚Bekämpfung der Arbeitslosigkeit‘ verdrängt wird. Das sind schließlich die öffentlich ausgemachten aktuellen Standortprobleme, die schon wieder und nach allgemeiner Auffassung noch viel dringlicher nach entschiedener Führung verlangen.
[1] Von einem allgemeinen Überfluss an Qualifizierten geht die bis gestern gültige Kritik am Bildungssystem aus: Es hat zu viele nicht nachgefragte Absolventen produziert; zu viele, also Unwürdige, die Prüfungen bestehen lassen. Verstärktes Aussieben wurde verlangt und erzwungen dadurch, dass man die Bildungseinrichtungen ein Jahrzehnt lang finanziell ausgetrocknet hat. So wurde bisher für Preiswürdigkeit und Leistung der Sphäre gesorgt.
[2] Das hindert die Unternehmerverbände natürlich nicht daran, genau in diesem Sinn Klage zu führen – besonders, wenn sie von der Politik eine Liberalisierung der Einwanderung fordern, die ihnen das bequeme Überangebot am Arbeitsmarkt permanent sichern soll. Zum Beweis, dass die vorhandenen Arbeitslosen für ihren Bedarf nicht taugen, berichten sie, ihre Mitgliedsfirmen könnten trotz der vier Millionen Unbeschäftigter eine Million offene Stellen nicht besetzen. Die Milchmädchenrechnung, 4-1 müsste 3 ergeben, abstrahiert von allen realen Einstellungsbedingungen: sowohl von der Zeit, die es braucht, bis ein Bewerber gefunden und eingestellt ist – es sind ja nicht dieselben, dauerhaft unbesetzten Stellen, die monatlich zur Million zusammengezählt werden –; wie auch von dem Ort, an dem der Job, und dem Ort, an dem der geeignete Arbeitslose sich befindet, die sich eben nur im nationalen Rechenraum treffen. Vor allem abstrahieren die Herren Unternehmer bei ihrer Klage über fehlende, geeignete Bewerber schließlich davon, was sie selbst zu zahlen bereit sind. Je nach der Forderung, die sie an die Politik richten, variieren ihre Vertreter das Thema virtuos. Solange es ums Einwanderungsgesetz ging, konnte die Zahl der Stellen, die man angeblich nicht besetzen konnte, gar nicht groß genug ausfallen; seitdem die SPD-Regierung die Beschleunigung der Vermittlung von Arbeitslosen zu einem der Reformprojekte erkoren hat, die ihr die Wahl retten sollen, zweifelt BDI -Präsident Rogowski an der Existenz der vorher frech verkündeten Million offener Stellen: Vermittlung bringt’s nicht, es braucht Wachstumsimpulse „für mehr Arbeitsplätze“ – und das wären: allgemeine Lohn- und Steuersenkungen zugunsten des Kapitals.