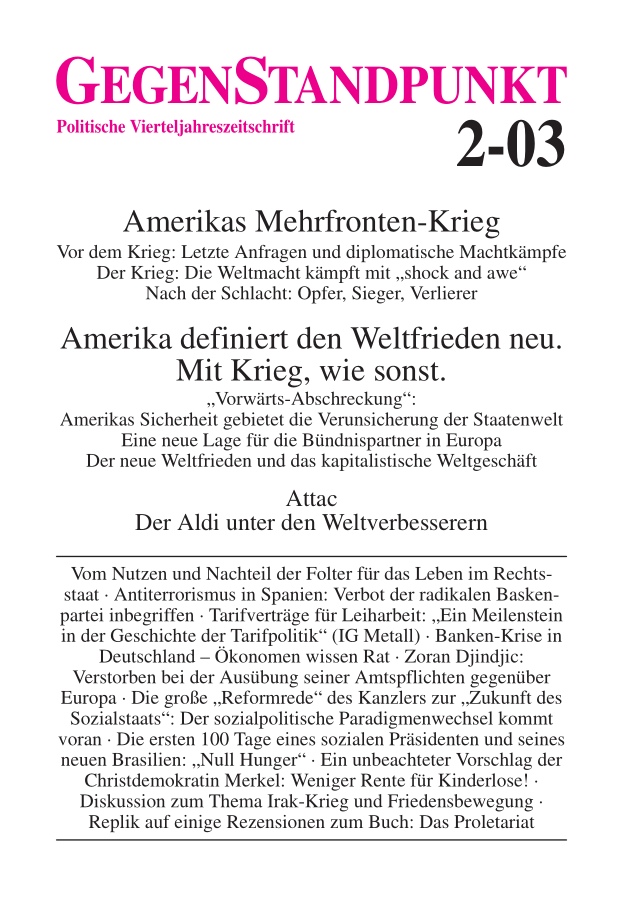Amerika definiert den Weltfrieden neu. Mit Krieg, wie sonst.
Dem Krieg der USA gegen den Irak ist ein gewisser Aufklärungswert nicht abzusprechen. Er klärt darüber auf, wie bedingt die Bereitschaft der weltgrößten Militärmacht ist, ihre Bomber im Hangar, ihre intelligenten Waffen im Depot und ihre Soldaten zu Hause zu lassen: Frieden ist, soweit es an Amerika liegt, kein Zustand, sondern der bedingt positive Ausgang einer Prüfung, der die Weltmacht den Rest der Staatenwelt beständig und stets von neuem unterzieht: einer Überprüfung der amtierenden Gewalten auf ein hinreichendes politisches Wohlverhalten, das es den USA ermöglicht, auf Krieg zu verzichten und friedlich zu bleiben.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. „Vorwärts-Abschreckung“: Amerikas Sicherheit gebietet die Verunsicherung der Staatenwelt
- II. Eine neue Lage für die Bündnispartner in Europa: Vor- und Nachteilsrechnungen zwischen pro-amerikanischer Entschlossenheit und amerika-kritischer Distanz
- 1. Die ‚neue NATO‘: Eindeutige Klarstellungen zum Thema ‚Partners in Leadership‘
- 2. Die Antwort der Führungsmächte des ‚alten Europa‘: Notprogramme zur Kompensation des Wegfalls der eigenen imperialistischen Geschäftsgrundlage
- 3. Das ‚neue Europa‘: Kleine Rückschritte im gesamteuropäischen Einigungswerk
- 4. Innere Zerwürfnisse bei den NATO-Partnern in Europa
- 5. Trotz und wegen alledem: „Die Verbesserung der transatlantischen Beziehungen“ tut dringend Not
- III. Der neue Weltfrieden und das kapitalistische Weltgeschäft: Die Grundlagen der imperialistischen Konkurrenz werden zweifelhaft
- 1. Die Neubestimmung des Verhältnisses von politischer Beaufsichtigung und kapitalistischer Benutzung der Staatenwelt
- 2. „Sorgen“ und „Befürchtungen“ in Sachen „Zukunft der Weltwirtschaft“ – und der materielle Grund, der zu ihnen Anlass gibt
- 3. Wenn Amerika der ganzen Welt misstraut: Womit verdient es dann noch Vertrauen?
Amerika definiert den Weltfrieden neu. Mit Krieg, wie sonst.
Dem Krieg der USA gegen den Irak ist ein gewisser Aufklärungswert nicht abzusprechen. Er klärt darüber auf, wie bedingt die Bereitschaft der weltgrößten Militärmacht ist, ihre Bomber im Hangar, ihre intelligenten Waffen im Depot und ihre Soldaten zu Hause zu lassen: Amerika hat zwar eine Menge Geduld mit anderen Staaten und damit, wie deren Regierungen sich aufführen; aber diese Geduld hat Grenzen. Und daraus ließe sich zumindest so viel lernen: Frieden ist, soweit es an Amerika liegt, kein Zustand, sondern der bedingt positive Ausgang einer Prüfung, der die Weltmacht den Rest der Staatenwelt beständig und stets von neuem unterzieht: einer Überprüfung der amtierenden Gewalten auf ein hinreichendes politisches Wohlverhalten, das es den USA ermöglicht, auf Krieg zu verzichten und friedlich zu bleiben. Was man heutzutage Weltfrieden nennt, verdankt die Menschheit deswegen überhaupt der einzig „übriggebliebenen“ Supermacht. Denn nur die ist in der Lage, mit jedem Land auf der Welt, egal wo es liegt, die Geduld zu verlieren und das Wohlverhalten zu erzwingen, mit dem sie sich dann wieder einstweilen zufrieden geben kann – und genau das ist die heute gültige Definition der Idylle namens Weltfrieden.
Für die, die es angeht, hat Bushs Irakkrieg jedoch vor allem einen hohen Informationswert. Er setzt nämlich die Staatenwelt, von deren Wohlverhalten Amerika seine Bereitschaft, friedlich zu bleiben, abhängig macht, davon in Kenntnis, wo derzeit und demnächst die Grenzen amerikanischer Geduld mit den anderen Gewalthabern auf dem Globus verlaufen. Der Krieg ist in dieser Frage die einzige verlässliche Informationsquelle; nicht nur, weil die Adressaten keine andere Sprache als die der Gewalt verstehen, sondern vor allem, weil der Garant des Weltfriedens sich in gar keiner anderen auszudrücken weiß – und einiges Neue mitzuteilen hat. Das scheinen die Teilhaber des amerikanischen Weltfriedens, große wie kleine und willige wie widerwillige, auch kapiert zu haben. Zwischen denen und der Supermacht ist jedenfalls der entsprechende Informationsaustausch in Gang gekommen: ein Ringen um die Auslegung der von den USA geltend gemachten neuen friedenssichernden Wohlverhaltensklauseln.
Die demokratische Weltöffentlichkeit in ihren verschiedenen nationalen Abteilungen strengt sich sehr an, diesen Dialog der souveränen Gewalten verständlich zu verdolmetschen. Vor lauter über-parteilichem Verantwortungsbewusstsein für eine Zukunft des Weltfriedens, in der die jeweils eigene Nation die ihr gebührende Rolle spielt, gerät den engagierten Meinungsbildnern ihre Interpretation des Irakkriegs und seiner Folgen allerdings zielsicher so verständnisvoll, dass der Aufklärungswert der Sache dabei auf der Strecke bleibt. Um den bemüht sich der folgende Artikel.
I. „Vorwärts-Abschreckung“: Amerikas Sicherheit gebietet die Verunsicherung der Staatenwelt
1. Der Irak-Krieg der USA: Paradigma für „die Kriege des 21. Jahrhunderts“
Ein erstes Exempel für die Kriege des neuen – post-kommunistischen – Jahrhunderts soll, dem erklärten Willen des Veranstalters zufolge, derjenige der USA und ihrer Alliierten gegen das Regime des Saddam Hussein im Irak gewesen sein; er soll neue Maßstäbe für den Weltfrieden und dessen Sicherung setzen. Das tut er in mehrerlei Hinsicht.
- Kriegsgrund, und zwar nicht bloß Amerikas hauseigener Grund für allfällige kriegerische Unternehmungen, sondern einzig zulässiger, aber auch allgemein verpflichtender Grund für die Anwendung militärischer Gewalt gegen ein Land, ist jeder Fall einer drohenden, erst recht natürlich einer schon eingetretenen Verbindung zwischen einem gegen die USA und ihre Verbündeten gerichteten terroristischen Willen und einer bedrohlichen Waffentechnik, den berüchtigten „Weapons of Mass Destruction“. Ob, wann und wo ein solcher Fall vorliegt und welche Art kriegerischen Eingreifens er nötig macht, das entscheidet – „naturgemäß“, nämlich gemäß der Eigenart dieses Kriegsgrundes – die US-Regierung: Anders als durch deren „pflichtgemäßes Ermessen“, gestützt auf ein politisch vereinbartes internationales Kontrollregime zur Verhinderung der „Proliferation“ Besorgnis erregender Waffentechnologien sowie vor allem auf geheimdienstliche „Erkenntnisse“ über nationale Rüstungsanstrengungen und antiamerikanische Umtriebe, ist überhaupt nicht zu „ermitteln“, wo ein USA-feindlicher Standpunkt terroristisch oder ein Terrorismus dezidiert USA-feindlich wird und ein Bedrohungspotential entwickeln könnte, das einen präventiven „Erstschlag“ nötig macht. Auf die vorsorglich vorausschauende Lageeinschätzung der US-Administration kommt es da noch ganz anders an als bei den von Amerika initiierten Weltordnungs-Kriegen des zurückliegenden halben Jahrhunderts, den von „Stellvertretern“ oder amerikanischen Streitkräften selbst unternommenen Militäraktionen zur „Eindämmung des Kommunismus“. Da stand immerhin die antisowjetische Stoßrichtung aller von den USA initiierten Unternehmungen von vornherein fest, also ein bestimmter Staatenblock als eigentlicher Feind und die pro-sowjetische Parteinahme einer Regierung oder auch der politische Erfolg einer allzu „sozialistischen“ Opposition und eine entsprechende Einflussnahme Moskaus als zwar nicht zwingender, aber allemal hinreichender Grund für ein sachgerecht dosiertes gewaltsames Eingreifen. Von einer so klaren, vorweg feststehenden Sortierung der Welt, nämlich an der weltpolitischen Frontlinie zwischen kapitalistischem „Westen“ und „sozialistischem Lager“ entlang, aus der alle bewaffneten Konflikte sich entweder herleiteten oder der sie jedenfalls allesamt alsbald subsumiert wurden, kann beim großen amerikanischen Jahrhundertkrieg gegen „den Terrorismus“ nicht die Rede sein. Der nimmt als Feind Gruppierungen und Regierungen ins Visier, die sich nicht einer falschen System-Entscheidung schuldig, sondern der Urheberschaft oder der Unterstützung antiamerikanischer Aktivitäten sowie des Bemühens um Aufrüstung mit „Massenvernichtungswaffen“ verdächtig machen; wobei die USA es erklärtermaßen gar nicht erst so weit kommen lassen wollen, dass die nicht hinzunehmende Bedrohung schon eingetreten und allgemein zweifelsfrei erkennbar ist, bevor sie zuschlagen. Die Entscheidungshoheit der Regierung in Washington über seine Feststellung gehört daher zum Kriegsgrund des 21. Jahrhunderts hinzu.
- Kriegsziel ist die Vernichtung antiamerikanischer Terror-Gruppen sowie die Auswechslung der Herrschaft in einem verdächtigen Staatswesen; das eine wie das andere nicht mehr, wie zu Zeiten des antisowjetischen „kalten Krieges“ noch die Regel, in der indirekten Form einer – nur im Bedarfsfall zunehmend offenen – Unterstützung einheimischer pro-amerikanischer Kräfte; erst recht ohne Rücksicht auf den Anschein nationaler Souveränität, der früher gerne gegen den bekennenden „Internationalismus“ der Kommunisten und gegen die Einmischungsversuche der Sowjetunion in Anschlag gebracht wurde. Kriege des neuen Typs sollen als direktes oberhoheitliches Eingreifen der Weltmacht erkennbar sein; und sie sind erst zu Ende, wenn Amerika ein Besatzungsregime – oder, wie im Fall Afghanistans, ein für die Verfolgung terroristischer Kräfte hinreichendes Äquivalent dafür – und eine einheimische Regierung als verlängerten Arm seiner „Terrorismus“-Abwehr installiert hat.
- Kriegsmittel ist die Verknüpfung vollständiger Aufklärung und Kontrolle des Kriegsgebiets – aus dem Weltraum, aus der Luft sowie mit einem Heer eigener, auch auf privatwirtschaftlicher Basis agierender und mit Aufträgen betrauter Agenten – mit dem Aufgebot einer Streitmacht, die als erstes die absolute Lufthoheit herstellt, dann jeden Widerstand niederwalzt und auf die Weise zuverlässig verhindert, dass es auch nur phasenweise zu einem Kräftemessen mit unentschiedenem Ausgang kommt. Dafür darf die Lage des Schauplatzes ebensowenig zum Hindernis werden wie seine Entfernung von der amerikanischen Heimat. Zum Kriegsarsenal des neuen Jahrhunderts gehören deswegen Langstreckenbomber ebenso wie schwimmende Stützpunkte, die jederzeit und überall auf den Weltmeeren für eine Zusammenballung militärischer Schlagkraft gut sind, der nur wenige Staaten etwas Gleichrangiges entgegenzusetzen hätten – zur Rückversicherung gegen mögliche Gegner dieses Kalibers bleiben die Atomwaffen des kostenlos gewonnenen 3. Weltkriegs gegen die Sowjetunion teils im Dienst, teils in Reserve. Zur Logistik des antiterroristischen Jahrhundert-Feldzugs gehören außerdem feste Stützpunkte und Länder, von denen aus die Entmachtung feindseliger Regime und nötigenfalls die Besetzung ihrer Länder problemlos bewerkstelligt werden kann; also nicht mehr ein eiserner Ring von fixen Bündnispartnern um ein feststehendes „Reich des Bösen“ von kontinentalen Ausmaßen herum, die dessen „containment“ garantieren und Optionen für präventive „Erstschläge“ und „Gegen“-Angriffe eröffnen; stattdessen ein universales Netz von kleineren und größeren Herrschaften, die ihr Gebiet bereitwillig für den raschen „Aufwuchs“ einer jedem Nachbarn überlegenen amerikanischen Streitmacht zur Verfügung stellen und auch mit eigenen, wie auch immer bescheidenen Kräften dabei mithelfen.
- Das Subjekt der Kriegführung steht damit auch schon fest; und dafür hat der Krieg gegen das Regime des Saddam Hussein schon vor seinem Beginn das geltende Paradigma geschaffen: Während Teile der Staatenwelt sich mit der US-Regierung noch diplomatisch herumstreiten, ob deren Unternehmen im Irak überhaupt in Ordnung geht und gebilligt werden kann, setzt die Weltmacht längst Fakten: bringt ihre Gewaltmittel in Stellung, sammelt an der UNO und allen überkommenen eigenen Bündnissen vorbei Alliierte ein, nicht zuletzt in Osteuropa, nutzt nach Bedarf deren Landeplätze, nimmt sich Überflugrechte für ihre Luftwaffe und Durchfahrtsrechte für ihre Marine heraus. Während die Welt sich noch fragt, ob ein Krieg gegen den Irak im Sinne der von Amerika geltend gemachten Kriegsgründe überhaupt notwendig ist, und mehrheitlich zu einem ‚Nein‘ tendiert, zerschlagen amerikanische Bomber das irakische Militär, vertreiben alliierte Truppen gemäß den Vormarschplänen des Pentagon die irakische Regierung, und die USA etablieren sich als alles beherrschende „Regionalmacht“ am Golf. Kriegführung im neuen Jahrhundert ist, wie man daran studieren kann und lernen soll, allein und einseitig Amerikas Sache; der Rest der Welt wird dafür beansprucht, ohne groß konsultiert, geschweige denn an den fälligen Entscheidungen beteiligt zu werden. Die Weltmacht praktiziert ihre Strategie der „Vorwärts-Abschreckung“ – „Deter forward“ – gegen von ihr definierte Feinde, lässt den anderen Souveränen nur die Wahl zwischen Abseitsstehen und Mitmachen, gesteht aber auch ihren Alliierten keinen mitbestimmenden Einfluss zu. Und – auch und vor allem dafür soll der Irak-Krieg exemplarisch sein! – sie konfrontiert die Staatenwelt mit einem Sieg, der die Unanfechtbarkeit ihrer Vorgehensweise beweist und damit die Allgemeingültigkeit ihrer Strategie für das 21. Jahrhundert beglaubigt.
Vom Standpunkt der USA aus ist das alles nicht mehr als die freilich bitter nötige, eigentlich schon überfällige Anpassung ihrer herkömmlichen globalen Sicherheitspolitik an die neue Bedrohungslage, die im Wesentlichen durch einen Vorteil und einen Nachteil gekennzeichnet ist: Das „Reich des Guten“ und „Land der Freien“ hat es nicht mehr mit einem kompakten Staatenblock zu tun, der über enorm viel Raum, über Atomraketen und über eine fortschrittliche Rüstungsindustrie verfügt; der neue Feind ist insofern schwach, andererseits aber auch nicht so erpressbar und berechenbar wie die vor allem um ihre Selbsterhaltung besorgte Sowjetmacht; er kann die USA nicht wirklich existenziell bedrohen wie die Sowjetunion mit ihrer „Zweitschlags-Kapazität“, ist dafür aber, anders als deren Führung, bereit, mit seinen beschränkten Mitteln auch tatsächlich zuzuschlagen, und würde dies nach regierungsamtlicher Einschätzung auch mit „Massenvernichtungswaffen“ tun, wenn er sie hätte. Die US-Regierung selber stellt diesen Vergleich an – der völlig abseitig wäre, wenn er nicht von der Weltmacht selber in praktischer Absicht vorgenommen würde –, wenn sie „Terrorismus“ und Antiamerikanismus zum neuen globalen Hauptfeind, den Kampf dagegen zur obersten, die Staatenwelt insgesamt verpflichtenden sicherheitspolitischen Notwendigkeit erklärt. Und indem sie ihre Sicherheitspolitik und ihren strategischen Bezug auf den Globus, ihre Rüstung und ihre Diplomatie im Sinne ihrer neuen Lagedefinition korrigiert und – nach dem Vorspiel in Afghanistan – mit einem weiteren Krieg unter Beweis stellt, wie entschieden und wie kompromisslos sie Amerikas gesamte Militärmacht auf die neuen Prioritäten umstellt, stellt sie die Staatenwelt tatsächlich vor eine neue „Lage“, die deren Mitglieder – je nach dem, wie sie darin vorkommen – zur Anpassung zwingt.
- An die Staaten, deren Regierungen ein Bemühen um „Massenvernichtungswaffen“ sowie Kollaboration mit „dem Terrorismus“ vorgeworfen wird – Amerikas
Schurkenstaaten
–, ergeht mit dem irakischen Präzedenzfall eine Kriegserklärung auf Vorrat: ein – einstweilen nicht befristetes – Ultimatum, sich einem durchgreifenden amerikanischen Rüstungskontrollregime zu unterwerfen, das sich vor allem auch auf nationale Kernenergieprogramme erstreckt – dass die tatsächlich ziviler Natur sein könnten, wird grundsätzlich nicht geglaubt, deren Überwachung daher auch nicht der dafür zuständigen internationalen Agentur in Wien überlassen. Außerdem müssen sie nicht bloß bei der Fahndung nach potentiellen antiamerikanischen Übeltätern kooperieren: Um sich gegen ihre gewaltsame Entmachtung abzusichern, müssen diese Regierungen ihre gesamte Politik auf die Bedienung amerikanischer Kontrollbedürfnisse und Interessen umorientieren und dies durch die Preisgabe ihrer bisherigen nationalen Generallinie – eines Allah gefälligen Gemeinwesens im Iran, einer „Wiedergeburt“ arabischer Autonomie und Größe im „Fall“ Syrien, einer national-koreanischen Eigenständigkeit mit staatlicher „Planwirtschaft“ im Fall Nordkoreas, eines lateinamerikanischen Drittwelt-Sozialismus in Kuba – beweisen. Dabei ist längst mehr oder weniger klar, dass dieser Beweis nur durch die Abdankung oder Beseitigung des regierenden Personals zu erbringen ist. - An eine unbestimmte Anzahl von
Problemstaaten
– eine Liste, die angeblich vor einem Jahr dem deutschen Außenminister in Washington gezeigt worden ist, soll ca. 60 Kandidaten umfasst haben – richtet die US-Regierung mit ihrem ersten „Krieg des 21. Jahrhunderts“ die gleiche Aufforderung in weniger dramatischer Form und vorläufig ohne eine auf einen Machtwechsel zielende Anklage gegen die Regierenden: Die sollen „good governance“ praktizieren, also vor allem erst gar nicht versuchen, das Gebot der Selbstbeschränkung auf Rüstungsgüter, die Amerika als für sich und seine Interessen ungefährlich einstuft, zu umgehen; einer entsprechenden Kontrolle durch die Fahndungsdienste der USA unterliegen auch sie. Außerdem haben die einen den Verdacht auf Sympathien mit „Terrororganisationen“ tatkräftig auszuräumen, die anderen eine innere Ordnung herzustellen, die solchen Gruppierungen ihre Existenzbedingungen nimmt – wie auch immer das gehen soll in den vielen Fällen, zu denen die imperialistische Weltordnung es mittlerweile gebracht hat, in denen von einem politischen Gewaltmonopol und einer von oben durchgesetzten gesellschaftlichen „Ordnung“ nicht so recht die Rede sein kann. Für die US-Regierung sind das jedenfalls die Mindestanforderungen, denen „problematische“ Staaten genügen müssen. Diese Bedingungen lösen den nicht mehr aktuellen Test auf Antikommunismus und Sowjet-Feindschaft ab, der in vergangenen Jahrzehnten mit materieller Unterstützung für den Unterhalt einer in diesem Sinne aktionsfähigen Herrschaft und bisweilen sogar mit Zuschüssen für ein halbwegs funktionierendes nationales Wirtschaftsleben verbunden war. An die Stelle solcher „Entwicklungshilfe“ tritt in etlichen Fällen jetzt die Unterweisung einheimischer Truppen durch US-Spezialisten im Ausrotten von „Terroristen“ – was gegenüber der Eliminierung Kommunismus-verdächtiger Umtriebe freilich keine große Umstellung sein dürfte. - Entsprechendes gilt für die vielen
Drittstaaten
, die der US-Regierung einstweilen keine besonderen Sorgen machen, allerdings jederzeit auf die Liste der „problematischen“ Kandidaten geraten können. In Amerikas politökonomischer Weltordnung sind sie alle je nach dem, was sie dem globalen Kapitalismus zu bieten haben, auf so interessante „Identitäten“ wie „kleiner Tiger“, „Schwellenland“, „emerging market“, „Öllieferant“, „Rohstoffland“, „Schuldenstaat“ oder auch „Highly Indepted Poor Country“ festgelegt. Doch wie schon zu Zeiten des „kalten“ Weltkriegs gegen das Sowjetsystem und den „Weltkommunismus“ ist auch im 21. Jahrhundert das politökonomische Urteil nicht das letzte Wort über die „Natur“ dieser Länder, ihren Stellenwert im System der freiheitlichen Weltherrschaft und die Kontrolle, die sie sich gefallen lassen müssen. Der letztlich entscheidende Anspruch, dem sie genügen müssen, ist – so wie einst ein solider Antikommunismus – entgegenkommende Dienstbarkeit für den Bedarf der USA an Logistik und Helfershelfern für jederzeit und überall möglicherweise fällige Feldzüge gegen „Schurkenstaaten“ und „Terrorgruppen“. Denn solche Unternehmungen sind das Mittel, mit dem die amerikanische Staatsmacht im neuen Jahrhundert für die Sicherheit sorgt, die sie sich, ihren Verbündeten und nicht zuletzt ihrer weltweit engagierten und konkurrierenden Geschäftswelt schuldet. - Mit Fügsamkeit dieser Art ist es bei den – wenigen – Staaten nicht getan, die die Strategen in Washington zu den
geostrategischen Akteuren
rechnen: den seit langem verbündeten, den ehemals feindlichen und den früher als „blockfrei“ eingruppierten Mächten, die die Fähigkeit und – zumindest potentiell und nach amerikanischer Einschätzung schon damit irgendwie auch wirklich – den politischen Willen besitzen, konkurrierende oder sogar widerstreitende Interessen, Sicherheitsbedürfnisse, Ordnungsvorstellungen sowie entsprechende Ansprüche an „dritte“ Staaten zu entwickeln und nach eigenem Ermessen Freund- und Feindschaften zu pflegen. Hier sind Amerikas Forderungen anderer Art und reichen um so weiter, je enger die Bündnispartnerschaft aus vergangenen Tagen noch ist. Als erstes ergeht natürlich auch an alle diese Mächte mit dem Krieg gegen den Irak, und zwar schon in der Phase seiner Vorbereitung, die Einladung und an die alten Verbündeten die dringliche Aufforderung, als gutwillige Alliierte alle militärischen Unternehmungen zu billigen und zu unterstützen, die die US-Regierung auf die Tagesordnung setzt – schließlich sichert sie damit nach ihrer eigenen Definition der Weltlage den Frieden, den auch alle anderen kapitalistischen Nationen brauchen und von dem sie Gebrauch machen, wenn sie im Weltgeschäft mitmischen. Das bedeutet natürlich umgekehrt, dass man in Washington überhaupt kein Verständnis dafür hat, wenn solche rivalisierenden Mächte und erst recht alte Verbündete sich dem gerechten Anspruch auf Mitwirkung und Hilfsdienste entziehen oder gar gegen die fällige Etappe im Weltkrieg gegen „den Terrorismus“ opponieren. Damit werden sie nicht gerade zum Kontrollfall wie die minder bemittelten Drittstaaten; vielmehr verlieren sie jedes Recht an dem Kriegsergebnis mitzuwirken, das Amerika gegen ihren Widerstand herzustellen genötigt ist. Diese Zurück- und Zurechtweisung bezieht sich zudem keineswegs bloß auf ihren Wunsch, sich nach dem von den USA und deren willigen Alliierten erfochtenen Sieg in die Nachkriegsordnung wieder einzunisten, womöglich auf deren Gestaltung Einfluss zu nehmen: Mit der Entmachtung des Saddam-Regimes und der Okkupation des Irak führen die USA allen verbündeten und rivalisierenden Mächten ihren unerbittlichen Willen und ihre unwiderstehliche Fähigkeit vor Augen, ohne jede Rücksicht auf konkurrierende Interessen „dritte“ Staaten ihrem Sicherheitsbedürfnis gefügig zu machen und so auch alle Beziehungen, Abhängigkeiten und „Partnerschaften“ gewaltsam zu zerschlagen, die ein anderer „geostrategischer Akteur“ zu einem Staat unterhält, sobald sie diesen Staat zum „Schurken“ erklärt haben. Mit einem solchen Schlag in ihr imperialistisches Kontor müssen alle Konkurrenten rechnen – so wie sie umgekehrt, dafür steht der „Fall“ Israel, jede Hoffnung begraben können, auf irgendeine Staatsgewalt wirksam Druck auszuüben, die die USA unter ihre Obhut gestellt haben. Sie sollten sich daher auf alle Fälle und vor allem davor hüten, sich mit von Washington geächteten Souveränen gemein zu machen. Wer mit solchen Ländern mehr als die dürftigsten Geschäftskontakte unterhält, muss nicht bloß unfreundliche Reaktionen der Weltmacht, sondern in letzter Instanz die Liquidierung seines Geschäftspartners einkalkulieren; wer Gerätschaften dorthin liefert, die auf Washingtons „Dual-use“-Liste stehen, solche zur Atomenergiegewinnung insbesondere, oder gar Waffen, der wird nicht bloß diplomatisch unter Druck gesetzt, sondern muss auf eine gewaltsame Intervention als „Präventivmaßnahme“ gegen potentielle Sicherheitsprobleme gefasst sein. Alle Mächte, die Amerika als „strategische Akteure“ ernst nimmt, sind damit nicht bloß zu einiger Vorsicht bei ihrem Bemühen um weltpolitischen Einfluss, sondern mit allem Nachdruck dazu aufgefordert, sich tatkräftig an allen Sanktionen zu beteiligen, die die Regierung in Washington nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen und gegebenenfalls auch ohne vorherige Billigung durch die „Völkergemeinschaft“ gegen einen „Schurkenstaat“ verhängt. Auch sonst in ihrer Weltpolitik müssen imperialistisch ambitionierte Nationen aber davon ausgehen, dass die Staatenwelt überhaupt nicht mehr „frei“ ist – „frei“ in dem Sinn, dass sie jedem tat- und finanzkräftigen Interesse und jedem konkurrierenden Zugriff offen stünde. Noch ehe sie selber mit ihren Angeboten und Ansinnen auf fremde Regierungen losgehen, sind diese bereits, jedenfalls in den Grundfragen ihres Gewaltgebrauchs, mit Beschlag belegt: Amerika hat ihnen bereits die Prioritäten ihrer Politik verbindlich vorgegeben. Um die Respektierung dieser politischen Prämissen: des Regimes der Nicht-Weiterverbreitung von allem, was Washington gerade als „Massenvernichtungswaffe“ ächtet, sowie der Beihilfe im Kampf gegen „den Terrorismus“, gleichfalls nach Maßgabe der amerikanischen Definition, die sich mit den Sorgen und Interessen anderer Mächte überhaupt nicht deckt, kommen daher auch Amerikas Rivalen nicht herum. Der Irak-Krieg konfrontiert sie jedenfalls mit der Nötigung, die von der US-Regierung erlassenen Imperative als Prämissen ihrer eigenen Beziehungen zu „dritten“ Staaten praktisch anzuerkennen – und so mit durchsetzen zu helfen. Davon, dass sie in ihrer internen Ordnungspolitik nicht nur brutal, sondern auch erfolgreich gegen alle Gruppierungen vorgehen, deren Aktivitäten gegen Amerika und folglich gegen ihre guten Beziehungen zur Weltmacht gerichtet sind, geht die US-Regierung ohnehin aus; im Gegenzug ist sie immerhin zu Verhandlungen darüber bereit, terroristische Staatsfeinde, derer ihr jeweiliger Partner sich zu erwehren hat, auf ihre eigene, weltweit maßgebliche Liste der verbotenen Organisationen zu setzen – oder wenigstens nicht auch noch zu unterstützen…
So bietet Amerikas neue Strategie der „Vorwärts-Abschreckung“ allen Nationen eine neue Chance – nämlich im Wesentlichen die, dabei in der einen oder anderen untergeordneten Funktion mitzumachen, um einer Ausgrenzung aus dem Beziehungsgefüge zu entgehen, das die USA mit ihren den „Kriegen des 21. Jahrhunderts“ gewidmeten Allianzen so nach und nach einrichten. In allen anderen Hinsichten stiftet die antiterroristische Sicherheitspolitik der USA für alle anderen Nationen Unsicherheit: Existenzunsicherheit für die kleine radikale Minderheit der bereits ausgesuchten „Schurkenstaaten“; Verunsicherung bei allen übrigen „dritten“ Staaten, denen als Punkt 1 ihrer politischen Agenda ein Dienst an Amerikas Kontrollbedürfnissen aufgenötigt wird, der ihnen selber nichts nützt, eher ihre inneren Verhältnisse noch zusätzlich aufmischt. Und die „geopolitisch aktiven“ Rivalen der USA werden in aller Härte mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre an eigenen Interessen und Ordnungsvorstellungen orientierte Teilhabe am Weltgeschehen von der Weltmacht als ein Privileg betrachtet und behandelt wird, das sie ihnen zugesteht: Amerika als Zulassungsstelle für imperialistische Aktivitäten.
2. Defensive Reaktionen auf eine offensive Verschiebung des Kräfteverhältnisses
Die Prämissen, nach denen Amerika die Staatenwelt durchsortiert, sind der neu in Kraft gesetzte politische Fixpunkt, auf den die diversen Mächte sich zu beziehen haben, denn mit ihrem militanten Kontrollregime relativiert die Weltmacht de facto alles, was im strategischen Kräftemessen der Staaten für sie bislang als Konstante einer politischen Orientierung gegolten hat. Mit der politischen Durch- und Neusortierung des Globus im Zeichen des amerikanischen Anti-Terrorkrieges steht für sie einfach nicht mehr fest, auf welche strategischen Gegebenheiten bei der Beförderung ihrer Anliegen noch Verlass ist, welche Grenzen sie in der Konkurrenz um Macht und Einfluss zu respektieren haben, mit welchen Freiräumen sie umgekehrt rechnen und sich dabei welche Chancen ausrechnen können. Sie sind in der einen oder anderen Weise in das Aufsichtsregime einbezogen, das Amerika über die staatliche Rest-Welt ausübt, das ist die neue weltpolitische ‚Lage‘, mit der sie es zu tun haben, und was die für sie und ihren weltpolitischen Status bedeutet, dürfen die Souveräne der Welt in ihren politischen Aktivitäten dann neu ermitteln. Das Wesentliche, nämlich was das politische Gewicht, zu dem sie es gebracht haben, in dem strategischen Koordinatensystem zählt, mit dem Amerika im Namen seiner Sicherheit den Globus neu vermisst, teilt man ihnen aus Washington mit – auf Grundlage dieser Mitteilungen haben sie dann herauszufinden und zu testen, wie es um die Tragfähigkeit ihrer bisherigen politischen Ambitionen bestellt ist. Entsprechend fallen ihre neuen Berechnungen aus: Eher positiv bei den einen, die in ihrer praktischen oder ideell-moralischen Einreihung in Amerikas ‚Koalition der Willigen‘ für sich die Perspektive entdecken, darüber demnächst zu einigem mehr ermächtigt zu sein. Und negativ bei vielen anderen, die sich durch die Offensive der Weltmacht in ihren Rechten und Interessen beschnitten sehen und zu Amerika auf Distanz gehen, wobei der defensive Charakter ihrer Distanzierung ins Auge fällt.
Nordkorea
Dieser ‚Schurkenstaat‘ hat seinen ganz speziellen Grund, Amerikas Anti-Terrorkrieg auf sich zu beziehen: Er lebt mit der Weltmacht – und seinem mit der verbündeten südlichen Bruderstaat – noch immer im Kriegszustand. Er wird seit dem Ende der offiziellen Kampfhandlungen mit einem Embargo drangsaliert, als mittlerweile absolut unzeitgemäßes ‚kommunistisches‘ Überbleibsel, das sein überschrittenes Haltbarkeitsdatum einfach nicht wahrnehmen will, weltpolitisch geächtet und ausgegrenzt, steht wegen seines Waffen- wie seines politischen Selbstbehauptungsprogramms überhaupt auf Amerikas Abschussliste – und diese tödliche Drohung wird durch die Militanz geschärft, mit der die Weltmacht sich an die Behauptung ihres Sicherheitsrechts macht und gegen ihre Feinde vorgeht. Dagegen bietet Nordkorea seinerseits das schärfste Mittel seiner defensiven Selbstbehauptung auf, beantwortet die von den USA gegen das Land verhängte Kriegsdrohung mit einer nicht weniger militanten Gegendrohung und kündigt für den Fall, sich gegen einen Aggressor
verteidigen zu müssen, den Einsatz auch von atomaren Waffen an: Wir sollten die Lektion vom Irak-Krieg lernen, dass wir eine starke militärische Abschreckung gegen Angriffe mit modernsten Waffen zur Verteidigung haben müssen.
(Nordkoreas Rundfunk, lt. Handelsblatt, 11.4.03)
Auch wenn es in sachverständigen Kreisen als wenig wahrscheinlich
gilt, dass das Land überhaupt im Besitz atomarer Waffen ist und über die geeigneten Mittel ihres Transports verfügt, und auch wenn die Drohung selbst sich an gar keinen speziellen Adressaten richtet: In unterschiedlicher Weise von ihr betroffen sind alle Anrainer und regionalen Konkurrenzmächte Nordkoreas, und genau das sollen sie auch sein. Von der Entschlossenheit, mit der Nordkorea sein Überlebensinteresse gegen die amerikanische Kriegsdrohung zu verteidigen gedenkt, zuallererst beeindruckt sind die zwei Staaten, die an der Seite Amerikas konstruktiv an der Niederringung und Erledigung des Landes mitwirken: Südkorea und Japan werden mit neuen Risiken vertraut gemacht, die ihnen aus ihrer Partnerschaft mit Amerika erwachsen, haben daher auch neu zu kalkulieren, ob und wie sehr sie sich in das amerikanische Programm einer Befriedung der Region
weiterhin einspannen lassen wollen. Sie sollen überdenken, ob Nordkoreas Angebot an die Weltmacht, im Tausch gegen eine Garantieerklärung in Sachen eigener Sicherheit und Unverletzlichkeit auf den Einsatz seiner Waffen zu verzichten, nicht auch für sie selbst und ihre Sicherheit eine erwägenswerte politische Perspektive wäre, also in eigenem Interesse aus der Front mit ihrem Partner ein wenig ausscheren und sich bei dem für die Sicherheit Nordkoreas verwenden. In gleicher Weise sollen auch Russland und China ihre strategischen Vielecks-Beziehungen neu überdenken und – möglichst – im Sinne Nordkoreas umgewichten. Sie sollen in Erwägung ziehen, ob für sie angesichts der Bedrohung ihrer strategischen Interessen durch Amerikas Aufmarsch nicht auch zu bedenken wäre, ihre bisherige ‚Einbindung‘ in die diversen Manöver zur politischen Ausgrenzung und ökonomischen Schädigung Nordkoreas aufzukündigen. Statt dessen könnten sie sich ja für ihre Vorstellungen einer ‚regionalen Stabilität‘ stark machen und in diesem Zuge vielleicht an einer entschiedeneren Unterstützung Nordkoreas gegen die Pressionen der USA Interesse finden.
Auf diese Weise versucht das von Amerika mit Krieg bedrohte Land, seine Selbstbehauptung neu zum Bezugspunkt der strategischen Interesse seiner Anrainer zu machen – und zum Teil verfängt dieser Versuch in der von Nordkorea gewünschten Richtung: Russland erklärt seine Bereitschaft, für die Sicherheit des Landes zu garantieren – allerdings gegen niemanden, sondern nur zusammen mit den USA und China. Zum Teil ruft Nordkoreas Selbstverteidigungsversuch aber auch anders geartete Verschiebungen im regionalen Kräfteverhältnis hervor, und die sind beispielsweise Japans Reaktionen auf die nordkoreanische Bedrohung
zu entnehmen. Dieser Partner der USA sieht seine sicherheitspolitischen Belange in einem Maße berührt, dass er seine ganze nationale Sicherheitsdoktrin einer kritischen Bestandsprüfung unterzieht. Die in der Verfassung niedergelegte Selbstverpflichtung auf Enthaltsamkeit bei der Anwendung kriegerischer Gewalt wird für überlebt befunden, daher auch die ausschließlich defensive Ausrichtung der eigenen Selbstverteidigungsstreitkräfte
, und in einem Land, in dem das lange als undenkbar galt
, wird ein Tabu aufgebrochen
(SZ, 14.5.03) und laut darüber räsoniert, wie die Atommacht Japan zustande zu bringen sei: Aus eigener Kraft und mit eigenen Bomben oder darüber, dass man sich unter den atomaren Schutzschild der Weltmacht begibt und deren Geräte bei sich stationiert.
Die arabischen Staaten und der Iran
Der amerikanische Präsident vor dem Krieg: Ein befreiter Irak kann die Macht der Freiheit zur Umgestaltung dieser wichtigen Region
– er meint den gesamten Mittleren Osten – demonstrieren
. Das kann ein Irak ohne Saddam, weil es andersherum erstens einfach nicht sein kann, dass eine ganze Region der Welt – oder ein Fünftel der muslimischen Bevölkerung – irgendwie vom grundlegendsten Streben des Lebens unberührt
bleibt, und weil zweitens die USA dazu ausersehen sind, diese Freiheitslücke
zu schließen. (Bush, 26.2.)
Nach dem Krieg geht die US-Administration davon aus, dass „shock and awe“ bei den arabischen Staaten und dem Iran entsprechende Wirkung entfaltet haben und diese Länder im Lichte der neuen strategischen Dynamik
ihre bisherige Politik neu überdenken
(Powell). Dabei wollen sich die USA nicht mit Lippenbekenntnissen und Versprechungen
abspeisen lassen. Sie kündigen an, die Führungen der Staaten an ihren Taten messen
zu wollen.
Die „Schurkenstaaten“ – Syrien und Iran –
müssen beweisen, dass sie die Lektion des Regimewechsels im Irak begriffen haben und ihr bisheriges Verhalten gegenüber den USA grundlegend ändern
. Sie gehören zu den sieben Staaten
– der Irak ist da noch mitgezählt –, bei denen die US-Sicherheitsdienste die Mischung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen
als eine von der internationalen Gemeinschaft nicht hinzunehmende Gefahr
entdecken, gegenüber denen die USA folglich einen Handlungsbedarf haben
, was – laut Powell – freilich nicht unbedingt Krieg
heißen muss.
Syrien bestätigt aus der Sicht Washingtons vor und während des Irakkriegs nur wieder seine Ächtung als Schurkenstaat
. Der Präsident des Landes, al-Assad, betätigt sich als Scharfmacher in der Arabischen Liga, der seinen Amtskollegen verbieten will, die US-Kriegshandlungen zu unterstützen, wünscht den Irakern offiziell den Sieg und hält arabischen Kriegsfreiwilligen die Grenzen zum Irak offen. Weil Assad aus seiner antiamerikanischen Einstellung keinen Hehl macht, verdächtigen die USA die Regierung in Damaskus, Mitgliedern der irakischen Führungsclique Unterschlupf zu gewähren
, Massenvernichtungswaffen des Irak zu übernehmen und Gelder, die Saddam aus jahrelangem Ölschmuggel und der Plünderung der Staatsbank vor Kriegsbeginn an sich gebracht
haben soll, zu waschen
und zu verstecken
. Solches fällt unter den Tatbestand des aktiven Widerstands gegen die Weltordnungsmacht und zieht nach US-Völkerrecht Krieg als Strafe nach sich.
Diese Drohung schwebt seit ihrer ersten offiziellen Verlautbarung über Syrien – und sie zeigt Wirkung: Das Land mäßigt sich in der Verurteilung der US-Aggression im Irak
, macht die Grenzen für Kriegsfreiwillige dicht, weist Zufluchtsuchende aus dem Irak ab und liefert im Libanon tätige Terroristen an die USA aus. Bei seinem Besuch in Damaskus Anfang Mai bescheinigt Powell der syrischen Regierung daher durchaus konstruktive Zusammenarbeit beim Kampf gegen Al-Kaida
und eine relativ positive Kooperation im Irak-Krieg
. Andererseits stellt der amerikanische Außenminister klar, dass die Ehre, die er dem Land mit seinem Besuch erweist, nicht als Bestandsgarantie für das Regime in Damaskus zu werten ist, sondern dessen letzte Chance darstellt, den fälligen Politikwechsel freiwillig zu bewerkstelligen: Er sei gekommen, um Beweise für einen Sinneswandel der syrischen Regierung zu erhalten, denn immerhin wisse Assad ja nun, was aus einem Regime wird, das sich als Speerspitze der arabischen Sache gegen die USA und Israel versteht. Die syrische Regierung werde daher die neue Lage
wohl begreifen: Syrien ist nun von lauter Staaten umgeben, die neutral bis freundlich gegenüber Israel eingestellt sind
– also so isoliert wie ehedem Saddam.
Syrien soll sich also von seiner bisherigen Politik endgültig verabschieden. Wo das Land gegenüber Israel souveräne Rechte geltend macht, die Herausgabe sämtlicher seit 1967 besetzten Gebiete fordert und sich dabei auf uralte Sicherheitsratsresolutionen beruft, wird ihm dies untersagt – denn in der Region zählen nur die Rechte eines Souveräns: Damaskus wird davor gewarnt, sich in die inneren Angelegenheiten Israels einzumischen
, den Widerstand gegen den zionistischen Expansionismus
in palästinensischen und anderen Volksteilen für sich zu funktionalisieren und seinen Forderungen damit Nachdruck zu verleihen. Syrien hat kein Recht, sich wegen der Bedrohung durch die Atommacht Israel eigene ‚WMD‘ zuzulegen – das ist in den Augen der Weltaufsichtsmacht Terrorismus, nämlich Eigenmächtigkeit
, die amerikanischen Interessen zuwiderläuft. Am Präzedenzfall Irak haben die USA gezeigt, wie sie auf dieses Verbrechen gegen ihre Weltordnung reagieren, daraus brauchen andere für sich nur die rechte Lehre zu ziehen: Wenn Syrien etwas für seine Belange tun will, soll es sich vertrauensvoll an die USA wenden, die dann schon darüber befinden, wo es Recht bekommt und wo nicht. Der Chef des State Department fordert von Assad also nichts Geringeres als die Aufgabe der syrischen Staatsräson und die Selbstbeschränkung der eigenen Souveränität. Als Zeichen seines guten Willens soll sich Syrien aller Mittel entledigen, die es gegen seinen Hauptfeind in der Hand hat, sich also selbst teil-entmachten: Assad hat ab sofort sämtliche Büros der radikalen Palästinenser in Damaskus zu schließen, dem Hizbullah die Unterstützung zu entziehen, die syrischen Truppen aus dem Libanon abzuziehen und jede Bedrohung Israels zu unterlassen. Für den Fall, dass sich die Syrer ‚kooperativ‘ zeigen, stellt Powell ihnen bessere Zeiten in Aussicht: Washington könne für Syrien beim Aufbau intensiver Beziehungen zur neuen Führung im Irak ‚sehr hilfreich sein‘,… dies gelte für die Bereiche Handel, Politik, Wirtschaft und vor allem für Öllieferungen.
(FAZ, 5.5.)[1]
Assad sieht sich genötigt, auf die amerikanische Erpressung einzugehen, zumal er keinerlei Rückhalt im arabischen Lager oder Unterstützung bei anderen Staaten findet.[2] Im Gegenteil: Alle befreundeten Nationen ermuntern ihn, um des Friedens willen
den US-Forderungen nachzugeben. Also schließt er die Büros der Israel-feindlichen Gruppen und erklärt, die Palästinenser müssten sich auf ihre eigenen Mittel in den besetzten Gebieten beschränken. Der libanesischen Regierung schiebt er die ausschließliche Verantwortung für den Umgang mit dem Hizbullah zu[3], und erklärt sich dazu bereit, mit Israel Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen aufzunehmen. Allerdings verzichtet Assad nicht auf seinen von der UNO verbrieften Rechtstitel der Rückgabe des Golan und sagt den Abzug der 30.000 syrischen Soldaten aus dem Libanon auch nur langfristig und unter bestimmten Bedingungen
zu. Dass Syrien Chemiewaffen oder sonstige verbotene ‚Massenvernichtungswaffen‘ besitze, bestreitet er.
Iran verhält sich aus US-Sicht im Krieg ziemlich korrekt
. Zwar verhehlt die Teheraner Regierung nie ihre Ablehnung des Kriegs. Sie hält aber gleichzeitig ihr Versprechen einer aktiven Neutralität
, sich selbst also aus dem Kriegsgeschehen heraus und ihre Grenzen dicht, reagiert sehr zurückhaltend auf militante Übergriffe von Seiten der Alliierten durch Luftraumverletzungen und fehlgeleitete Bomben auf iranisches Territorium. Auch nach dem Ende der Hauptkampfhandlungen gibt sich der Iran durch amerikanische Kriegsdrohungen beeindruckt und nutzt das Durcheinander im Irak nicht dazu aus, in eigenem Interesse größeren Einfluss auf die schiitische Bevölkerung auszuüben. Durch diese Zurückhaltung erspart sich die Islamische Republik aber nur vorläufig größeren Ärger. Die Bush-Administration ist von ihrem Entschluss, in diesem Land auf einen Regimewechsel hinzuarbeiten, keineswegs abgerückt: Dessen Umsetzung steht in einer der nächsten Etappen ihres Antiterrorkriegs auf dem Programm, offen ist derzeit nur noch, mit welchen Mitteln sie den Sturz der Mullahs erreichen will. Vorerst hält die US-Regierung dafür, dass die Beseitigung des Regimes durch die Völkergemeinschaft einerseits, durch die freiheitsdurstigen Perser andererseits in die Wege geleitet wird. Beides betreibt sie praktisch.
Um die Weltgemeinschaft entsprechend zu formieren, setzt das Pentagon die Behauptung in die Welt, Erkenntnisse von Geheimdiensten und eine Auswertung von Berichten der Internationalen Atomaufsichtsbehörde (IAEA) über die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz hätten ergeben, dass diese für militärische Zwecke genutzt werde – ein offenkundiger Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag (NPT), den der Iran unterzeichnet habe. Als Beweis
dient der folgende Schluss
: Der Iran benötige als Ölförderland keine Atomenergie, keinen einzigen Atommeiler und erst recht keinen geschlossenen atomaren Brennstoff-Kreislauf, also kann er den nur wegen seiner Waffen benötigen. Daher ist die Konsequenz klar: Jeder gutwillige Staat
der internationalen Gemeinschaft muss – wie die USA – den Iran als terroristischen Staat
einstufen, und hat, wie im Falle Nordkoreas, der Ächtung in Form von Sanktionen gegen den Iran Taten folgen zu lassen: US-Diplomaten bemühen sich, den Direktor der IAEA, El Baradei, dazu zu bringen, den Iran völkergemeinschaftlich-offiziell des Verstoßes gegen den NPT zu bezichtigen, gleichzeitig werden die Mitglieder des Direktoriums der IAEA – Russland und einige europäische Staaten – bearbeitet, sich der amerikanischen Sichtweise anzuschließen.
Als zweite Option, den Regimewechsel in Teheran herbeizuführen, setzen die USA auf ihre eigene entschiedene Unterstützung
der Iraner, die trotz Unterdrückung demokratische Freiheiten suchen
(Bush, NZZ, 10.5.). Die USA verstärken ihre Propagandaeinrichtungen, mit denen sie die iranische Bevölkerung agitieren, und stocken massiv die Mittel für die Förderung iranischer Oppositioneller auf. Erfreut registrieren die für sicherheitsrelevante „Erkenntnisse“ zuständigen Dienste, dass das Regime bereits in der Defensive ist: In Teheran verbieten die iranischen Behörden die 1. Mai-Demonstration der Gewerkschaften, weil sie proamerikanische Spruchbänder und Freiheits-Parolen befürchten. Selbst die politische Elite des Landes zeigt sich nicht unbeeindruckt von der amerikanischen Offensive: Inzwischen fordern einzelne Politiker in Teheran, was jahrelang ein Sakrileg war und mit entsprechender Repression geahndet wurde, nämlich die Verbesserung der Beziehungen zu den USA
. Selbst ein Führer des ‚konservativen Lagers‘, der ehemalige Präsident Rafsandschani, hält einen iranischen Konfrontationskurs gegenüber den USA für perspektivlos und gefährlich.
Allerdings besteht die iranische Regierung darauf, dass ein Dialog mit den USA auf gegenseitigem Respekt
beruhen müsse und Washington das Land nicht unter Druck setzen
dürfe. Immerhin lasse der Iran – im Unterschied zu anderen Staaten! – alle Atom-Aktivitäten durch die IAEA kontrollieren
, während die IAEA nicht einmal ihre Verpflichtung aus dem NPT gegenüber dem Iran erfülle, dem Land freien Zugang zu ziviler Atomtechnologie zu gewährleisten
(IRNA, 10.5.). Die Teheraner Regierung verteidigt den Status Irans als souveräner Staat, weil sie sich in einer vergleichsweise besseren Lage als der von der Staatenwelt isolierte Saddam Hussein zu befinden glaubt. Dabei verlässt sie sich weniger auf ihre guten Beziehungen zu den Nachbarn Syrien, Türkei und Saudi-Arabien. Weit wichtiger für sie ist die Tatsache, dass Russland und die Europäer – einschließlich der US-Alliierten Großbritannien, Italien und Spanien – massive ökonomische Interessen an persischen Energievorkommen und am iranischen Markt haben. Aus diesen Interessen sucht die Regierung Chatami für sich politisch Kapital zu schlagen, die Sicherheitsratsmitglieder in die Beschlussfassung über das weitere Vorgehen im ‚Fall Iran‘ zu involvieren – und damit auszutesten, ob sich andere maßgebliche Mächte nach dem Fall Irak von den USA auch noch die Interessen und Rechte verbieten lassen wollen, die sie am Iran haben. Und was die von den USA betriebene innere Zersetzung des Landes angeht, so verlässt sich die Regierung Chatami auf ihre repressiven Maßnahmen gegen jede Art staatsfeindlicher Opposition und geht davon aus, die Lage unter Kontrolle zu haben.
Die traditionellen Verbündeten – Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien –
bekommen im Zuge des Irak-Kriegs von den USA unmissverständlich mitgeteilt, dass sie selbstverständlich alle gewünschten Hilfsdienste bei der amerikanischen Ordnungsstiftung abzuliefern haben. Ihre eigenen nationalen Kalkulationen spielen dabei keine Rolle, Gegenleistungen für ihre Botmäßigkeit brauchen sie schon gar nicht zu erwarten: Der Nutzen ihrer Bündnistreue besteht für sie vornehmlich darin, von den USA vorerst nicht als allzu ‚problematischer‘ Ordnungsfall gewürdigt zu werden. Ein Freibrief, ihre Politik wie bisher weiterzumachen, geht damit nicht einher. Vielmehr erwachsen den Verbündeten aus der neuen strategischen Lage
erhebliche Bestandsprobleme.
Im Krieg bedingt sich Saudi-Arabien aus, die USA nur heimlich zu unterstützen, offiziell verweigert es die Nutzung der „Prince-Sultan-Base“ als Schaltzentrale des Luftkriegs und die Erlaubnis für US-Kampfeinsätze von saudischem Territorium aus. Washington hindert dies nicht daran, von saudischem Hoheitsgebiet aus alle Militäraktionen zu starten, die das Oberkommando für nötig befindet; an der Untergrabung der Glaubwürdigkeit der saudischen Herrscher ist die US-Administration allerdings nicht interessiert: Schon vor dem Krieg wird vereinbart und bekannt gegeben, dass die Militärpräsenz der Amerikaner in Saudi-Arabien nach den Kampfhandlungen drastisch reduziert wird. Die Bush-Regierung entscheidet sich für den Abzug von mehreren Tausend Soldaten aus Saudi-Arabien, weil das Konzept des Pentagon nach erfolgreichem Irak-Krieg eine Diversifizierung und Verkleinerung der einzelnen Stützpunkte zur flexibleren Gestaltung der Einsatzmöglichkeiten vorsieht und die saudischen Stützpunkte zudem immer wieder erhebliche Sicherheitsprobleme aufwerfen. Diese Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz im Land befürworten die Saudis, weil sie sich darüber eine gewisse Emanzipation von der Rolle eines Vasallen der USA versprechen – verbunden mit dieser ‚Emanzipation‘ ist aber erst einmal ein erheblicher Statusverlust ihres Landes.
Saudi-Arabien war für Amerika 50 Jahre lang der ideale Verbündete in der Region: Das Land liefert heute etwa ein Sechstel des Öls, das die USA importieren; es sorgt als Führungsmacht in der OPEC für gemäßigte Energiepreise und kontinuierliche, ausreichende Versorgung der Märkte; es transferiert einen erheblichen Teil der Dollareinnahmen wieder in die USA, ist der größte Abnehmer amerikanischer Waffen – im Wert von 39 Mrd. $ in den 90er Jahren
und legt Milliardenbeträge in US-Staatspapieren und amerikanischen Aktien
(WP, 4.5.) an. Als Hüter der Heiligen Stätten
und enger Freund der USA konnte das saudische Königreich lange Zeit die islamischen Glaubensbrüder zu guten Werken im Sinne der USA bewegen, vor allem zur Milderung des sozialen Elends, das Israels Kriege bei den arabischen Brüdern anrichten. Saudische Islamisten und Spendengelder bildeten das Rückgrad der ‚Befreiungskämpfe‘ gegen die Sowjetunion in Afghanistan und gegen Russland in Tschetschenien. In der Arabischen Liga sorgte Riad stets für einen gemäßigten Kurs, der sich auf verbale Attacken gegen Israel beschränkte und prinzipiell für Aussöhnung plädierte. Doch was lange Zeit in den Beziehungen zu Amerika als Bonus galt, wird Saudi-Arabien seit dem 11.9. und spätestens seit der Irak-Offensive als Malus angekreidet: Die Führung ist mit dem Islamismus verwoben
, anstatt die Moscheen zu kontrollieren und die Militanten mit aller Härte zu bekämpfen. Mit mildtätigen Spenden an islamische und arabische Brüder unterstützten die saudischen Prinzen in Wirklichkeit den Terrorismus, um dem Königshaus die Rebellion radikaler Kritiker zu ersparen. Zudem will Kronprinz Abdullah für die Aussöhnung mit Israel als Gegenleistung nach wie vor so etwas wie eine Anerkennung arabischer Rechte, widersetzt sich also der von Bush geforderten Unterordnung – und daraus zieht man in Amerika seine Konsequenzen: Um freie Hand gegenüber dem Regime in Riad zu haben, will Washington nun möglichst schnell seiner Abhängigkeit vom saudischen Öl
ein Ende und die gesamte OPEC bedeutungslos machen. Dazu ist der Irak-Krieg erklärtermaßen ein erster Schritt
: Die USA übernehmen die strategische Kontrolle über die Energieversorgung selber und entmachten all die Staaten, die diese – zumindest teilweise – als ihr nationales Lebensmittel bisher für sich beansprucht haben.
Die saudische Führung begreift den Ernst der Lage und beschließt, aus eigenem Interesse einen Regimewechsel vorzunehmen und ein nation building
nach amerikanischem Geschmack einzuleiten. Die Ent-Islamisierung der Herrschaft steht an, eine konsequente Terrorismusbekämpfung
, die Kontrolle der Gelder der Ölprinzen durch den Staat, die Verwendung ihrer Einkommen für kapitalistisches Wachstum im Lande und schließlich die Einführung politischer und sozialer Verhältnisse nach westlichem Vorbild. Diesen Wandel hat die saudische Führung zwar schon seit geraumer Zeit im Auge: Sie selbst sieht die Überreste feudaler Gesellschaftsstrukturen, das an der Scharia orientierte Rechtswesen und die moralische Autorität der Imame als Schranken für den kapitalistischen Fortschritt ihres Landes an. Doch jetzt, wo Amerika ihn ultimativ fordert, wird der Umbau des Staatswesens in ganz anderer Weise dringlich und darüber zu einem Bestandsproblem des Landes: Während die maßgeblichen Scheichs sich durch den eingeleiteten Wandel einen nationalen Aufbruch und eine Renaissance der gesamten arabischen Welt
versprechen, verlangt die Bush-Regierung die Bekämpfung sämtlicher Quellen des Antiamerikanismus – am besten gleich unter US-Regie – und die Unterordnung sämtlicher arabischer nationaler Vorhaben unter die strategischen Bedürfnisse der USA.
So steht für Saudi-Arabien der Test an, wie viel es sich bei der Realisierung seiner nationalen Vorhaben leisten darf, auf wie viel Unterordnung demgegenüber die USA bestehen und worauf beim arabisch-nationalen Aufbruch infolgedessen zu verzichten ist. Den saudischen Scheichs ist klar, dass ein nicht unerheblicher Teil ihrer Öleinnahmen von Washington zum Wiederaufbau des Irak beansprucht wird – dafür möchten sie ihrerseits eigene Interessen im Irak geltend machen dürfen und bei der Ausgestaltung der künftigen politischen Verhältnisse dort zumindest konsultiert werden: Als erste arabische Regierung erklärt Riad – entgegen allen früheren Bekundungen – die Bereitschaft, mit der von den USA installierten Marionetten-Regierung im Irak zusammenzuarbeiten, erwartet dafür allerdings, bei den anstehenden Auftragsvergaben angemessen berücksichtigt zu werden. Zugleich entgeht den Saudis nicht, dass die guten Dienste, die sie den USA nach wie vor leisten, für die Weltmacht so wichtig nicht mehr sind, für sie selbst also auch keine Überlebens-Garantie mehr begründen. Daher versucht Saudi-Arabien, neue Bündnisse zu schmieden, mit denen es seinen bisherigen Status als wichtigster Mit-Garant der Welt-Energieversorgung auch künftig behaupten kann, und wendet sich dabei – notgedrungen – an lauter Staaten, die ihrerseits selbst Probleme mit gewissen Anforderungen der USA haben: Es verbessert seine politischen Beziehungen zu Russland, zu Iran und mehreren Ländern des Kaukasus, schließt Wirtschaftsverträge, technische Kooperationsabkommen und verstärkt die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit diesen Ländern – und zieht sich darüber nicht gerade das Wohlwollen Amerikas zu.
Ägypten und Jordanien haben zwar gute nationale Gründe gegen den Feldzug der USA, beschließen aber schon vor dem Krieg, dass es aussichtslos ist, diese gegen die USA irgendwie geltend zu machen. Mubarak und König Abdullah sorgen daher maßgeblich für die Isolierung der pro-irakischen Position Syriens und Libyens in der Arabischen Liga – und damit zugleich für das einstweilige Ende dieser Institution. Mubarak erklärte seinen Landsleuten gegenüber, er habe Saddam Hussein rechtzeitig gewarnt und aufgefordert einzulenken
und lehne es nun ab, dass schon wieder Ägypter ihren Kopf für andere hinhalten
sollen (Al Ahram Weekly, 10.4.). Noch weitsichtiger ist Abdullah II.: Er schwört bereits im Dezember 2002 seine Bevölkerung auf die Kampagne „Jordan first“ ein und fordert sie auf, sich endlich auf die Probleme im eigenen Lande zu konzentrieren und sich nicht ständig auf die der Palästinenser oder Iraker zu fixieren.
Im Krieg geben beide Herrscher den USA, was diese von ihnen verlangen: Mubarak die freie Passage durch den Suezkanal, Abdullah die Nutzung des jordanischen Luftraums, die Stationierung von Patriot-Raketen zum Schutz Israels und die Aufmarschbasis für 3000 Mann der Special Forces für Operationen im Westirak. Ihren Völkern gegenüber verheimlichen sie ihre Botmäßigkeit so gut sie können, kommen aber um den Vorwurf des Verrats der arabischen Sache und die Beschimpfung, Marionetten der USA zu sein, doch nicht herum. Die Tumulte im Volk lassen sie niederknüppeln, und es kommt ihnen zugute, dass der schnelle Einmarsch der US-Truppen in Bagdad offensichtlich auch die aufgebrachten Massen in beiden Ländern ziemlich beeindruckt und die Kritik an der eigenen Führung doch recht schnell verstummt. Seitdem herrscht dank der landesüblichen Mischung von Repression gegen islamische Kritiker und Appellen ans Volk, in schweren Zeiten zusammenzuhalten, wieder Normalität im öffentlichen Leben.
Daneben haben die Regierungen alle Hände voll damit zu tun, die ökonomischen Schäden, die durch den Krieg und den Wegfall des Saddam-Regimes entstanden sind,[4] zu verkraften bzw. sich um deren Kompensation zu bemühen. Ob und wann der Irak je wieder – so, wie unter der Herrschaft Saddams – aussichtsreiche Geschäfte einbringt, ist erstens fraglich und zweitens von amerikanischer Konzessionsbereitschaft abhängig.
Um letztere müssen auch diese beiden Länder durch ihre stromlinienförmige Anpassung an die Reformvorstellungen
werben, die man in Washington auch für ihren Fall parat hält. Weder entsprechen ihre gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse amerikanischen Maßstäben, noch haben die Führungen bisher ihre Staatsräson – z.B. in der Israel-Frage – so nahtlos den strategischen Forderungen der USA angepasst, wie das von ihnen verlangt wird. Zwar besteht Ägyptens Mubarak mit seiner Erpressung Arafats, Muhmad Abbas zum palästinensischen Ministerpräsidenten zu ernennen,[5] einen ersten Test, und mit der Klarstellung gegenüber Syrien, das Land im Fall etwaiger Widersetzlichkeit gegenüber Amerika keinesfalls zu unterstützen, einen zweiten, doch schon stehen weitere Herausforderungen an: Dienste bei der Entwaffnung der radikalen Palästinenser, die Anerkennung des amerikanischen Protektorats im Irak usw. Und was den jordanischen König betrifft, so beweist der schon seit längerem seine Lernfähigkeit in Bezug darauf, wie unter den neuen Bedingungen die akzeptable Vertretung eines arabisch-nationalen Standpunkts allein auszusehen hat: Immer genau das von den USA verlangen, was diese gerade für sich auf die Tagesordnung setzen – aktuell also die rasche Umsetzung der ‚road map‘ für den Frieden.
Die Türkei
Für den Krieg gegen den Irak ist die Türkei fest eingeplant. Amerika will seinen vorgeschobenen Nato-Partner in genau der Funktion gebrauchen, für die es ihn über den antisowjetischen Kalten Krieg hinaus vorgesehen hat: als strategische Basis für den Kampf gegen die neuen Bedrohungen
aus dem Nahen bis ferneren Osten, die heute ‚Terrorismus‘ und ‚Schurkenstaaten‘ heißen. Das Land soll als Ansammlung von zum Teil erst noch auszubauenden US-Stützpunkten, als Nachschublinie und als Aufmarschgebiet für die 60.000 Soldaten der geplanten amerikanischen Nordfront im Irak dienen. Und die – neu gewählte islamistische – Regierung ist aufgefordert, die gewünschte Generalvollmacht für die Freiheit der US-Kriegsmaschinerie zu unterschreiben. Widerspruch wird nicht erwartet, wo die USA sich doch glatt auch noch dazu herablassen, dem Land für den betriebenen Aufwand 30 Mrd. Dollar an Hilfszusagen
in Aussicht zu stellen. Dabei ist der amerikanische Tagesbefehl an die Türkei, sich zum logistischen Ausgangspunkt und Helfershelfer des Angriffs auf den irakischen Nachbarn zu machen, eine einzige Zumutung für diese Nation. Denn der Krieg gegen das Saddam-Regime
richtet sich nicht gegen einen Feind der Türkei, er selbst bedroht vielmehr deren elementare Sicherheitsinteressen – darin sind sich die türkischen Parteien samt Armee ausnahmsweise einig. Sie, die erst vor kurzem ihre eigene Kurdenabteilung für befriedet
erklärt, also erfolgreich bekriegt haben und immer noch an den ökonomischen Kosten aus dem ersten Golfkrieg sowie den Schäden durch das nachfolgende Embargo laborieren, befürchten jetzt das Schlimmste: Dass die Vernichtung der irakischen Herrschaft durch die Amerikaner – zumal dann, wenn sich die im Nordirak vereinigten kurdischen Peschmerga-Milizen daran auch noch beteiligen dürfen – den dortigen Kurden zu einer dauerhaften Autonomie, wenn nicht gar zu einem eigenen Staat verhilft und darüber das allererste türkische Staatsziel, die Entstehung eines grenzüberschreitenden Kurdistan mit allen Mitteln zu verhindern, unterminiert wird. Denn ein kurdischer Nationalismus, dem Amerika im Irak Raum für Selbstbestimmung
und eine ökonomische Reichtumsquelle gewährt, wird, da ist man sich in Ankara sicher, die Wiedereröffnung auch des türkischen Kurdenproblems
heraufbeschwören und den territorialen Bestand der Türkei mehr gefährden denn je zuvor.
Der Krieg der USA ist also ein Krieg, den der türkische Staat nicht will. Ihn zu verhindern sehen sich die Führer dieses Staates jedoch außerstande. Sie geben ihren Vorbehalt kund, verweigern per Parlamentsbeschluss den verlangten Freibrief für die Nutzung des nationalen Territoriums (auf türkisch auch „Besatzung“ genannt) und ringen um ihren Einfluss auf den Krieg bzw. seine Resultate, um den zu gewärtigenden Schaden wenigstens zu begrenzen. Damit wird die Türkei selbst zu einem Aufsichtsfall für die USA, die sich ihre Kriegspläne nicht durchkreuzen lassen wollen. Dass die Türken ihr Militär parallel zur amerikanischen Invasion auf eigene Rechnung in den Nordirak bringen wollen, um die Kurden in Schach zu halten, sie an der Eroberung „ihrer“ Städte Mossul und Kirkuk sowie der regionalen Ölquellen zu hindern und nach dem Regimewechsel in Bagdad zu entwaffnen, fordert den US-Verteidigungsminister zu der offenen Drohung heraus, in diesem Fall müssten sie sich auch auf ein echtes „friendly fire“ unter Nato-Freunden gefasst machen. Wozu die USA sich bereit finden, ist, dem störrischen Partner mit einem Angebot nachzuhelfen, das dieser nach Meinung des Weißen Hauses schlechterdings nicht ablehnen kann. Der südliche Anker
der Nato, dessen (Schulden-)Wirtschaft und Staatshaushalt am Tropf des IWF hängen, wird von der Bündnisvormacht mit seiner wirtschaftlichen Notlage erpresst und daran erinnert, dass ihm ohne Kreditgarantie der USA das Schicksal eines zweiten Argentinien
droht, und dass die Erklärung seines faktischen Staatsbankrotts gegebenenfalls von Amerika herbeigeführt wird… Eine schöne Klarstellung seitens der Weltmacht, die ihre minder bemittelten Frontstaaten ausrüstet und kreditiert, auf dass sie fähig sind, die Funktionen, für die sie vorgesehen sind, zu erfüllen: Wenn diese Alliierten angesichts der prekären Vasallendienste, die der ‚Antiterrorkrieg‘ von ihnen fordert, Bedenken zeigen und Bedingungen stellen, so wird ihnen bedeutet, dass nicht nur ihre ganze regionale Macht eine bloße Leihgabe ist, sondern auch ihre schiere Existenz darauf beruht, dass die USA ihnen die internationale Kreditwürdigkeit spendieren – also auch jederzeit entziehen können; mit anderen Worten, dass jeder Verstoß gegen die Weisungen, die Amerika ihnen erteilt, bestraft wird.
Für den türkischen Staat fallen die Konsequenzen des fortgesetzten „Pokerns“ um die Anerkennung seiner Souveränitätsansprüche drastisch aus. Der amerikanische Zeitplan zum Angriff definiert das Ende der Verhandlungen, womit für die Bush-Regierung das Urteil feststeht, dass hier ein Partner seine Bündnisloyalität verweigert – der Krieg also ohne ihn und damit erst recht ohne Rücksicht auf seine Interessen stattzufinden hat. Die USA besetzen den Irak, bedienen sich der willigen und kampferprobten Kurdenmilizen als Ersatz-Nordfront und übernehmen nebenbei selbst und exklusiv die Kontrolle über das freiheitsdurstige Volk
, an dem sich die Türken stören. Dem türkischen Militär ist es verwehrt, die elementaren Sicherheitsinteressen des Landes
– notfalls, wie bisher, auch präventiv – gegen potentielle kurdische Staatsgründungsversuche zu verteidigen. Jene werden ab sofort von der amerikanischen Besatzungsmacht definiert; ab sofort hängt es einzig und allein von den Berechnungen und Machtprojektionen
Washingtons ab, wieweit die Kurdenclans in ihrem Autonomiebedürfnis ins Recht gesetzt bzw. unterdrückt werden. Darüber hinaus ist das amerikanische Interesse an der Türkei als strategischem Brückenkopf inmitten des nahöstlich-kaukasischen Krisenbogens
durch den Kriegserfolg gegen den Irak relativiert, deswegen nämlich, weil sich die Weltmacht selbst in diesem zentralen Orient-Staat militärisch implantiert hat, also auch höchst persönlich die Rolle der regionalen Ordnungsmacht übernehmen kann, und zwar so wirkungsvoll, wie kein Anrainerstaat dies je könnte. Denn wirklich und unwiderstehlich überzeugend ist eine Ordnungsmacht dadurch, dass sie alle eigenmächtigen Regime
und Diktaturen
, die sie als Störenfriede ihres Kommandos über die Region samt ihren Reichtumsquellen identifiziert hat, mit einem Willen zum Zuschlagen konfrontiert, gegen das jede Gegenwehr aussichtslos ist. Für die Erledigung der verbliebenen Schurken werden die USA also selber sorgen; und welche Bedeutung einem der bisher wichtigsten Vorposten des „Westens“, der Türkei, dabei zukommen wird, werden sie beizeiten und von Fall zu Fall entscheiden. Dabei wird die Willigkeit
zur Einreihung in die amerikanisch angeführte Koalition
ein wichtiges Kriterium abgeben, wie die Türken gerade im Nachkriegsirak schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen: Nicht sie werden mit der Funktion einer sektoralen Stabilisierungsmacht vor ihren Grenzen betraut, sondern die Polen, die sich durch aufdringliche Dienstbarkeit für den Status eines wichtigen US-Vasallen in Mittel-Osteuropa qualifizieren wollen.
Verloren gegeben, d.h. aus ihren Bündnispflichten entlassen wird die Türkei deswegen noch lange nicht. Sie erhält die Chance zur tätigen Wiedergutmachung. Der stellvertretende amerikanische Verteidigungsminister verlangt von der Regierung, die versagt hat, sich zu entschuldigen
; der Kongress hat 1 Mrd. Dollar Finanzhilfe
(plus die Aussicht auf mehr) übrig – als Signal an die Gläubiger der 160 Mrd. Dollar, die Ankara derzeit schlecht geschrieben werden: Amerika rechnet durchaus und nach wie vor auf nützliche Dienste des Landes, was die künftig fälligen Gewalteinsätze im Rahmen des Antiterrorkriegs betrifft. An dieser Brauchbarkeit bemisst sich, welchen Wert die Türkei – strategisch wie buchstäblich, als Geschäftsbereich – hat! Ein unerträglicher Erpressungszustand für eine Nation, die auf sich hält – und auch in Europa bislang vergeblich einen Ausweg und nachhaltigen Aufstieg sucht.
Russland
Die zum Mitmacher in Amerikas Weltordnung konvertierte ehemalige Großmacht setzt sich gegen den Aufmarsch der Weltmacht mit einer entschieden doppelgleisigen Diplomatie zur Wehr. Im Sicherheitsrat der UNO verweigert sich Russland der von Amerika verlangten Legitimation des Krieges, wedelt dabei sogar mit seinem Veto-Recht, um die einschlägigen Resolutionen zu Fall zu bringen, und ist dann heilfroh, sich in dieser Form nicht exponieren zu müssen und den Franzosen die Führungsrolle im ‚antiamerikanischen Lager‘ überlassen zu können. Daneben lassen die russischen Außenpolitiker – Präsident Putin voran – keine sich ihnen bietende Gelegenheit aus, dem Missverständnis entgegenzuwirken, man wolle es sich mit Amerika und seinem tatkräftigen Präsidenten ernsthaft verscherzen. Beides zusammen hat seinen politischen Grund und ist durchaus konsequent.
Mit dem Aufmarsch der USA bekommen die Russen erstens mitgeteilt, dass ihr eigenes militärisches Potential – soweit noch vorhanden – Amerika von rein gar nichts abschreckt und daher von keinem seiner Vorhaben abhält, auch nicht in einer Region, die Russland unmittelbar zu seinem strategisch relevanten Sicherheitsbereich rechnet. Im Rahmen der UNO kann Russland sein Nichteinverständnis mit dem amerikanischen Krieg zu Protokoll geben, ansonsten hat es nichts, was Amerika in seinem Vormarsch beeindrucken könnte. Eher macht sich die ehemalige Großmacht in Amerikas Sicht derselben Umtriebe verdächtig, zu deren Bestrafung am Irak gerade das fällige Exempel exekutiert wird, und wird darüber selbst ein Kontroll- und Aufsichtsfall. Sie wird daraufhin überprüft, ob und wo sie mit Waffenlieferungen an die Verkehrten Amerikas Sicherheit verletzt – im Irak mit Nachtsichtgeräten und elektronischen Abwehrmitteln gegen Cruise-Missiles, im Iran mit Waffen, atomtechnologisch relevanter Ausrüstung und sonstigen dual-use-Gütern – bzw. dies zu tun womöglich demnächst beabsichtigt, wird also selbst als Sicherheitsrisiko behandelt und als Objekt ein wenig in Amerikas Anti-Terrorkrieg miteinbezogen: Wenn ihre Diplomaten schon unbedingt zur falschen Zeit am falschen Ort
(Sicherheitsberaterin C. Rice) sein müssen, brauchen sie sich über Bomben nicht zu beklagen. Ebenso verstehen sich U-2-Spionageflüge entlang der russisch-georgischen Grenze von selbst – was kann die Weltmacht dafür, dass sich auf russischem Staatsgebiet ein Nest des ‚internationalen Terrorismus‘ breit macht, auf das Amerika ein Auge haben muss?!
Diese strategische Ausmischung Russlands aus dem Nahen Osten untergräbt zweitens die wirtschafts- und sonstigen außenpolitischen Beziehungen, die für Russland bislang das Vehikel waren, es perspektivisch zu einer kapitalistischen Weltwirtschaftsmacht zu bringen. Geschäfte mit geächteten Staaten wie Irak und Iran und solchen, die früher in Washington nicht sonderlich beliebt waren und es auch heute nicht sind, sind bzw. waren – neben Öl- und Rohstoffzulieferungen für den offiziellen Weltmarkt – die so gut wie einzige Option Russlands, Waffen und Industrieprodukte unterhalb des Weltmarktniveaus zu Geld machen und entsprechende Reste seiner überkommenen Industrie erhalten zu können. Infolge des Krieges Amerikas gegen den Irak verdient Russland dagegen demnächst nicht nur geschätzte 50 Mrd. $ weniger und hat auch das Einkassieren von 8,5 Mrd. $ Schulden zu vertagen: Der besondere Weg, auf dem die Nation mangels Alternative in der Weltwirtschaft reüssieren wollte, steht nun auch über den Irak hinaus in Frage.
Entgegenzusetzen hat man dieser gewaltsamen Ausmischung der Nation aus den für sie nicht gerade unwichtigen Feldern des eigenen Geschäfts und politischen Einflusses allerdings nichts. Die endgültige Begrabung aller Feindseligkeiten gegen die westliche Führungsmacht soll ja die Produktivkraft auf dem neuen imperialistischen Erfolgsweg der Nation sein und bleiben, das allergrößte Garantieversprechen an das internationale Kapital, das mit seinen Investitionen das Land reich machen soll. Also hat jede Sorte von Feindschaft gegen Amerika auch zu unterbleiben, solange man als Konkurrent im westlichen System sein Heil sucht: Aus dem Munde ihres Präsidenten erfahren die Russen, dass es sich ihre Nation einfach nicht leisten kann, in ‚Krisenfälle‘ wie den Irak-Krieg hineingezogen
zu werden. Was das Land sich allenfalls leisten kann, sind die drei Lügen hintereinander in einem Satz, mit denen sein Präsident ihm die Rolle eines weltpolitischen Subjekts andichtet, das mit Amerika noch immer auf einer Ebene stünde: Russland hat mit den USA zusammengearbeitet, arbeitet mit ihnen zusammen und wird auch weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten.
(Putin)
Indien und Pakistan
In Bezug auf die Ausübung ihrer souveränen Macht bekräftigt die zweite Etappe in Amerikas ‚Krieg gegen den Terror‘ für diese beiden asiatischen Mächte die Lehre, die ihnen die Weltmacht in ihrem Krieg gegen Afghanistan praktisch erteilt hat.[6] Für Pakistan besagt dies, dass es sich weiter einzig und allein in seiner neuen Funktion und Staatsräson zu bewähren hat, Amerika in dessen Krieg zur Seite zu stehen. Die Grenzen gegen ‚islamische Terroristen‘ abzudichten, im Inneren gegen anti-amerikanische Umtriebe im eigenen Volk vorzugehen, alle Ambitionen in Bezug auf die Kaschmir-Region hintan zu stellen und statt dessen dort Terror-Kommandos zu zerschlagen: Das mag zwar allem zuwiderlaufen, was in dieser nationalen Heimstatt der Muslime
bislang als Räson der Herrschaft galt. Das spielt aber keine Rolle, weil die Nation nach dem Willen der USA ihre nationale Prioritätenliste einfach anders zu gewichten und ihren obersten Daseinszweck in der Wahrnehmung der Funktion zu begreifen hat, für die sie von Amerika ausersehen ist. Damit hat sie zurecht zu kommen, und in dem Maße, in dem sie das tut, können sich Pakistans Machthaber eventuell auch Möglichkeiten zur Beförderung ihrer ureigenen nationalen Anliegen ausrechnen.
Komplementär dazu stellen die USA Indien gegenüber erneut klar, dass diese Nation, die sich aus eigenem Interesse zu Amerikas Partner im Anti-Terrorkrieg erklärt hat, dies nicht mit einer Ermächtigung zum Krieg gegen das pakistanische Terrornest
verwechseln darf. Ein militärischer Befreiungsschlag gegen den Nachbarn, der das eigene Hoheitsgebiet im Kaschmir endlich sicher
machen würde, kommt für die USA nicht in Frage, weil der verhasste Nachbar für sie unverzichtbarer Brückenkopf in ihrem Antiterrorkrieg ist, gegen Afghanistan wie gegen den Irak und gegen die Gegner demnächst. Damit ist Indien mit dem Faktum konfrontiert, dass die Verteidigung der legitimen Interessen
des Landes an der entscheidenden Stelle einem Gewaltverbot unterliegt. Zwar hat das Land seinen Konflikt mit Pakistan erfolgreich in den ‚Krieg gegen Terrorismus‘ mit hinein definiert und sich auch schon zur entsprechenden Konfliktlösung aufgemacht. Es muss aber zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Krieg die Macht Regie führt, die ihn ausgerufen hat, und durch ‚Terror‘ verletzte Sicherheitsinteressen auch eine Macht nicht zum Krieg berechtigen, die sich selbst als asiatische Großmacht versteht.
In je unterschiedlicher Weise sehen sich beide Länder so mit dem Ansinnen konfrontiert, den nationalen Konflikt, um den es ihnen geht, einer Friedenspflicht ein- und unterzuordnen, die für Amerikas Krieg funktionell ist. Diese Botschaft wird im Zuge des Irak-Kriegs von den USA ein weiteres Mal praktisch bekräftigt, und das ruft in Indien einigen Aufruhr hervor. Der Regierung entgeht nicht, dass sie mit der nationalen Sache, die sie in Amerikas Kriegsprogramm mit hineindefiniert hat, nicht zum Zuge kommt. Also geht sie zur befreundeten Weltmacht auf Distanz und ist offiziell gegen den Irak-Krieg
, mit dem Amerika seine Monopolaufsicht über Krieg und Frieden in der Region unterstreicht. Der pro-amerikanischen
nationalen Opposition entgeht gleichfalls nicht, dass die Militanz der Weltmacht ihrer Nation abverlangt, in der Grundsatzfrage ihres Verhältnisses zu Amerika Position zu beziehen. Sie hält aber an der politischen Aufwertung fest, die die Nation durch Amerika immerhin doch erfahren habe, seitdem sie sich zum Partner im Anti-Terror-Krieg erklärt hat. Sie will erstens das Gewicht nicht aufs Spiel setzen, das Indien dadurch erlangt hat, dass es auf dem Schachbrett der Strategen in Washington als pro-amerikanische Großmacht gegen China funktionalisiert und entsprechend mit Waffen und anderem unterstützt wird. Und sie setzt zweitens darauf, dass sich die Nation dann, wenn sie fest an Amerikas Seite bleibt, wenigstens ihre Chancen bewahrt, irgendwann doch ihr Sicherheitsinteresse mit dem der Weltmacht zur Deckung bringen zu können. Dass Indiens Großmacht-Ambitionen nur mit Amerikas Duldung eine Chance haben, gegen den Willen der Weltmacht jedenfalls keine, wissen so beide Seiten. Wie weit sie mit ihren Ambitionen in dieser Lage vorankommen können, versuchen sie dann auf unterschiedliche Weise auszutesten.
II. Eine neue Lage für die Bündnispartner in Europa: Vor- und Nachteilsrechnungen zwischen pro-amerikanischer Entschlossenheit und amerika-kritischer Distanz
1. Die ‚neue NATO‘: Eindeutige Klarstellungen zum Thema ‚Partners in Leadership‘
Formell gekündigt hat die Weltmacht das Militärbündnis mit ihren europäischen Kollegen und Konkurrenten nicht, nach wie vor legt sie Wert darauf, diese bei ihrer Weltordnungspolitik an ihrer Seite zu wissen. Mit der Funktion allerdings, in der die Partner für die Kriege der neuen amerikanischen Weltordnung vorgesehen sind, geht der Sache nach die Kündigung ihres Bündnisses mit Amerika einher. Mit dem Antrag an ihre traditionellen NATO-Verbündeten, sie möchten – über alle politischen Bedenken und gegensätzlichen Auffassungen hinweg – im Rahmen ihrer Bündnisverpflichtung ihre Infrastruktur für funktionelle Leistungen im Krieg gegen den Irak bereitstellen, stellen die USA klar, dass militärische Bündnispartnerschaft ab sofort eine ebenso einfache wie einsinnige Angelegenheit ist: Sie besteht darin, sich mit Leistungen bei der militärstrategischen Durchsetzung der amerikanischen Weltherrschaft nützlich zu machen. Damit machen die USA die geschätzten Partner mit einer Interpretation ihrer Pflichten als Mitglieder einer NATO bekannt, in der diese die ihnen so lieb gewordene sicherheitspolitische Geschäftsgrundlage ihres imperialistischen Wirkens einfach nicht mehr wiedererkennen können. Einen Krieg, der ausdrücklich ein Krieg der USA und kein NATO-Krieg ist, in dem also sie weder als politisch mitentscheidende Subjekte vorkommen noch sonst irgendein Gremium der NATO gefragt ist, in dem sie mit Sitz und Stimme vertreten sind, sollen sie als Kriegsfall nehmen, der auch sie betrifft, und zwar in denkbar eindeutiger Weise – als Aufmarschgebiet ihrer Führungsmacht. Als Subjekte eines Bündnisses haben sie bei der Definition der Sache, für die es tätig werden soll, nichts mehr zu beschließen: Die USA gehen – in schöpferischer Fortentwicklung des im ‚Kalten Krieg‘ gegen die sowjetische Bedrohung geltenden Grundsatzes – einfach davon aus, dass mit der Wahrnehmung ihrer Sicherheitsinteressen sich auch alle sicherheitspolitischen Nöte und Drangsale ihrer europäischen Partner praktisch und ohne Reste erledigen. Als Mitglieder der ja nach wie vor bestehenden Allianz sollen sie sich ihrem großen Verbündeten für Hilfsdienste zur Verfügung stellen, die der bei ihnen abruft, und damit ist die Definition der neuen NATO aus amerikanischer Sicht fertig: Freiheit und Sicherheit der Weltmacht USA ist der Wert, dem das Bündnis ab sofort verpflichtet ist, und die Verpflichtung ihrer Partner besteht darin, ihrer Führungsmacht unter Abstandnahme von ihren Interessen, die sie bei der kollektiven Bewirtschaftung des globalen Gewalthaushalts verfolgen, zu dienen.
Damit machen die USA mit einem Schlag alle sicherheitspolitischen Berechnungen gegenstandslos, auf deren Grundlage die europäischen Führungsmächte allein ihre erfolgreiche imperialistische Karriere hingekriegt haben. Diese haben sich ihrer Führungsmacht untergeordnet, um deren Macht für ihre Belange zu instrumentalisieren. Sie haben sich 50 Jahre lang für die Funktion eines europäischen Brückenkopfs im Krieg gegen die Sowjetunion hergegeben, um über die Rückversicherung bei der amerikanischen Militärgewalt sich selbst zu einer auch ordnungspolitischen Größe emanzipieren zu können. Und auch wenn deren erste nennenswerte Wortmeldung im ersten praktischen Ernstfall des Bündnisses, im NATO-Krieg auf dem Balkan, den Europäern schmerzlich die eindeutige Hierarchie in der Machtverteilung ihrer Allianz und damit auch die sehr beschränkte Reichweite ihrer ordnungspolitischen Kompetenz vor Augen stellte: Dank Amerikas Macht haben sie ihre Balkan-Ordnung hingekriegt. Genau dafür aber steht nach dem Willen der USA das Bündnis ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Aus der eindeutigen Rangordnung bei der Verteilung der militärischen Machtmittel leitet die Führungsmacht für ihre Partner ein nicht weniger eindeutiges politisches Gebot ab: Sie ordnen sich entweder dem amerikanischen Aufsichtsmonopol über die Welt mit unter – oder sie werden von der Weltmacht zur ‚Irrelevanz‘ marginalisiert und aus der Betreuung aller Weltaufsichtsfragen ausgemischt. Damit ist der für Europa spezifische Schleichweg, es auf der Grundlage einer durch Amerikas Macht gesicherten Weltordnung zur eigenen strategischen Großmacht zu bringen, definitiv zu Ende.
2. Die Antwort der Führungsmächte des ‚alten Europa‘: Notprogramme zur Kompensation des Wegfalls der eigenen imperialistischen Geschäftsgrundlage
Zu der Alternative, vor die sie von den USA gestellt werden, haben die europäischen Führungsmächte selbst keine anzubieten. Ihr großes Europa ist das imperialistische Subjekt gar nicht, das mit eigenen ordnungspolitischen Vorstellungen und Interessen in Konkurrenz zu denen Amerikas aufwarten könnte, und verfügt schon gleich nicht über die erforderlichen Mittel, solche überhaupt geltend zu machen. Also haben Europas Mächte mit der ihnen von Amerika eröffneten Alternative umzugehen, und sie tun dies auch, jede für sich.
Eine Fraktion – England, Spanien,… – entschließt sich dazu, dem NATO-Bündnisprinzip auch nach dessen von den USA vollzogener Aufkündigung einseitig treu zu bleiben. Diese Mächte setzen darauf, dass ihr eigener weltpolitischer Einfluss auch für die nähere Zukunft wohl nur darüber zu sichern und zu mehren sein wird, dass man stets konstruktiv an der Weltordnung mitwirkt, die Amerika schafft, also auch bei den Kriegen dabei ist, mit denen diese Ordnung vorangebracht wird. Sie zahlen den Preis, den eine Unterordnung unter das amerikanische Weltordnungs- und Gewaltmonopol in Anbetracht ihrer eigenen weltpolitischen Ambitionen allemal kostet, in der Berechnung, sich dann schon wieder irgendwie mit eigenen Ordnungsansprüchen und Aufsichtsrechten ins weltpolitische Geschäft einklinken zu können: Sie versuchen, sich auf dem Wege dezidierter Gefolgschaft gegenüber dem von Amerika angemeldeten Führungsanspruch selbst ein wenig zu einer Macht von weltpolitischem Gewicht emanzipieren zu können. Diesen Widerspruch zwingt ihnen Amerika auf, und sie entschließen sich dazu, vorerst mit ihm leben zu wollen.
Andere europäische Nationen – Deutschland, Frankreich,… – versuchen, sich dem US-Monopol in Weltaufsichtsfragen zu entziehen. Dass ihnen dies angesichts der Alternative, vor die sie gestellt sind, als Gegnerschaft gegen Amerika ausgelegt und entsprechend übelgenommen wird, wissen sie. Klar ist ihnen auch, dass sie sich diese Gegnerschaft angesichts ihrer eigenen Schwäche nicht leisten können, und aus beidem folgt für sie zweierlei: Erstens müssen sie einiges zur Behebung ihrer machtpolitischen Defizite tun und es sich demnächst leisten können, sich auch gegen Amerika zu behaupten. Und weil sie das gegenwärtig eben nicht können, müssen sie zweitens ihrer Absicht immer gleich das verlogene Dementi hinterherschicken, sich keinesfalls als Gegner Amerikas aufstellen zu wollen. Der deutsche Kanzler in einem Satz: Europa als Ganzes muss stärker werden
– einzig und allein deshalb, um fortan nicht als Vasall, sondern als Partner an der Seite Amerikas stehen
zu können. Selbstbewusste Emanzipation zu einem machtvollen weltpolitischen Subjekt, das dann – wie immer partnerschaftlich-einvernehmlich - mit Amerika die globalen Gewaltfragen betreut: So heißt hierzulande der aus der Not geborene Widerspruch, der aufgemachten Alternative zwischen Unterordnung oder Ausgrenzung nichts entgegensetzen zu können, sich ihr aber auch nicht beugen zu wollen.
Freilich: Wenn der deutsche Außenminister laut und deutlich mehr Militärkraft für Europa
(FAZ, 17.3.03) verlangt, dann haben Europas Führungsmächte schon begriffen, worauf es bei ihrem Projekt eines machtvollen imperialistischen Konkurrenzsubjekts jenseits aller Partnerschaftsschwüre anzukommen hat: ‚Entweder Weltmacht oder keine Macht‘ – das ist in den Worten eines anderen deutschen Reichskanzlers jedenfalls die Richtung, in die es zu gehen hat. Denn wenn die amtierende Weltordnungsmacht USA ihre Rechte und Interessen zu den weltweit maßgeblichen erhebt und den Rest der Welt einer Triage unterzieht, in der die Staaten nach den Kategorien 1. willig & fügsam, 2. unwillig & irrelevant oder 3. renitent & sicherheitsrelevant sortiert und entsprechend behandelt werden, dann steht damit fest, wie auf der Welt um Macht und Einfluss konkurriert wird. Genau so nämlich, durch die gewaltsame Durchsetzung des eigenen Verfügungsrechts über den Globus. Daraus ergibt sich für Europa unmittelbar, dass es als Konkurrent in dieser Weltordnung dasselbe auch tun können muss – oder es geht in ihr unter. Der imperialistische Gehalt des ‚Stärker-werden-Müssen‘, den der Kanzler und seine Freunde verschweigen und als quasi-anonymen politischen Sachzwang für die Zukunft Europas zitieren, weil ihnen die Grundregeln des imperialistischen Konkurrierens so selbstverständlich sind, besteht in nichts weniger als darin, ein machtpolitisches Subjekt zu werden, das in einer der Weltmacht vergleichbaren Weise den Rest der Staatenfamilie unter politische Aufsicht nimmt und unter Kontrolle hält. Eine Macht zu sein, die andere Staaten nicht nur mit guten Geschäften beeindruckt und von sich abhängig macht, sondern aus dieser Abhängigkeit auch politisches Kapital zu verfertigen versteht; als weltpolitischer Faktor
mit hinreichend bemessenen Gewaltmitteln ausgestattet zu sein, um sich diesen Staaten in Bezug auf ihre ‚vitalen Sicherheitsinteressen‘ erfolgreich als Schutzmacht gegen andere zu empfehlen, freilich mit denselben Mitteln auf Souveräne auch andersherum den letztinstanzlich entscheidenden Eindruck machen zu können und sie bis hin zur Androhung ihrer Existenzgefährdung zu dem Wohlverhalten zu erpressen, das man von ihnen will: Genau darauf kommt es für ein erwachsenes Europa
(Solana) ab sofort an.
So schließen sich die Europäer der Ansage der USA an, unter dem Titel ‚Terrorismus‘ weltweit anti-amerikanische Umtriebe verfolgen zu wollen, indem sie dieser globalen Konfrontation eine eigene europäische Bedeutung verleihen. Diese beinhaltet einmal ihre eigene Betroffenheit durch die terroristische Bedrohung
, die Europas Mächten entweder aus dem Umstand erwächst, dass sie als „Freunde“ Amerikas zum Zielobjekt von Anschlägen avancieren, oder daraus, dass sich die einschlägigen terroristischen ‚Netzwerke‘ bei ihnen tummeln. Sie betrifft aber auch die Ebene, auf der es darum geht, im Zuge von ‚Terrorbekämpfung‘ andere Staaten sicherheitspolitisch ins Visier zu nehmen, also sie und ihre Waffen selbst als Bedrohungsfall identifizieren und gegebenenfalls auch entwaffnen zu können: Nach Solana drängt sich (…) eine klare Haltung in jenen Fällen auf, wo weder gutes Zureden noch Sanktionen bestimmte Staaten davon abhalten, sich derartige Waffen zu beschaffen und mit ihnen zu drohen. In solchen Situationen, kritisierte Papandreou, begnüge sich die EU jetzt damit, entweder gut zuzureden, was in der Regel wenig bringe, oder aber die Logik eines präemptiven Militärschlags anderer passiv hinzunehmen.
(NZZ, 3./4.5.03) Doch so sehr die Europäer auch das von den USA definierte globale Sicherheitsproblem akzeptieren und von sich aus teilen: Sie sind damit konfrontiert, dass die USA dieses Sicherheitsproblem unter dem Titel ‚Terrorismus‘ zum Anlass nehmen, sich sehr einseitig an die Vollendung ihrer Weltordnung zu machen. Und weil man mit einer geltend gemachten europäischen Definitionshoheit bei der Frontziehung im ‚Anti-Terrorkrieg‘, bei der Sortierung von Freund & Feind und bei der etwaigen Beschlussfassung über Krieg & Frieden denselben Anspruch bestreitet, der als Monopol von den USA geltend gemacht wird, kann man seinen imperialistischen Aufbruchswillen so eben nicht publik machen. Die Macht, die allein ihn so überzeugend vorbringen könnte, wie man es will, ist man ja gerade nicht, die will man ja erst werden, und aus dieser Notlage resultiert das zweite notorische ‚muss‘, das der deutsche Kanzler als selbstverständlichen Sachzwang seines Euro-Imperialismus auf keinen Fall zu zitieren unterlässt: Dass man als weltpolitischer Faktor ernst genommen
(Fischer, FAZ, 17.3.03) werden will, und zwar unbedingt, steht fest – aber nur als dauerhafter Partner
Amerikas rechnet man sich – so, wie es um das Kräfteverhältnis bestellt ist, und vor allem in Anbetracht dessen, wie die Weltmacht mit Staaten verfährt, die sie der Gegnerschaft zu ihr auch nur verdächtigt – überhaupt Chancen aus, sich als dessen weltpolitischer Gegenspieler in Stellung bringen zu können.
An letzterem versucht man sich dann, im diplomatischen Überbau der UNO sowieso, aber schon auch auf der für die Konkurrenz in den entscheidenden Machtfragen adäquaten Ebene. Eine sicherheitspolitische Initiative für Europa
sucht man auf den Weg zu bringen, und die lässt an Eindeutigkeit erst einmal nichts zu wünschen übrig: Ins Auge gefasst wird die formelle Konstituierung eines europäischen Kriegswillens. Der Apparat wird projektiert, der die dazu entsprechenden europäischen Kriegsführungsfähigkeiten beschaffen, für integrierte, global einsetzbare militärische Potenzen sowie den Aufbau einer autonomen Planungs- und Führungskapazität unter EU-multinationalem Kommando sorgen soll. Über diese Reanimierung des alten Projekts einer EVU soll also endlich ein wirkliches sicherheitspolitisches Subjekt hinter ‚Europa‘ stehen, eine Gewaltpotenz zur Durchsetzung einer genuin europäisch-globalen Sicherheitsstrategie. Allerdings ist nicht nur die Idee alt: Auch der Weg, über den sich Europa als auch weltpolitisch entscheidende Größe zu konstituieren vornimmt, ist ganz der alte. So kommt es, dass ausgerechnet ein EU-Gipfel
, der so etwas wie eine strategische Großmacht Europa aus der Taufe heben will, doch nur wieder zu einem einzigen Dokument der Schwäche wird, von der man gerade loszukommen versucht. Den europäischen Kernmächten
Deutschland und Frankreich, die sich in bewährter Manier als Nukleus
einer europäischen Sache präsentieren, auf dass sie Gefolgschaft finden und darüber ihre Sache die Sache Europas werde, bleibt der Erfolg gründlich versagt. Im Namen der beabsichtigten europäischen Machtentfaltung gehen sie selbstverständlich davon aus, dass – über alle aktuellen politischen Gegensätze und Streitfragen hinweg – im Grunde doch die gesamte EU an der Geltendmachung eines europäisch definierten Sicherheitsinteresses interessiert sein müsste – statt dessen bringen sie einen Vierer-Gipfel
zustande, und das auch nur, weil in ihrer Gemeinschaft auch ein Briefkasten wie Luxemburg als Nation rechnet. Nach der einen zirkulierenden Sprachregelung haben sie die für ihr strategisches Sicherheitskonzept nicht gerade unwichtigen Nationen wie England, Italien, Spanien usw. gar nicht erst eingeladen, um nicht blamiert zu werden, nach einer anderen haben die ihre Einladung zum Treffen dankend ausgeschlagen. Beides läuft insofern auf dasselbe hinaus, als aus Großbritannien laut und eindeutig vermeldet wird, für wie grundverkehrt man in einem nicht eben unbedeutenden Teil Europas eine politische Selbstbehauptung gegen Amerika hält: Nach Auffassung des britischen Regierungschefs führte solches nur zu einer multipolaren Weltordnung
und damit unvermeidlich zur Rivalität
, ja gar zu einem neuen Kalten Krieg
, diesmal zwischen Amerika und Europa, weswegen es allein darauf ankäme, sich hinter dem einen dicken ‚Pol‘ zu versammeln, den es nun einmal gibt – und so dessen ‚Alleingang‘ zu verhindern. Daher sei die ‚strategische Partnerschaft‘, die er mit Amerika pflegt, auch der einzig erfolgversprechende sicherheitspolitische Weg für Europa und für Frankreich ganz speziell: Frankreich bleibt ein wichtiger Verbündeter für Großbritannien
(NZZ, 29.4.03), lässt der Premier die Franzosen wissen und bietet ihnen als besseren Ersatz für die angepeilte strategische Autonomie Europas sein Versprechen an, auf die Weltmacht bei etwaigen ‚Bestrafungsaktionen‘ mäßigend einzuwirken.
So wird aus dem Signal für den Aufbruch einer auch politischen Weltmacht Europas eine Blamage der großen Ambition, die nur wieder den Umstand offen legt, dass Europa erstens keine Macht ist und zweitens das, was es als einheitliches politisches Gebilde dennoch zu sein vorgibt, in zwei Lager dissoziiert ist, die ziemlich unüberbrückbare Gegensätze voneinander trennen: Die förmliche Konstituierung einer die Konkurrenz gegen Amerika endlich aufnehmenden Weltmacht scheitert allein schon am Unwillen maßgeblicher Mitglieder der Union, sich für einen europäischen Imperialismus gegen die Weltmacht herzugeben. Vorerst jedenfalls, denn selbstverständlich soll die Angelegenheit nach der Logik des Procedere im gesamteuropäischen ‚Zusammenwachsen‘ an Konvent und Ratsmitglieder zur förmlichen Beschlussfassung überreicht werden, und dann sieht man ja weiter. Und der deutsche Fischer, Europas erster Außenminister in spe, möchte die Verpflichtung der EU-Mitglieder zum gemeinsamen strategischen Handeln in der EU-Verfassung verankert wissen – mit imperialistischen Selbstverpflichtungen, die im Grundgesetz stehen, hat Deutschland ja schon einmal glanzvollen Erfolg gehabt.[7]
3. Das ‚neue Europa‘: Kleine Rückschritte im gesamteuropäischen Einigungswerk
Die Weltmacht ist nicht nur destruktiv und kündigt die transatlantische Waffenbrüderschaft mit ihren traditionellen Partnern auf. Sie geht auch entschlossen konstruktiv zu Werk, schafft sich die neue NATO
, die nach ihrem Geschmack ist – und destruiert damit auch noch den Besitzstand ein wenig, zu dem es Europa dank seiner Rückversicherung durch die amerikanische Gewaltpotenz gebracht hat. Die USA werden in den Staaten im Osten Europas, die soeben zu Mitgliedern von NATO und EU gekürt wurden oder noch um die Mitgliedschaft in dem einen oder anderen Bündnis ersuchen, mit dem interessanten Antrag vorstellig, sich in die amerikanischen Kriegsplanungen einbeziehen zu lassen. Sie sollen ihren nationalen Luftraum amerikanischen Flugzeugen öffnen, ihr Land für amerikanische Truppen und anderes Kriegsgerät bereit stellen, und zwar über den aktuellen Kriegsanlass hinaus – und damit gewichten die USA die Grundsätze der Staatsräson etwas um, die diese postkommunistischen Staaten gerade erst als Garanten ihres nationalen Erfolges für sich entdeckt haben. Die Integration in das EU-Wirtschaftsbündnis sollte ihnen in ökonomischer Hinsicht ihre zukünftigen Lebensgrundlagen liefern, die Mitgliedschaft in EU und NATO mit ihren beiden, einander ergänzenden Schutzgewährungen ihre sicherheitspolitischen Drangsale gegenüber ihrem übermächtigen russischen Nachbarn befriedigen. Und wenn den Regierungen Polens, Tschechiens und Ungarns jetzt von Washington mitgeteilt wird, dass ihnen als selbstverständliche Konsequenz ihrer NATO-Mitgliedschaft die Verpflichtung zufällt, die Kriege Amerikas ein Stück weit auch zur eigenen Sache zu machen, dann mutet dies ihnen die Entscheidung zu, in einer Alternative Position zu beziehen: Sie werden zu einer Parteinahme für die Bündnis-Führungsmacht aufgefordert – und mit der zugleich dazu, gegen die zwei Anti-Kriegs-Mächte Position zu beziehen, die das europäische Wirtschaftsbündnis anführen und mit denen die Geschäftsbeziehungen laufen, an denen die eigene ökonomische Zukunft hängt. Sie, die frischgebackenen NATO-Mitglieder der dritten bis vierten Garnitur, werden aufgewertet und von ihrer Führungsmacht dazu ermächtigt, mit ihr zusammen das Bündnis zu dem einseitigen Dienstleistungsbetrieb zu machen, wie er Amerika vorschwebt – und sollen dabei die gewichtigen westeuropäischen Bündnispartner einfach ignorieren, die bekanntlich einer multinationalen Eingreiftruppe in untergeordneten Diensten an den Schauplätzen des US-Weltordnungskrieges nicht viel abgewinnen können.
Der ihnen eröffneten Alternative können die ost- und südosteuropäischen Staaten allerdings einiges für sich abgewinnen. Sei es, dass ihnen in ihrer antirussischen Fixiertheit die Rückversicherung durch die amerikanische Militärmacht ohnehin über alles geht; sei es, damit sie in der NATO an Gewicht gewinnen oder dieses gewinnen wollen, um dann auch in der EU gewichtiger zu sein; sei es, dass sie mit besonders bekundeter Dienstfertigkeit ihre unbedingte Aufnahmewürdigkeit für eines der beiden Bündnisse oder für beide zusammen demonstrieren oder mit amerikanischen Standorten einfach nur das Geld verdienen wollen, das im Land ansonsten fehlt: Die neuen EU-Mitglieder im Osten und die Länder, die das demnächst werden sollen, geben sich zu Dienstleistungen an der amerikanischen Sache
her. Sie stellen sich – mehr oder weniger entschieden, manchmal auch leicht widerstrebend, mit innenpolitischem Zähneknirschen – hinter den amerikanischen Krieg, kommen der Forderung nach logistischer Unterstützung nach, überlassen ihren Luftraum und die nationale Infrastruktur wie verlangt der Entfaltung amerikanischer Militärgewalt und überstellen die angeforderten Flughäfen und Militärstützpunkte dem Kommando der US-Armee. In Ungarn dürfen US-Ausbilder ausgewählte Exil-Iraker für ihren baldigen Einsatz daheim trainieren, Tschechen und Slowaken schicken zur Sicherung amerikanischer Verbände Personal an den Golf, das sich mit Chemie und Viren auskennt usw. So spalten – und schwächen – die USA ihre Konkurrenzmacht Europa, indem sie gegen die beiden EU-Führungsmächte, die sich ihnen nicht unterordnen wollen, auf das neue Europa
hinwirken, das sich im Idealfall aus ihren Vasallen zusammensetzt. Doch auch allein schon so erreichen sie, dass es neben und parallel zu der binneneuropäischen Hierarchie, die von den in Brüssel residierenden Instanzen verwaltet wird, in Europa noch ein anderes zwischenstaatliches Unterordnungsverhältnis gibt, das nämlich, das die USA selbst, mit ihrer militärischen Präsenz in einigen Staaten und der damit einhergehenden politischen Beziehungspflege arrangieren. Ihre neuen Alliierten und Militärbasen in Osteuropa sind die praktische Relativierung des von der EU mit ihrem Projekt ‚Osterweiterung‘ geltend gemachten Anspruchs, ihr Hinterland bis zu den Grenzen ihres alten Hauptfeindes als ihren eigenen strategischen Machtbereich politisch in Besitz zu nehmen. Eine politische Kontrollaufsicht, die man sich mit Anleihen bei der Macht Amerikas anmaßt, ist eben keine, und das stellt die Weltmacht praktisch klar: In den Staaten und Regionen Europas, nach denen sie für ihre künftigen Kriege Bedarf hat, eröffnet sie Zweigniederlassungen ihrer Macht.
Zur Beschädigung des gesamteuropäischen Machtgebildes kommen daher noch einige politische Erosionserscheinungen des Gemeinschaftswerks hinzu, zu dem die Europäer es schon gebracht haben. Einfacher wird die Aufgabe, Europa politisch zu einen
, für die maßgeblichen Betreiber dieses Einigungswerks jedenfalls nicht, wenn sich die neuen Mitglieder aufgrund ihrer speziellen Anbindung an Amerika jetzt dazu ermächtigt sehen, sich dem herrschaftlichen Regime auch einmal nachhaltig entziehen zu können, dem sie von Brüssel aus unterworfen werden. Und entschärft wird die innereuropäische Konkurrenz in der Frage, welcher Nation die Rolle des gesamteuropäischen Hegemon zukommt, der alle anderen unter seinen Führungsanspruch bringt und darüber vereint, auch nicht gerade, wenn in ihr demnächst Staaten mit den Rechten eines Vollmitglieds der EU mitmischen, die sich als dezidierte Parteigänger der Weltmacht positioniert haben, gegen die sie im EU-Verbund zur Konkurrenz antreten: Da werden dann manche innereuropäische Konkurrenz- und Machtfragen sehr schnell auch zu Fragen des außereuropäischen Macht- und Gewaltverhältnisses, nämlich zu solchen, die in Gestalt ihrer neuen Freunde und Allianz-Partner unmittelbar auch immer die Machtposition betreffen, die sich die USA in Europa neu verschafft haben. So hat die Weltmacht beispielsweise in Polen nicht nur einen neu geworbenen Bündnispartner, sondern im Land selbst auch schon nicht unbeträchtliche Interessen implantiert und entsprechend zu schützen: Gegen namhafte europäische Konkurrenten setzen sich die USA durch und binden das Land durch Kredite zur Ausrüstung der Luftwaffe mit US-Fliegern als Schuldner an sich, US-Multis investieren Milliarden in polnische Technologie-, Pharma– und Energieunternehmen, Motorola kümmert sich ums Handy-Wesen. So verfestigt man ‚gute Beziehungen‘ mit einem Partner, der ansonsten ausgiebig damit zu tun hat, die Schäden zusammenzurechnen, die ihm vorläufig aus seiner EU-Mitgliedschaft erwachsen.
Was dem inneren politischen Bestand des europäischen Einigungswerks schließlich und endlich auch nicht unbedingt gut bekommt, ist der Umstand, dass in den osteuropäischen Staaten selbst diese neue, proamerikanische Regierungslinie keineswegs unumstritten ist. In denen waren ja bis vor kurzem noch andere Vorstellungen vom nationalen Erfolgsweg und der Räson des Regierens maßgeblich, und wenn sich national verantwortlich denkende Politiker an diese erinnern, haben sie schon das entscheidende Argument, sich gegen ihre Regierung in Stellung zu bringen: Die vergeigt den Erfolg der Nation, weil sie die von dem ökonomisch erfolgversprechenden Weg, der EU heißt, abschneidet und die bisher schon eingerichteten Beziehungen zu deren entscheidenden Mächten aufs Spiel setzt. Diese beiden, um nichts weniger als den richtigen nationalen Weg streitenden Positionen bestimmen mal so, mal anders die politische Streitkultur im neuen Europa
. Kaum vermeldet der tschechische Staatspräsident per Interview, dass sich ausländische Truppen in seinem Land bei der Beförderung der eigenen nationalen Sache noch nie ausgesprochen positiv ausgewirkt hätten und dies daher auch für amerikanische Soldaten gelte, geben Ministerpräsident und Außenminister des Landes zu Protokoll, dass sie dies im Fall amerikanischer Truppen ziemlich genau entgegengesetzt sehen; der Verteidigungsminister lässt sogar wissen, dass entgegenlautende NATO-vertragliche Vereinbarungen mit Russland absolut nichts mehr zählen und er US-Stützpunkte in Tschechien sehr begrüßen
(SZ, 5.5.03) würde. Und wenn Ungarns Ministerpräsident sich der tiefen Freundschaft seines Landes mit den USA rühmt und einem starken Europa
das Wort redet, das sich auf gar keinen Fall gegen Amerika aufstellen dürfe, dann hat er nicht nur einige starke Europäer, sondern auch eine nationale Opposition im Land gegen sich, usw. Weil sie um die Unverträglichkeit beider Seiten miteinander wissen, versuchen mehr oder weniger alle diese osteuropäischen Regierungen, durch kunstvolles politisches Lavieren ihre Parteinahme für Amerika nicht in eine ernsthafte Beschädigung ihrer Verbindungen mit Europa ausarten zu lassen. So haben sie ihre Emanzipationsbemühungen vom Leiden an einer allzu einseitigen Abhängigkeit von Europa immerhin dazu gebracht, mit den Erpressungen seitens zweier mächtiger Protektoren kalkulierend umgehen zu dürfen.
4. Innere Zerwürfnisse bei den NATO-Partnern in Europa
Die Entscheidungen, welche die nationalen Regierungen in Europa angesichts der drohenden Anfrage aus Washington – ‚Pro oder Contra Amerika?‘ – getroffen haben, führen nicht nur zu einer Spaltung der NATO und der Europäischen Union. Sie rufen außerdem gerade in den europäischen Hauptnationen tiefe Zerwürfnisse über die richtige außenpolitische Linie
hervor. Die Aufkündigung des nationalen Konsenses innerhalb der ‚politischen Klasse‘, der die weltpolitische Ausrichtung betraf, die der Nation maximalen Nutzen sicherte, kündet davon, dass die kriegerische Neuordnung der globalen Gewaltverhältnisse durch die USA die Staatsräson ihrer traditionellen Verbündeten unhaltbar macht. Wenn sich die Tragweite und Angreifbarkeit der jeweiligen regierungsamtlichen Position erst im Zuge der Polarisierung an der diplomatischen Irakkriegsfront so richtig offenbart, ist auch das kein Zufall: Die Konfrontation zwischen transatlantischer und europäischer „Solidarität“ ist eben von keiner der Regierungen beabsichtigt, weder von denen, die aus dem Gefolgschaftsimperativ der Weltmacht eine Chance für ihre Nation machen wollen, noch von denen, die zur aktiven Prüfung übergehen, wie viel Einspruch die Amerikaner zu dulden bzw. zu berücksichtigen bereit sind.
Großbritannien
Dieser Partner möchte seine spezielle Beziehung
zu den USA bestätigen: auch im Krieg gegen den Irak, den er noch vor einem Jahr jenseits der ‚roten Linie‘ verortet hatte, und auch unter der Maßgabe eines amerikanischen Führungsmonopols, mit dem der US-Präsident den Verbündeten unmissverständlich seine Tagesordnung vorschreiben will. Eine massive Kriegsbeteiligung samt der Bereitschaft zum Blutopfer
soll laut Premierminister Blair das weltpolitische Gewicht des Landes sichern, indem es aus den Siegen der Hegemonialmacht eigene Vorteile zieht: Die bedingungslose Treue zur Weltmacht soll den Einfluss Londons auf deren Handeln ermöglichen, in seiner Funktion als transatlantische ‚Brücke‘ soll England die skeptischen Kontinentaleuropäer in die amerikanische Mission einbinden und dem Land darüber die ersehnte Führungsrolle im Herzen Europas
verschaffen. Gegen diese urbritischen nationalen Berechnungen hätte kein Politiker der Insel irgendetwas einzuwenden, das nicht gerade an pazifistischen Neigungen laborierende Volk ebenso wenig – wenn sie nur aufgehen würden! Daran aber zweifelt eine ganze Reihe von Politikern, vor allem auch solche in Blairs eigener Partei und sogar Mitglieder seines Kabinetts. Und der Zweifel wächst in dem Maße, wie die US-Regierung das britische Bestehen auf einer allseits anerkannten UNO-Kriegslegitimation und die dafür nötigen Zugeständnisse zurückweist und sich die deutsch-französisch-russische Koalition des diplomatischen Widerstands herauskristallisiert.[8] Das Kalkül, die antiamerikanischen Papiertiger in Paris und der notorische Pazifismus
Deutschlands (haha!) würden – wie immer
– am Schluss schon einknicken, blamiert sich. Damit stürzt die Brücke über den Atlantik im Kreuzfeuer des Iraks ein
(The Guardian, 11.2.), wie die Meinungsmacher feststellen, und die Hoffnung Blairs auf eine europäische Vorreiterrolle
gleich mit. Das schlägt aufs patriotische Gemüt. Unter der Anleitung der professionellen Medienmafia kommen zeitweilig 86% der Statisten im Volk zu der Überzeugung, dass einer britischen Kriegsbeteiligung jeder nationale Sinn abgeht, eine solche vielmehr die Nation in ein gefährliches Abseits manövriert – und dass dieser Krieg folglich zutiefst sinnlos
und ungerecht
ist. Die nationalistische Sorge, dass Tony bloß den Pudel
von Bush gibt, statt womöglich in Distanz zum amerikanischen Alleingänger eine gemeinsame EU-Position zu fördern und so an Statur mit und in Europa zu gewinnen, lässt zwei Millionen Leute zur größten Demonstration der Geschichte
zusammenkommen, um gegen einen Irakkrieg, genauer: gegen die Missachtung des demokratischen Volkswillens durch den Bush-Knecht Blair zu protestieren. Unter entsprechenden Parolen: Warum Irak? Warum jetzt? Die Tatsachen rechtfertigen keinen Krieg.
Kein Mandat, in den Krieg zu ziehen. Ein Mann gegen das britische Volk. In Großbritannien zumindest ist dies jetzt Tony Blairs Krieg, und er ist allein.
Ein Drittel der Labour-Abgeordneten versagt dem Führer die Zustimmung zur Kriegsresolution; Minister Cook, selbst ehemaliger Außenminister des Vereinigten Königreiches und deshalb von untadeligem Ruf, tritt von seinem Amt zurück; die Presse schimpft – vereinigt in dem Ruf aller „Kriegsgegner“, Großbritannien müsse sich der Rolle eines Vasallen der USA verweigern, die an die Stelle einer echten Partnerschaft
getreten sei. Die im Weißen Haus beschlossene gewaltsame Kündigung der überkommenen Weltordnung inklusive der die Bündnisse bestimmenden Geschäftsordnung sorgt so auch und gerade bei Präsident Bushs treuestem Alliierten für einen ordentlichen Kollateralschaden, noch bevor der Krieg begonnen hat. Sie spaltet die Regierungspartei, macht aus einer erfolgreichen Blair-Herrschaft einen Sturzkandidaten
und Idealisten
und zerstört fürs Erste die Einheit von Staat und Volk in der elementaren Frage von Krieg und Frieden – und das am Vorabend des Einsatzes von mehr als 30.000 ‚Wüstenratten‘ für den Regimewechsel im Zweistromland.
Deutschland
Dieser jahrzehntelange Muster-Verbündete der USA in der Nato hat die sicherheitspolitische Rückendeckung durch die einzig verbliebene Weltmacht immer als unerlässliche Kondition für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts einer selbständigen euro-imperialistischen Machtentfaltung betrachtet. Das instrumentalistische Konkurrenzkalkül mit der und gegen die US-Vormacht ist es auch, welches unmittelbar nach dem 11.9.2001 zur Bekundung jener bedingungslosen Solidarität
der Bundesregierung mit den USA führt, die manchem national-gesinnten Beobachter als allzu bedingungslos erscheint. Das ist sie jedoch keineswegs. Sie ist vielmehr der aufdringliche Antrag, als zuverlässiger Freund und wertvoller Verbündeter der terroristisch angegriffenen USA anerkannt zu werden – und deshalb auch als partnerschaftliches Mit-Subjekt bei der unvermeidlichen Vergeltung, sprich: bei der angesagten global-imperialistischen Befriedungsmission Gehör und Berücksichtigung zu finden. Erst aufgrund der praktischen Zurückweisung dieses Anspruchs durch die Bush-Regierung erklärt die rot-grüne Regierung ihre Nicht-Beteiligung an einem gewaltsamen Regimewechsel im Irak, um ein Beispiel dafür zu setzen, dass unter Freunden
auch abweichende Meinungen
, d.h. gegensätzliche Staatsinteressen akzeptiert werden müssen. Ein Test, der ebenfalls negativ – nämlich mit einer partiellen Ächtung des isolierten
Deutschland – endet und damit zu einer prekären Ausgrenzung der Nation zu führen droht. Diese Konsequenz des Versuchs zur Selbstbehauptung gegen den amerikanischen Unilateralismus
wird nicht nur zum Nährboden einer Friedensbewegung, die deutsche Konkurrenzambitionen und nationale Schadensbegrenzungspolitik mit einem löblichen Anti-Kriegs-Standpunkt ihrer gewählten Volksvertreter verwechselt und deshalb Schröder und Fischer mit Demonstrationen und Lichterketten den Rücken gegen die amerikanischen Kriegstreiber
stärkt. Sie wird darüber hinaus zum Angriffspunkt für die christlichen Oppositionsparteien, welche immer entschiedener die – altbewährte – pro-amerikanische Staatsräson der BRD gegen den rot-grünen Anti-Amerikanismus
hochhalten, deren Grundlage vom Großen Bruder in Übersee gerade ausgehebelt worden ist. Wenn Kanzler Schröder den Irakkrieg als Fehler
bezeichnet und gleichzeitig die deutsche Bereitschaft zur Erfüllung der Bündnispflichten
– logistische Unterstützungsleistungen für den US-Krieg, die nicht so heißen dürfen – beteuert, so fährt Frau Merkel nach Washington und betont den Standpunkt der anderen Hälfte Deutschlands, dass WIR auf der Seite der Amis stehen – und das schließt alle Maßnahmen ein
, womit die kriegerische Invasion des Irak gemeint ist. Das natürlich nicht deswegen, weil sie seit Neuestem einen Überfall Saddams mit Massenvernichtungsmitteln befürchtet, sondern weil sie darauf beharrt, dass Deutschland es sich nicht leisten kann, den Amerikanern die geforderte Zustimmung zu ihren Kriegen zu verweigern, jedenfalls nicht, ohne im Hinblick auf seine Interessen massiven Schaden gewärtigen zu müssen. Daran, so überzeugt ein Blick aufs militärische Kräfteverhältnis die CDU-Vorsitzende, kann auch eine kraftlose deutsch-französische Achse mit solchen Ländern wie Russland und China
nichts ändern. Sichtbar wird auf diese Weise das Dilemma einer europäischen Mittelmacht, deren weltwirtschaftliche und weltpolitische Ambitionen weit über die eigenen Fähigkeiten hinausreichen, auf die es ab sofort wieder hauptsächlich ankommt – auf die kriegerischen Potenzen nämlich. Das US-Programm zur Eroberung des Weltaufsichtsmonopols deckt diesen Widerspruch der Bündnisnation Deutschland auf und führt folgerichtig zur Entzweiung der großen Volksparteien über den richtigen Weg
, den es einfach nicht gibt. Dass die Regierung wie die Opposition dasselbe Drangsal ihrer relativen Ohnmacht bewegt, bleibt bei alledem kein Geheimnis: Im einzigen Ausweg, den sie beide sehen, sind sie sich einig: Eine Europäische Verteidigungs-Union
muss her, denn – wie der Kanzler es so schön ausdrückt –: Wer für sich in Anspruch nehme, Nein zu einem Krieg zu sagen, der müsse auch in der Lage sein, aus eigener Kraft etwas zu leisten.
(SZ, 27.3.) Im Klartext: Der muss selbst Ja zum Krieg sagen und ihn überzeugend führen können, dafür also die Mittel und ein einheitliches Kommando bereit stellen, um für ein NEIN zu Amerikas Kriegen bei Bedarf auch praktisch einstehen zu können und nicht irrelevant
zu werden. Wie ein solcher euro-imperialistischer Kraftakt gelingen soll, ist allerdings schon wieder ein – altbewährtes, jetzt verschärftes – Dilemma, denn dem steht inzwischen nicht mehr nur die Geschäftsordnung der Europäischen Union als Verein von Vaterländern entgegen, sondern auch eine gediegene Spaltung in der Frage des aktuell richtigen Maßes von Pro- und Antiamerikanismus.
Spanien
Dieser Partner erlebt ein besonders eindrucksvolles nationales Zerwürfnis: erstens zwischen der Regierung Aznar samt der sie mit absoluter Mehrheit stützenden ‚Volkspartei‘ und dem Rest der Parteien, zweitens zwischen der Regierung und der Bevölkerung, die zu über 90% NEIN zum Krieg und vor allem zum regierungsamtlichen spanischen JA sagt. Eine Gelegenheit für ein aufstrebendes Spanien sollte er werden, der in Washington eingeläutete Antiterrorkrieg. Ausgangspunkt ist die Vision des europäischen Südstaates, sich als neben England treuester Allianzpartner der USA zu profilieren und sich so in die erste Liga der Weltordnungsimperialisten empor zu dienen, darüber die so schmerzlich empfundene Behandlung Spaniens ‚unter Wert‘ auch innerhalb der EU zu überwinden und nachhaltigeren Einfluss auf deren Politik und die Gestaltung ihrer künftigen Machtordnung zu erlangen. Dass die Aznar-Regierung sich von Anfang an und mit demonstrativer Beflissenheit in die Koalition der (Kriegs-)Willigen hineindefiniert, basiert auch in diesem Falle auf der Unterstellung, die anderen, gewichtigeren und gerade wegen ihrer Autonomieansprüche zögernden EU-Nationen, namentlich Deutschland und Frankreich, würden schließlich nicht umhin kommen, sich an die Seite der unverzichtbaren Ordnungsmacht Amerika zu stellen – wo Spanien dann, in positiver Differenz zu den Zaudernden, schon längst wäre. Dieser kleine ‚Ick-bin-allhier‘-Triumph bleibt dem Bush-Freund Aznar versagt, und deshalb wird er immer mehr zur Zielscheibe patriotischer Kritik, je klarer und fester die deutsch-französische Achse ihren Widerstand gegen den US-Gleichschaltungswillen präsentiert und damit über Alteuropa
hinaus die Mehrheit im UNO-Sicherheitsrat gewinnt. Wie Blair in England als poodle
, so gilt Aznar plötzlich als payaso de segunda fila
(Hanswurst der zweiten Reihe) in Diensten der Amerikaner, der das stolze – und selbstverständlich friedliebende – Spanien dem Rambo aus Amerika ausliefert. Der Regierungschef sieht sich zu Rechtfertigungen genötigt: Spanien solle nie wieder nichts sein
oder in der Ecke stehen
.[9] Man werde dank der Partnerschaft mit den Nordamerikanern von denen künftig als konkurrierende Vor- und Investitionsmacht in Lateinamerika anerkannt und nicht ausgebootet. Man bekomme CIA-Berichte über die ETA und die Aufnahme ihres „politischen Arms“, der inzwischen verbotenen Baskenpartei Batasuna, in die amerikanische Liste der internationalen Terrororganisationen. Man werde im Nahen Osten beim Aufbau dabei sein – und außerdem sei die logistische Unterstützung der US-Interventionsarmee mit 3 Schiffen und 900 Mann ohnehin nichts weiter als ein Akt humanitärer Hilfe
. Es nützt ihm nichts. Die Einheitsfront der Opposition macht eine gnadenlose Gegenrechnung auf, die den Erfolg der regierungsoffiziellen Berechnungen bestreitet: Die Rolle eines – zudem noch militärisch impotenten – Vasallen bringe Spanien außer Chef-Besuchen auf der Texas-Ranch nichts ein, das Land verspiele im Gegenteil seinen guten Einfluss bei den lateinamerikanischen Staaten und in der arabischen Welt, was die Geschäftsbeziehungen gefährde; die US-Geheimdienste könnten einen ETA-Mann doch nicht von einem kolumbianischen Geschäftsmann unterscheiden; vor allem aber spalte Aznar Europa, indem er die Osteuropäer gegen den deutsch-französischen Motor der EU aufhetze – und vergeige damit Spaniens eigene und entscheidende Zukunftsperspektiven in und mittels der Europäischen Union. Spanien wird zum Dauerprotest-Schauplatz, Millionen fordern den Rücktritt eines Regierungschefs, der den Volkswillen mit Füßen tritt
. Die Mörder, Mörder
-Rufe der braven Staatsbürger gelten diesmal nicht der ETA, sondern den Regierungsmitgliedern, ihre Parolen bezichtigen den obersten Staatsmann als vaterlandslos-unverantwortlichen Gesellen: Aznar, lass den Cowboy und säubere die Strände vom Öl!
Wir sind das alte Europa. Aznar: Verräter
. Eier gegen Personen und Steine gegen diverse Parteibüros unterstreichen den Massenzorn, der sich nicht zuletzt dadurch ins Recht gesetzt sieht, dass sich die Sozialistische Partei und die Vereinigte Linke zusammen mit den nationalistischen Basken und Katalanen an die Spitze des Protestbewegung stellen. Dies wiederum lässt den Regierungschef das Auseinanderfallen Spaniens
befürchten – den laufenden Wahlkampf stellt er unter das Motto, nur seine Partei könne die Einheit des Vaterlandes und die Demokratie gegen die Eier-, Steine-, und (demnächst) Bombenwerfer
retten. So polarisiert die Entscheidung für die Freundschaft mit Amerika
die spanischen Parteien und Staatsbürger, weil sie Spanien zum Mit-Protagonisten des Widerstands gegen den Emanzipationskurs
der EU-Hauptnationen macht und darüber einen regelrechten Machtkampf in Europa und seinen neuen Ostgebieten entfacht.[10]
Frankreich
hingegen bildet eine glorreiche Ausnahme: Kein inneres Zerwürfnis über die richtige Antwort auf die amerikanische Herausforderung, statt dessen steht die Nation – bis auf Weiteres – geschlossen wie schon lange nicht mehr hinter ihrer Führung. Dass Monsieur Le Président der amerikanischen Hypermacht
die Stirn bietet, indem er erst auf der multilateralen
UNO-Verfahrensordnung besteht und dann eine Achse mit Deutschland und Russland (und China) für ein diplomatisches Nein! ins Feld des Sicherheitsrats führt, bringt ihm die Zustimmung des Volkes wie der politischen Parteien von Rechtsaußen bis zu den Kommunisten. Letztere, in Sachen Trikolore-Nationalismus unüberbietbar, haben nur die Sorge, dass der Mann womöglich wieder umfallen könnte angesichts der Pressionen der USA und fordern deshalb Weiter so!
.[11]
Chirac gilt als Mann in den Fußstapfen De Gaulles, der als personifizierte Prätention einer autonomen weltpolitischen Rolle von La France, das sich amerikanischer Bevormundung nicht beugt, in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Der Grund dieser patriotisch-ideologischen Zufriedenheit ist kein Geheimnis. Mit Friedensliebe hat er jedenfalls nichts zu tun, wie der Präsident selbst immer wieder betont: Frankreich ist kein pazifistisches Land
(El País, 23.2.) und kann jederzeit und wo auch immer in der Welt intervenieren
(die Verteidigungsministerin). Die Nation hat schon immer ihre imperialistischen Interessen verfochten, ihre Kriege dabei als Sache von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit moralisch überhöht und als zivilisatorischen Dienst an der Menschheit präsentiert. Heute scheint das Ideal eines von Frankreich angeführten anti-amerikanischen Europa, das die Grande Nation seit De Gaulle verinnerlicht hat, zum ersten Mal ein Stück wahr zu werden – jedenfalls im Bewusstsein von Volk und Führung. Dass die Praxis dieses Ideals sich vorwiegend auf der Bühne des – daher um so nachdrücklicher inszenierten – diplomatischen Scheins abspielt, wird den Franzosen oben wie unten zwar um so schmerzlicher bewusst, je erfolgreicher die amerikanische Eroberung vorankommt, irritiert sie aber nicht wesentlich. Sie sehen Deutschland – endlich – aus der Rolle des amerikanischen Musterschülers fallen und hoffen, ab sofort gemeinsam mit dem deutschen Partner die längst propagierte militärische Stärkung der EU in Angriff nehmen zu können – so dass sich das Selbstbewusstsein der französischen Nation nicht länger an ihrer letztlich beschränkten, der Konkurrenz mit einer Weltmacht doch nicht ganz gewachsenen Gewaltpotenz bricht.
5. Trotz und wegen alledem: „Die Verbesserung der transatlantischen Beziehungen“ tut dringend Not
Das Scheitern der gesamteuropäisch-nationalen Lebenslüge, es über die berechnende Unterordnung unter die amerikanische selbst zu einer europäischen Großmacht bringen zu können, richtet bei den Betreibern dieses Projektes also einiges an. Das Angebot der Führungsmacht, sich zwischen Gefolgschaft und Unterordnung oder weltpolitischer Irrelevanz und Ausgrenzung zu entscheiden, ist für sie und ihre Ambitionen zwar keines. Zurückweisen aber können sie es schlechterdings nicht, also versuchen sie, das Beste für sich daraus zu machen: Die einen probieren es mit einer Unterordnung, die ihnen weltpolitische Relevanz zu sichern verspricht. Die anderen verweigern im Namen des Rechts auf eigene weltpolitische Relevanz Amerika die Gefolgschaft, wollen deswegen aber nicht ausgegrenzt werden. Und im Austesten, wie weit man sich Amerika gerade noch unterordnen muss bzw. widersetzen kann, um seine eigenen imperialistischen Erfolgsperspektiven nicht gleich begraben zu müssen, definieren sich Europas Mächte ihr jeweiliges Verhältnis zu Amerika dann neu zusammen. Diesen Definitionen und den eventuellen Reaktionen, die sie daraufhin aus Washington erfahren, ist dann zu entnehmen, wie es um das berühmte ‚transatlantische Verhältnis‘ bestellt ist.
Doch soll es sich bei diesem berechnenden diplomatischen Umgang mit den neu aufgeworfenen Gegensätzen zwischen Amerika und Europa – wie man von den hiesigen Sachverständigen aus Politik und Öffentlichkeit erfährt – seltsamerweise um so etwas wie den Gegenstand einer politischen Großreparatur handeln. Zwischen beiden Seiten des Atlantiks hat sich
, hört man, im Zuges des Irak-Kriegs der Stand der Beziehungen verschlechtert
, und mit dieser diplomatischen Sprachregelung, die ohne Bezugnahme auf den Inhalt der kollidierenden Rechtsstandpunkte und Interessen das politische Verhältnis zwischen Europa und den USA so ganz grundsätzlich bilanziert, wird man sogleich dazu eingeladen, den oder die Schuldigen am schlechten Klima
beim Namen zu nennen: Vor allem der religiös allzu inspirierte Bush
, der sich von seiner Mission
– man denke nur: – nicht abbringen lässt
; dann der zwar im Grunde richtig
, doch auch stur
und eigensinnig handelnde
deutsche Kanzler; Frankreichs Chirac, der für seinen französischen Großmachtstraum
zu viel riskiert
hat und womöglich selbst den Machtrausch
hat, den er Amerika vorhält; und ein Brite, der uneinsichtig
Europa spaltet
; oder alle zusammen, weil zwischen Europas politischer Kultur
und den Hardlinern in Washington
die Chemie nicht stimmt
, sie menschlich nicht miteinander können
, sich nicht besonders gut verstehen
, einfach kein Draht ins Weiße Haus
da ist und sich die Partner am Ende der Leitung wohl deswegen auch nicht verständigen können
. Summa summarum spricht viel für die Hypothese einer Kollektivschuld fürs schlechte politische Klima, und damit gilt als ausgemacht, was allein das politische Gebot der Stunde sein kann: Wenn so viel Porzellan zerschlagen
ist und es so schlecht um die transatlantischen Beziehungen
bestellt ist, dann kommt es darauf an, Scherben zu kitten
und das Verhältnis zwischen beiden zerstrittenen
Lagern wieder zu verbessern
– und schon wieder wird der anteilnehmende Zeitgenosse gleich mehrfach auf den Holzweg geschickt: Erstens soll man mit dieser Lagebestimmung einfach mal gründlich ignorieren, wer aus welchem Grund, mit welchem Zweck und mit welchem Mittel für das schlechte politische Geschäftsklima zwischen den alten Kumpanen des Westens gesorgt hat. Dass da im Zuge des amerikanischen Weltordnungskrieges ziemlich unversöhnliche Rechtsstandpunkte miteinander in Kollision geraten sind, die nichts Geringeres als so elementare Fragen betreffen, wessen Recht auf der Welt gelten soll, wer sich infolgedessen wem unterzuordnen hat, spielt bei dem politischen Imperativ, die beiden Lager hätten sich auszusöhnen
, einfach keine Rolle. Man soll sich zweitens für ein unverbrüchlich konsolidiertes europäisch-amerikanisches Beziehungswesen stark machen, obwohl es an den – guten
– Beziehungen, die bis gestern zwischen beiden Machtblöcken angeblich herrschten, absolut nichts mehr zu kitten
gibt: Genau deren Aufkündigung durch Amerika ist es ja, was sie aktuell so ‚schlecht‘ macht. Drittens soll man dieselbe Abstraktion vom Verursacher der beschädigten Beziehungen
auch beim Geschädigten auf der anderen Seite des Atlantiks zur Anwendung bringen und einfach davon absehen, dass Amerika eher nicht den Beziehungen
, sondern schon Europa selbst beträchtlichen Schaden zugefügt hat. Sich als die ‚eine Stimme‘ außenpolitisch vernehmbar zu machen, hat man in Europa zwar noch nie so recht hingekriegt. Jetzt aber ist die Union in ihrem Inneren ungefähr so schön ‚multipolar‘ verfasst, wie einige ihrer Führungsmächte es sich ausschließlich für die Welt außerhalb ihres eigenen Machtbereichs wünschen. Und ausgerechnet da, wo die transatlantischen Wortmeldungen Europas nur noch aus den Beiträgen bestehen, mit denen der Streit der europäischen Mächte über die ‚richtige‘ Generallinie des Verhältnisses zu Amerika – das ihrer eigenen Nationen wie das des EU-Gesamtvereins – vorankommt, soll man an den einen europäischen Willen zur politischen Klimaverbesserung glauben. Viertens soll man sich auch nicht durch die Prämisse in seiner unbedingten Parteinahme für die transatlantische Beziehungskiste irritieren lassen, unter der allein sich die versöhnungsbeflissenen Partner ein wieder repariertes Verhältnis zu ihrem Amerika vorstellen können: Logisch ist es ja nicht gerade, dass die Aufrüstung Europas zur militärischen Macht, die sich um eigene weltpolitische Rechte kümmert, die Freundschaft zu der Macht vertieft, die Weltpolitik gerade zu ihrem Monopol erklärt hat.
Aber das europäische Leiden am eingerichteten politischen Kräfteverhältnis hat eben seine eigene Logik, und die bringt der deutsche Kanzler mit dem ihm eigenen Höchstmaß an Präzision auf den Punkt. Transatlantische Einvernehmlichkeit und die Stärkung Europas – beides hängt
einfach, wie er immer wieder betont, unmittelbar zusammen mit
. Allenfalls von, nie und nimmer aber gegen Amerika möchte der deutsche Kanzler Europas Emanzipation jenseits des Atlantiks verstanden wissen, und deswegen steht alles, was es jetzt und demnächst in der Konkurrenz gegen die Weltmacht für ihn und sein Europa zu besorgen gibt, grundsätzlich immer auch im Dienst an der Pflege der guten Beziehungen mit dem Partner Amerika
.
III. Der neue Weltfrieden und das kapitalistische Weltgeschäft: Die Grundlagen der imperialistischen Konkurrenz werden zweifelhaft
1. Die Neubestimmung des Verhältnisses von politischer Beaufsichtigung und kapitalistischer Benutzung der Staatenwelt
Negative Wirkungen auf das Weltgeschäft, die der Krieg Amerikas hervorruft, wissen bürgerliche Wirtschaftsjournalisten reihenweise herzuerzählen. In der ihnen eigenen Bedingungslogik betrachten sie seine Kosten als zusätzliche Belastung des ohnehin schon defizitären amerikanischen Staatshaushalts, sorgen sich um dessen Stabilität, fragen sich, wie es demnächst wohl um die Zinsen bestellt sein wird und was dann für die Konjunktur zu befürchten sei, in Amerika, bei uns und in der Welt überhaupt. Sie registrieren bei manchen den Wegfall von Geschäftsgelegenheiten, infolge der Zerstörung und Besetzung des Irak, aber auch aufgrund der „politischen Spannungen“, die zwischen der führenden Welthandelsmacht und einigen ihrer wichtigen europäischen Konkurrenten bestehen. Und dann legen sie die Liste der bedenklichen bis negativen ökonomischen Kriegsfolgen beiseite und werden mit einem Mal sehr prinzipiell:
„In Fragen von Krieg und Frieden sind politische Prinzipien wichtiger als Geschäftsaufträge. (…) Wichtiger ist die Frage, wie es mit der Welthandelsordnung überhaupt weitergeht. Die Gefahr ist durchaus real, dass das neugewonnene politisch-militärische Selbstbewusstsein der Vereinigten Staaten auch ihre Außenhandelspolitik prägt. Bisher (…) gelang es, die Macht des Stärkeren in einen globalen Ordnungsrahmen einzubinden – im Interesse und zum Wohle aller Staaten, der Reichen wie der Armen. Um diese Errungenschaft gilt es zu kämpfen.“ (SZ, 3./4.03).
Auch wenn der Mann in seiner Parteilichkeit für das kapitalistische Weltgeschäft und dessen möglichst ungestörten Fortgang über dieses selbst weder viel weiß noch zu wissen braucht: Dass Amerikas Krieg neben dem Weltfrieden auch dessen ökonomische Grundlagen unsicher macht, haben er und seine Kollegen jedenfalls mitbekommen.
Dabei ist es gar nicht so, dass die Weltmacht alle Modalitäten, Sitten und Gebräuche aufgekündigt hätte, nach denen zwischen den Nationen der Welt Handel betrieben und abgerechnet wird. Nach wie vor überfallen sich die Staaten nicht, sondern eignen sich den Reichtum der anderen in Tauschgeschäften an. Sie achten dabei auch auf die Regeln, die sie für ihre vielfältigen Transaktionen mit Waren und Geldern vereinbart haben, und klären ihre handelsrechtlichen und –diplomatischen Gegensätze in den eigens dazu eingerichteten Streit- und Schiedsgerichtsforen ab. Aber mitten in diese Welt der geschäftlichen Konkurrenz hinein haben die USA am Fall Irak ein Prinzip der Reichtumsbeschaffung vollstreckt, das die etablierten Regeln des Konkurrierens schlicht außer Kraft setzt: Sie eignen sich das Verfügungsrecht über die Bodenschätze des Landes gewaltsam an, verwehren Konkurrenten den freien ökonomischen Zugriff auf irakisches Öl, teilen statt dessen anderen Geschäftsgelegenheiten in Bezug auf dieses strategische Gut wie auf Leistungen für den ‚Wiederaufbau‘ des Landes zu, belohnen Nationen mit der Eröffnung geschäftlicher Zugriffsrechte für die politische Gefolgschaft, die diese ihnen gegenüber erwiesen haben, und bestrafen andere dafür, die sich dazu nicht herablassen wollten. Sicher: Für das Nicht-Stattfinden lohnender kapitalistischer Geschäfte aufgrund ihrer übergeordneten sicherheitsstrategischen und sonstigen politischen Erwägungen hat die größte Welthandelsmacht, der die kapitalistisch wirtschaftende Menschheit eine so feine Sache wie ein ‚allgemeines Diskriminierungsverbot‘ zu verdanken hat, früher auch schon und nicht zu knapp gesorgt: Die Wirtschaftsbeziehungen mit den verflossenen Staatshandelsländern z. B. unterstanden grundsätzlich ihrer hoheitlichen Aufsicht, wurden an Hand von Embargolisten peinlich genau kontrolliert, und dass ein Tauschgeschäft ‚russisches Erdgas gegen deutsche Röhren‘ durchaus auch im Rahmen eines ökonomischen Zersetzungswerks des östlichen Gegners liegen kann, war ihr erst einmal nicht zu vermitteln. Doch fand die politisch verfügte Suspendierung des Zugriffs auf auswärtigen Reichtum in diesem wie in anderen Fällen auf einer auch von den durch sie Betroffenen getragenen Geschäftsgrundlage ihres Wirtschaftens statt, nämlich im Rahmen einer weltpolitischen Ordnungsstiftung, bei der alle Konkurrenten mit den USA gegen die Sowjetunion grundsätzlich gemeinsame Sache machten. In gewisser Weise untergeordnet waren sie bei der Schaffung eines politischen Aufsichtsregimes über eine kapitalistisch verfügbare Welt der Führungsmacht des ‚freien Westens‘ und ihrer NATO zwar schon auch – aber eben als funktionelle, gleichsam arbeitsteilig verfasste Mit-Wirker an und insoweit auch Mit-Stifter von einer gewaltsamen Aufsicht über die Welt, die noch in einem zweiten Sinn auch ihre Weltordnung war. Für ihre hierarchisch abgestuften Dienste bei der großen Aufgabe, die freie kapitalistische Welt zu schaffen und politisch zu kontrollieren, auf die Amerika seinen freien Zugriff haben wollte, wurden sie allesamt belohnt – mit einer Lizenz für deren ökonomische Benutzung, die ihnen von ihrem mächtigen Partner und Verbündeten gewährt wurde. Ihr kollektives Mitmachen und Zusammenhalten in einem gewaltbewehrten ‚Westen‘, in dem sie sich für die erfolgreiche Abschreckung der antikapitalistischen Herrschaftsräson sogar den Risiken eines formidablen Atomkriegs aussetzten, wurde ihnen mit der Konzession zur gleichberechtigten Teilnahme und Teilhabe am kapitalistisch geregelten Weltgeschäft entgolten. Sie durften auf den Reichtum aller fremder Herren Länder wie auf die kapitalistisch verwertbaren Reichtumsquellen der ganzen in gemeinsamer Anstrengung gegen den „Osten“ gesicherten und vereinnahmten Welt Zugriff nehmen und sie so, in Konkurrenz mit- und gegeneinander, als Ressource ihrer Macht verwenden.
Dieses einzigartige, gleich doppelt auf die überlegenen Potenzen der USA zurückgehende Arrangement von Gewalt und Geschäft formierte den Imperialismus für 50 Jahre zu einem kapitalistischen Westen. Unter amerikanischer Führung eingebunden in einen supranationalen Zweckverband zur gewaltsamen politischen Kontrolle der Welt wurden die Partner der Weltmacht von der auch ökonomisch ermächtigt und in ihrem nationalen Materialismus freigesetzt. Im Kollektiv mit ihrer Führungsmacht vergemeinschafteten sie ihre Gewaltmittel und nahmen die politische Beaufsichtigung der Welt wahr – und sicherten sich diese darüber als ihre kollektive Geschäftssphäre. Freilich: Wie bei der Kontrolle des globalen Gewalthaushalts, so waren sie auch da fest in einem Ordnungsrahmen integriert, den Amerika ihnen für die Abwicklung eines inter-nationalen kapitalistischen Geschäftsverkehrs zur Verfügung stellte. Die Einhaltung der Spielregeln für den „friedlichen Wettbewerb“ vorausgesetzt, stand der aber schon allen gleichermaßen zur Teilnahme offen und ihnen damit der Reichtum der Welt frei zur Verfügung, und im selben Maße, in dem sie von ihrer Freiheit erfolgreich Gebrauch machten und selbst mächtig und reich wurden, konnten diese zur imperialistischen Konkurrenz ermächtigten Staaten eines getrost vergessen: Dass sie sowohl politisch, in der gemeinschaftlich-gewaltsamen Kontrolle der Staatenwelt und deren Organisierung gegen den sowjetischen Hauptfeind, wie auch ökonomisch, als konkurrierende Subjekte eines von Amerika eingerichteten wie maßgeblich bewirtschafteten Weltmarkts, nur das ins Werk setzten, was Amerika von ihnen ins Werk gesetzt haben wollte. In souveräner Eigenmacht und im Vollzug ihrer eigenen national-ökonomischen Berechnungen setzten sie Amerikas Interesse, die Welt als eine einzige kapitalistische Geschäftssphäre vorzufinden und den Rest, der sich dem Zugriff nachhaltig verschloss, zur „Öffnung“ gewaltsam zu zwingen, mit in die Tat um. Auf dieser Grundlage machten die Konkurrenten der Weltmacht imperialistisch Karriere – und jetzt werden sie „im Fall Irak“ nachdrücklich an die entscheidende Bedingung dieser Karriere zurückerinnert, daran nämlich, dass diese ihnen von Amerika gewährt wurde: Indem die USA die Sicherheit der Welt auf neue Art, nämlich durch ‚Terrorismus‘ und ‚WMD‘ für gefährdet erklären, einen permanenten Feldzug dagegen als obersten strategischen Imperativ in die Weltpolitik einführen und sich die alleinige Kompetenz zur Festlegung des jeweils zu bekämpfenden Feindes vorbehalten, kündigen sie den Grundsatz eines mit ihren Konkurrenten stets gemeinschaftlich zu kontrollierenden Welt-Gewalthaushalts auf. Wenn diese sich nicht Amerikas neuem Regime ebenso bedingungslos unterordnen wie der früheren gemeinsamen antisowjetischen Sache, dann erledigt die Weltmacht ihre Angelegenheiten im Alleingang ohne oder auch gegen sie. Und der Aufkündigung des politischen Kollektivismus bei der Weltaufsicht folgt die Kündigung des bislang geltenden Prinzips ihres ökonomischen Unterbaus gleich hinterher: Wer sich Amerika nicht unterordnet, für den ist auch die kapitalistische Verfügbarkeit der Staatenwelt keine Selbstverständlichkeit mehr; als Nation über die Kapitalmacht zum Konkurrieren auf dem Weltmarkt zu verfügen, bedeutet ab sofort keineswegs mehr, dass einem damit auch das Konkurrieren um den kapitalistischen Reichtum anderswo zur Mehrung des eigenen offen steht, vielmehr will das Teilhaberrecht am Weltmarkt durch die Ein- und Unterordnung in von Washington auf die Tagesordnung der Weltpolitik gesetzten Ordnungsangelegenheiten erworben sein.
Beide Kündigungen haben die USA am Fall Irak praktisch vollzogen. Insofern aber der Irak für sie selbst nur ein Fall des Prinzips ist, nach dem sie – erklärtermaßen – auch in Zukunft ihre Rolle der einen die Welt beherrschenden Macht wahrzunehmen vorhaben, ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Irak auch in Bezug auf die Regeln der Weltwirtschaft als Fall für ein neues Prinzip steht. Und in dessen Lichte besehen erhalten die wirtschaftlichen Folgeschäden des Krieges
ein noch ganz anderes Gewicht.
2. „Sorgen“ und „Befürchtungen“ in Sachen „Zukunft der Weltwirtschaft“ – und der materielle Grund, der zu ihnen Anlass gibt
Viel Freude bereitet das kapitalistische Weltgeschäft seinen aktiven Betreibern wie ideologischen Parteigängern gegenwärtig ohnehin nicht, aus rein ökonomischen Gründen. Krisenbedingt wird weltweit Reichtum vernichtet und nicht vermehrt; einige, nicht gerade unwichtige Staaten sind bankrott, andere haben ihren Offenbarungseid vielleicht demnächst vor sich; die nationalen Zentren des globalen Geschäfts imponieren mit den Wachstumsraten ihrer Schulden, das alles hat gerade erst so richtig angefangen – und jetzt steht dem internationalen Geschäftswesen noch eine politisch ins Werk gesetzte Verlustrechnung größeren Umfangs ins Haus. Denn wenn die Weltmacht im Zuge ihrer gewaltsamen Sortierungs- und Aufräumarbeiten auf dem Globus auch gleich die Zugriffsrechte für den auf ihm verstreuten kapitalistischen Reichtum und dessen Quellen mit verteilt, diese ihren ‚Freunden‘ gewährt, anderen aber verwehrt, dann wird erstens allein schon darüber das kapitalistische Geschäft reduziert. Denn dann sind einige Konkurrenten der Weltmacht, die sich in deren Krieg gegen den Irak ins verkehrte Lager gestellt haben, trotz ihrer verbrieften Verträge mit diesem Land nicht nur aus den Ölgeschäften ausgegrenzt, die dort demnächst wieder zu machen sind: Dann haben sie mit ihren Rechten und Interessen auch im Rest dieser Öl-Region
am Golf im selben Maße weniger zu bestellen, in dem Amerika mit der politischen Inbesitznahme dieser Region nach Maßgabe der eigenen, höherwertig-strategischen wie ganz banal ökonomischen Benutzungsinteressen voranschreitet. Davon, dass Insubordination gegenüber den von den USA angemeldeten Gefolgschaftsansprüchen aus Prinzip ein ökonomisches Verlustgeschäft nach sich zieht, zeugen zweitens Bekanntgaben seitens der im Mutterland aller kapitalistischen Freiheit engagierten Geschäftswelt. Dass ein Regierungsgebäude in Amerika nicht mehr mit derselben Farbe gestrichen werden darf, in der es so schön weiß glänzt, weil auf den Töpfen ‚made in Germany‘ steht, mutet zwar an wie ein gehässiger Scherz. Dessen tiefere politische Bedeutung aber trifft auch deutsche Auto- und Maschinenbauer, Pharmakonzerne, Banker wie Börsengänger: Sie alle haben entweder jetzt schon Einbußen in ihrem Amerika-Geschäft zu verzeichnen oder demnächst mit ihnen zu rechnen und rechnen auch mit ihnen, sei es auch nur in der Form, dass sie Ertragsrückgänge für ihren und den speziellen Fall ihres hochwertigen Gebrauchsartikels – Porsche! – demonstrativ ausschließen. Drittens ist gar nicht abzusehen, wem aufgrund seiner Amerika zuwenig gewogenen politischen Gesinnung darüber hinaus noch welche Geschäftsschädigungen ins Haus stehen. Welche Bestrafung
man im Falle Frankreichs in Washington für angebracht hält; welche schon eingerichteten und gut funktionierenden, fest geplanten oder erst projektierten Handels- und Lieferbeziehungen mit Drittstaaten von Amerika aus torpediert werden, entweder weil die Staaten dem Verdikt verfallen, problematisch
zu sein, oder weil die Handelsartikel sich der Aufwertung zu strategischen Gütern
erfreuen, auf die sich dann Amerikas Aufmerksamkeit so exklusiv wie beim Öl richtet: Das alles weiß man in der kapitalistischen Geschäftswelt nicht, so dass schon auch manches fein kalkulierte ‚ökonomische Risiko‘ allein deswegen nicht gewagt wird, weil die Politik der Weltmacht ein einfach nicht mehr zu kalkulierendes Geschäftsrisiko darstellt.
Und dann gehen von deren Politik nicht nur manche externen Unsicherheiten für die kapitalistische Profitkalkulation im engeren Sinn aus: Über diese hinaus sorgt Amerika auch für eine Verunsicherung des kapitalistischen Weltgeschäfts überhaupt. Der eingangs zitierte Schönredner der Weltwirtschaft und ihrer institutionalisierten Regeln und Gebräuche deutet das in seiner Befürchtung an, die führende Weltwirtschaftsmacht möchte womöglich mit ihrem kriegerisch geschärften Selbstbewusstsein
auch noch die weltweiten Außenhandelsbeziehungen prägen
. Sein Kollege aus demselben Blatt bringt unter der Überschrift Weltmarkt in Gefahr
Folgendes zu Papier.
„Der Krieg im Irak bedeutet auch eine Abkehr vom Multilateralismus, also von der Einbindung der Supermacht in internationale Regeln und Institutionen. In der Kriegsfrage ist die entsprechende Institution der Weltsicherheitsrat, in Wirtschaftsfragen ist dies die Welthandelsorganisation WTO. Wird sich die US-Regierung auch künftig Schiedssprüchen der WTO beugen, wenn sie für das eigene Land unbequem sind? Und was machen die anderen, wenn nicht?“ (SZ, 2.4.03)
Sicher: Mit einer ‚Einbindung‘ Amerikas wird es wohl nicht so weit her sein, wenn die ‚internationalen Regeln und Institutionen‘ in ihrem ganzen Bestand davon abhängen, dass die ‚Supermacht‘ an und in ihnen weiter so mitwirkt wie bisher. Doch stellt der Mann ausnahmsweise einmal keine allzu dummen Fragen, zumindest passen sie zur Überschrift seines Artikels. Denn was er an der zukünftigen Geltungsfrage von WTO-Schiedssprüchen problematisiert, betrifft der politischen Substanz nach keineswegs nur die Funktionstüchtigkeit des rechtsförmigen wirtschaftsdiplomatischen Überbaus, den die Subjekte der imperialistischen Konkurrenz sich zur Dauerbetreuung ihrer unweigerlichen Streitfälle und notorischen Streitgegenstände geschaffen haben. Zusammen mit allen anderen supra-nationalen Organisationen, die dafür jeweils ihre speziellen Dienste tun, steht die WTO auf ihre Weise nur für das oben angesprochene kollektivistische Prinzip, dem nach dem Willen seiner maßgeblichen Betreiber auch der kapitalistische Welthandel gehorchen soll: Weil die bedeutenden Konkurrenten auf dem Weltmarkt wissen und dementsprechend davon ausgehen, dass die exklusive Aneignung des Reichtums, um den es ihnen geht, die Grundlagen ihrer eigenen Konkurrenz dadurch untergräbt, dass der Reichtum, den sie sich mit erfolgreichen Handelsgeschäften, weltweiten Firmengründungen und Geldinvestitionen an Land ziehen, ohne den Abfluss von Reichtum aus anderen Nationen bis hin zum Verlust ihrer Zahlungsfähigkeit gar nicht zu haben ist, kümmern sie sich nicht nur um ihren Geschäftserfolg heute, sondern versuchen dem auch Sicherheit in Zukunft zu verleihen. Mit Regelwerken für den zwischenstaatlichen Handel, regelmäßigen Konsultationen und Vereinbarungen über die Stabilitätspflege ihres Geldwesens, Modalitäten der Kreditversorgung auch von Verlierern in der Konkurrenz und dem ganzen Rest des institutionalisierten Vereinbarungswesens, das sich in all dem zusammenfasst, was man gemeinhin ‚Welthandelsordnung‘ nennt, tragen die maßgeblichen Subjekte des Weltgeschäfts – rückblickend: Amerika wie immer voran – dem Umstand Rechnung, dass sie gemeinsam für den Erhalt des Globus als Geschäftsfeld ihrer Bereicherung zu sorgen haben. Oder, dasselbe nur andersherum ausgedrückt: Den Weltmarkt, den sie auf Dauer be- und für sich ausnutzen können und als die allererste sichere Garantie ihrer zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten vorfinden wollen, gibt es für die auf ihm konkurrierenden Weltwirtschaftsmächte nur, wenn sie sich ihn als ihr gemeinsames ökonomisches Mittel auch – über alle ihre sonstigen Gegensätze hinweg – gemeinsam politisch erhalten. Und genau dieser, durch den Widerspruch einer die eigenen Grundlagen zerstörenden Konkurrenz kapitalistischer Nationen erzwungene, Wille zur Gemeinsamkeit steht mit dem Gebaren der führenden Weltwirtschaftsmacht nunmehr in Frage. Förmlich aufgekündigt hat sie, wie gesagt, den Welthandel zwar nicht. Aber eine Übertragung des Standpunkts, den die USA in der Frage der ökonomischen Benutzung des Irak und der Golf-Region an den Tag legen, auf das bestehende politisch-ökonomische Regelungswerk, das den ‚globalen Ordnungsrahmen der Weltwirtschaft‘ ausmacht, lässt von dem nicht mehr viel übrig. Denn dann schlägt der politische Gegensatz, den Amerika bei der Stiftung seines Weltfriedens maßgeblichen Mächten gegenüber eröffnet, auf die politischen Streitfragen durch, die im Rahmen der institutionalisierten Betreuung des Weltmarkts in der WTO, im IWF und sonst wo in einer letztlich doch immer auf Konsensfindung zielenden Manier abgewickelt werden – und dann dominiert auch in diesen Gremien plötzlich nur noch der dem gemeinsamen Betreuungsinteresse höchst abträgliche Gesichtspunkt ‚Pro oder Contra Amerika‘. Womöglich sehen die USA im Zuge der Beförderung ihres aktuellen Friedenswerks einfach nicht mehr ein, weswegen Nationen, die bei ihrer Weltaufsicht nicht mitmachen wollen, bei der Regelung von Benutzungsfragen des Globus weiterhin quasi gleichberechtigt zu Rate gezogen werden sollen – nur damit dieses geregelte Weltgeschäft in Gang bleibt, von dem sie profitieren, die anderen aber auch. Und möglicherweise sorgt die Weltmacht mit der Aufkündigung aller Einvernehmlichkeiten bei der Pflege des internationalen Handels nicht nur im Irak, sondern überhaupt für ein ganz neues Verteilungsverfahren beim Weltgeschäft, so nämlich, dass sie über die Möglichkeiten, am Welthandel zu verdienen, politisch verfügt, sich und denen, die an ihrer Seite stehen, Geschäftsmöglichkeiten zuteilt und andere von ihnen ausschließt.
Vorläufig verläuft der Wirtschaftskrieg zwischen den Machtblöcken zwar noch unter dem Dach seiner supra-nationalen Ordnungs- und Regelungsorgane. Doch schon die bloße Möglichkeit, daran könnte sich demnächst einiges entscheidend ändern, tut ihr Werk. Allein die ist schon Gift für die nach Stabilität suchende Weltwirtschaft. (…) Welcher Manager eines international tätigen Konzerns kann in einer global vernetzten Welt langfristige Investitionsentscheidungen treffen, wenn der Weltpolizist unberechenbar ist? Wie sollen Freihandel und Kapitalverkehr gedeihen, wenn die halbe Welt der größten Volkswirtschaft misstrauisch gegenübersteht? (…) Wenn die Hardliner im Weißen Haus es ernst meinen – und daran kann niemand mehr zweifeln, stehen wir vor einer Periode anhaltender Unsicherheit.
(Handelsblatt, 21.3.03) Andere nehmen dann in ihrer prinzipiellen Verunsicherung zum Prinzip Hoffnung Zuflucht und bemühen dazu die ihnen liebgewordene Vorstellung einer ins Welthandelsgeschäft und seine diversen politischen Betreuungsorgane fest ‚eingebundenen‘ Supermacht. Die Amerikaner werden so nicht weitermachen. Aus eigenem Interesse werden sie den Freihandel nicht antasten
(SZ, 22.3.03), meint der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und setzt damit wohl auf die Abhängigkeit, in die sich die führende Welthandelsmacht vom Gang der Geschäfte und vom Erfolg auch ihrer Konkurrenten begeben hat, also darauf, dass die USA sich die Aufkündigung des eingerichteten Welthandels, von dem auch sie leben, gar nicht leisten können.
Was aber ist, wenn sich die größte kapitalistische Volkswirtschaft genau an der Abhängigkeit stört, in der sie sich ihrem eigenen Werk gegenüber befindet? Und wenn deren politische Betreuer sich gar nicht über den Freihandel, sondern über dessen politische Konstruktion hermachen? Wenn sie die Errungenschaften eines globalisierten Kapitalismus vorausblickend so interpretieren, dass die doch auch schon allein durch die prinzipielle Botmäßigkeit ihrer Konkurrenten zustande gekommen sind und deswegen sie von der Ausgrenzung widerspenstiger Rivalen nur profitieren können? Und wenn am Ende schon die Entwertung der G-8-Treffen und des dort demonstrierten, für die Vertrauensbildung und Konsensfindung anderswo unerlässlichen Einvernehmens über den Fortgang der weltwirtschaftlichen Konkurrenz der Nationen ausreicht, um den Freihandel
ganz grundsätzlich anzutasten
– weil es den eben nur als Produkt dauernder politischer Anstrengungen zur Aufrechterhaltung eines wirksamen politischen Regimes über den internationalen Geschäftsverkehr gibt?
Dass die USA dabei zusammen mit den Geschäften, die sie bei anderen zum Risiko machen, selbst einiges riskieren, steht allerdings auch fest.
3. Wenn Amerika der ganzen Welt misstraut: Womit verdient es dann noch Vertrauen?
Die Weltmacht ist bekanntlich nicht nur in Hinblick auf ihre Gewaltmittel ‚super‘. Die mit Abstand wuchtigste kapitalistische Wirtschaftsmacht ist sie außerdem. Dies nicht allein wegen ihres riesigen ‚Binnenmarktes‘, sondern schon auch dadurch, dass sie zusammen mit diesem und von ihm aus den ganzen Rest der Welt kapitalistisch bewirtschaftet. Ihre Geschäftsleute sind in so gut wie jedem Erdenwinkel engagiert und machen sich um die Mehrung amerikanischen Reichtums verdient; amerikanische Finanziers nehmen den Kredit der ganzen Staatenwelt für ihre Dollar-Geschäfte in Anspruch und sogar ganze Staaten als ‚Märkte‘ – ‚emerging markets‘, die dann auch wieder untergehen – in ihre eigenen Hände. Die Erfolge bei der Benutzung der Welt als US-amerikanische Reichtumsquelle sind es, die der Nation die Mittel zur Durchführung ihres ambitionierten Weltaufsichts- und Weltbeherrschungsprogramms verschaffen; dies vor allem dadurch, dass sie ihrem Geld eine Sonderstellung verleihen: Auch in Zeiten eines Pluralismus von Weltgeldern ist ihr Dollar das Geld der Welt, die Materiatur des abstrakten Reichtums, den sich konkurrierende Nationen als ihre Geldreserve halten und an der sich die Güte ihrer eigenen Gelder zu messen hat. Zwar gilt auch für das Geld der Weltmacht dasselbe wie für jeden Nationalkredit: Als Kreditzeichen, als qua staatlich-gewaltsamer Verfügung geltender abstrakter Reichtum will es allemal von den Produzenten des wirklichen kapitalistischen Reichtums durch erfolgreiche Verwendung materiell beglaubigt werden; im Idealfall im selben Maß, in dem der Staat die tatsächliche Reichtumsvermehrung mit seinen Gelddruckmaschinen vorwegnimmt. Doch auch was diese Rechtfertigung ihrer Schulden durch damit wirklich produzierten Reichtum betrifft, genießen die USA eine weltweit respektierte Ausnahmerolle. Das einzigartige Kombinat aus weltgrößter Wirtschaftsmacht und überlegener Gewalt, die genau die Prinzipien garantiert und verbürgt, nach denen alle anderen Nationen in Konkurrenz gegeneinander den Kredit kapitalistisch bewirtschaften, von dem sie leben, sichert dieser Nation und ihrem Geld ziemlich grenzenloses Vertrauen. In den USA zu investieren, amerikanische Schuldtitel zu erwerben oder anders ‚in den Dollar zu gehen‘, mag sich in dem einen Fall mehr, in dem anderen weniger lohnen als vergleichsweise anderswo. Immer aber ist das geschäftliche Engagement in diesem Land zumindest insoweit eine sichere Sache, als es durch die gewaltsame wie ökonomische Garantiemacht des internationalen kapitalistischen Geschäftswesens mit garantiert ist. Dass die politisch die letzte Instanz aller kapitalistischen Sicherheit ist, die auf dem Globus zu haben ist: das ist die reale Grundlage für die Weisheit der Börsen, wonach auf zukünftige Geschäftserfolge immer dann besonders gut zu spekulieren ist, wenn die Weltmacht Kugeln fliegen
lässt. Und ökonomisch, am Geld der Weltmacht ausgedrückt, hat diese Sicherheit den Inhalt, dass ihr Dollar den freien kapitalistischen Zugriff auf den Reichtum weltweit verbürgt.
Die ansehnlichen Haushaltsdefizite der USA und der Umstand, dass die politisch und ökonomisch weltgrößte Macht auch der weltgrößte Schuldnerstaat ist, bezeugen eindrucksvoll, wie sehr die internationale Geschäftswelt diese Sonderstellung der Weltmacht und ihres Kredits anerkennt. Der Umstand jedenfalls, dass im Falle Amerikas die ökonomischen Potenzen des Landes den Unterhalt des Gewaltapparates schon seit längerem nicht mehr hergeben, hat die globalisierte Geldbesitzer- und Spekulantenwelt in dem Vertrauen darauf noch nie erschüttert, dass sich an und mit dem Geld dieser Nation prinzipiell gut verdienen lässt. Sicher: In dem einen Fall rentieren sich amerikanische Schuldtitel mehr, in dem anderen weniger, zumal für den Vergleich gewinnbringender Anlagemöglichkeiten neben anderen Geldern zum Spekulieren auch noch gigantische derivative Überbauten über den Kredit der Nationen zur Verfügung stehen. Und da lohnt es sich bisweilen schon einmal, gegen den Dollar
zu spekulieren – freilich nur, um auf Basis des ungebrochenen Vertrauens in seine Funktion als global und uneingeschränkt verwendbares Geschäftsmittel an ihm, an seinem vorübergehenden Wertverfall in diesem Fall, verdienen zu können. So haben die Geldbesitzer und Spekulanten in aller Welt bislang noch immer der Gleichung vertraut, dass die konkurrenzlose Gewalt, die den Kredit der USA garantiert, auch dessen konkurrenzlose Tauglichkeit als internationales Geschäftsmittel mitverbürgt; und sie haben diese Gleichung dadurch selber wahrgemacht, dass sie das Geld der Weltmacht ausgiebig für ihre Geschäfte gebrauchen.
Diese praktische Anerkennung seines Kredits hat sich der politische Hüter des Dollars schon immer ausgiebig zunutze gemacht – unvergessen die Kombination von „Reaganomics“ und „Star-Wars“-Rüstung in den 80ern des vorigen Jahrhunderts, als die kapitalistische Internationale es mit einem gigantischen „Doppel-Defizit“ im Staatshaushalt und in der Außenbilanz der USA zu tun bekam und darauf mit einer beträchtlichen Herunter-Wertung des Dollar reagierte. Das prinzipielle Vertrauen in die US-Währung als maßgebliches Weltgeld und in die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit der Regierung, die so extrem großzügig darüber verfügte, stand nie in Frage; aus guten Gründen: In jener größeren Welthälfte, deren kapitalistische Ordnung mit einem Schulden-finanzierten Rüstungsvorsprung vor dem sowjetischen Feind – am Ende total erfolgreich – „vorwärtsverteidigt“ wurde, blieb die freie Verwendung amerikanischer Kreditzettel durch alle, die genügend davon hatten, für Geschäfte aller Art, auch solche auf Kosten Amerikas, stets gewährleistet; praktisch durch den alltäglichen Geschäftsgang selber. Und für diese praktische Gewähr leistete eine intakte oberste Ebene der gewaltsamen Beaufsichtigung des Weltgeschehens, die „G 7“, mit ihrem Willen zu letztendlicher Einigung über alle Interessengegensätze hinweg auf eine ‚gemeinsame Sache‘, zu der auch der Schutz des Währungsvergleichs vor spekulativen Entgleisungen gehörte, eine allerhöchste politische Garantie.
Das ist jetzt anders.[12] Nach wie vor geht die US-Regierung für die Finanzierung ihres Haushaltsdefizits und speziell für ihren Kreditbedarf zur Bezahlung des Irak-Kriegs samt allen Folgekosten mit allergrößter Selbstverständlichkeit davon aus, dass ihre weltweiten Gläubiger ihr weiterhin mit Vertrauen und Geldkapital zur Seite stehen; insoweit ist alles normal und wie gehabt. Was sie da an Finanzmitteln aus aller Welt an sich zieht, dient allerdings der Durchführung einer Weltpolitik, die die im weltweiten Geschäftsleben praktisch vollzogene Anerkennung amerikanischer Schulden als Inbegriff kapitalistischen Reichtums untergräbt. Nämlich so:
Amerika sieht nicht mehr ein, weshalb die strategische Weltordnung, für die es sich einen richtigen Krieg am Golf leistet, auch für die Nationen, die diesen Krieg nicht unterstützen, sondern sogar zu verhindern suchen, die angestrebte Ordnung auf dem Globus also ablehnen, trotzdem ein Recht auf Mitsprache über Krieg und Frieden und noch dazu eines auf uneingeschränkte Teilnahme am weltweiten Konkurrenzgeschäft vorsehen soll, wo das doch nur im Rahmen dieses so aufwendig herzustellenden neuen Sicherheits-Arrangements seinen Gang gehen kann und auch nurmehr in diesem Rahmen vorangehen soll. Mitsprache in strategischen Fragen ebenso wie Beteiligung an der Konkurrenz um kapitalistische Reichtumsquellen in aller Welt: beides behandelt die US-Regierung als Lizenz, die sie zu vergeben hat, also auch vorenthalten kann. Und das hat weit reichende Folgen. Wer tatsächlich wozu zugelassen, wer wie sehr wovon ausgeschlossen wird, das braucht gar nicht erst im Einzelnen festgelegt zu werden – abschließend lässt sich das ohnehin nicht klären; und schon damit, dass das unklar bleibt, tritt eine bemerkenswerte Modifikation in den Grundlagen des Weltkreditgeschäfts ein. Zwar sollen „bloß“ unwillige Konkurrenten geschädigt werden. Doch ganz nebenbei wird das Mittel der internationalen Konkurrenz von Kapitalisten und Staaten, der Gebrauch des Welt-Kreditgelds, einer Beschränkung unterworfen, die einer qualitativen Entwertung dieses Mittels gleichkommt: Mit dem Dollar, mit dem Amerika die Welt überschwemmt, ist nicht mehr die praktische Garantie verbunden, ihn bedingungslos, uneingeschränkt und universell als Mittel für Konkurrenzgeschäfte aller Art, durchaus auch schon mal zum relativen Nachteil der USA selber, verwenden zu können. Die US-Regierung stellt sich nicht nur – wie schon so oft – souverän gleichgültig, also äußerst anspruchsvoll zu der Frage der weltweiten geschäftlichen Verwendung ihrer Schulden, von der immerhin deren Qualität als kapitalistisches Geschäfts- und staatliches Zugriffsmittel abhängt. Indem sie den Standpunkt einnimmt, andere Nationen hätten sich den Zugang zum internationalen Konkurrenzbetrieb – hier und da und im Prinzip überhaupt – erst politisch zu verdienen, stellt sie sich direkt negativ gegen eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass das weltweite Geschäftsleben ihren Kredit anerkennt und ihre Schuldenzettel als Weltgeld beglaubigt: Sie relativiert deren Brauchbarkeit als letztgültiges Geschäfts- und Zugriffsmittel wo auch immer auf der Welt und für wen auch immer und damit die Garantie, die ihrem politischen Kredit immer die ökonomische Stichhaltigkeit und ihrem Dollar seinen konkurrenzlosen Weltranglistenplatz gesichert hat.
Diesem Fortschritt entspricht auf der anderen Seite eine gewisse Umstellung der übrigen Subjekte der Weltwirtschaft, Unternehmen wie Staaten; eine Umstellung, die die sich nicht bestellt haben, der sie aber auch nicht ausweichen. Für die versteht es sich überhaupt nicht mehr von selbst, dass sie den US-Dollar als denkbar vertrauenswürdiges Instrument ihrer Konkurrenz um Mehrung und Aneignung des weltweit akkumulierenden kapitalistischen Reichtums verwenden und entsprechend würdigen. Amerikas kapitalistische Rivalen können nicht mehr unbesehen davon ausgehen, und sie gehen auch nicht mehr selbstverständlich davon aus, dass der politische Kredit der USA letztendlich auch ökonomisch insofern in Ordnung geht, als seine geschäftliche Verwendung politisch überall durchgesetzt und zugelassen ist. Sie verlassen sich nicht mehr darauf, dass Dollarbesitz mit einer Lizenz zu kapitalistischer Bereicherung, wo und wie auch immer, und mit einer oberhoheitlichen politischen Gewährleistung der kapitalistischen Konkurrenz, ihrer Resultate und ihres Fortgangs unmittelbar zusammenfällt. Bisher war Verlass darauf, dass jeder diesbezügliche Zweifel durch einen prinzipiellen Konsens der sieben alles entscheidenden Weltwirtschaftsmächte, und sei es durch die Theatralik eines „G 7“-Treffens, erfolgreich entkräftet wurde. Jetzt ist umgekehrt der unausgeräumte politische Dissens in der Frage, wie eine ‚gemeinsame Sache‘ der großen Imperialisten zu definieren wäre und ob es eine solche überhaupt noch gibt, die negative Garantie dafür, dass die ökonomische Stichhaltigkeit der amerikanischen Staatsschulden nicht mehr über jeden Zweifel erhaben ist. Beide Seiten: die Weltmacht als aktiver Teil, ihre Rivalen als Betroffene, kündigen gewissermaßen – nicht die Anerkennung, wohl aber – die fraglose Anerkennung des Dollar als letztinstanzliches, universelles und unbedingt glaubwürdig garantiertes Konkurrenz- und Bereicherungsmittel. Damit entziehen sie der Gleichung zwischen politischen Schulden der Weltmacht und ökonomischer Rechtfertigung jeder derartigen Schuldensumme die Grundlage – genau der Gleichung, die die US-Regierung gleichzeitig für die Finanzierung ihres Irak-Kriegs so hemmungslos strapaziert.
Das alles exekutieren die freischaffenden Agenten des globalen Freihandels mit Geld und Kredit auf ihre Weise. Dass das kapitalistische Weltgeschäft, wie es geht und steht, all das, wofür es von Amerika in Anspruch genommen wird, nur auf dem Wege der horrendesten Verschuldung hergibt, tat der Risikofreudigkeit der internationalen Kapital- und Geldbesitzer bislang keinen Abbruch. Seit neuestem aber haben und sehen sie in Amerikas neuem politischen Primat beim Rendite-Vergleich, nämlich in dem, wozu und wohin die amerikanische Politik sich aufmacht, einen harten Grund, die Voraussetzung der Rechnungen kritisch in Augenschein zu nehmen, die ihnen bislang ein ‚Engagement‘ in und mit Amerikas Geld als letztlich doch nie grundverkehrt erschienen ließen. Sie wälzen die Frage, ob und was überhaupt ein von Amerika politisch nach Freund-Feind-Kriterien kontrolliertes, restringiertes und perspektivisch parzelliertes Weltgeschäft hergibt; ob, wo und wie gut die Dollars, über die sie reichlich verfügen, überhaupt als Mittel ihres Geschäfts taugen; und diese Unsicherheiten addieren sich bei ihnen dann zu einem einzigen Argument für gebotenes Misstrauen in die Güte des Geldes der Weltmacht zusammen. Gleichzeitig sind sie damit konfrontiert, das die Bush-Administration so massiv und bedenkenlos wie lange nicht mehr den Staatskredit aufbläht, ohne jedes akzeptable Verhältnis zu dem Maß, in dem sie als verantwortungs-, nämlich zugleich rendite- und sicherheitsbewusste Spekulanten Bedarf an und gedeihliche Verwendung für die explosionsartig zunehmende Masse regierungsamtlicher Vorgriffe auf dereinst zu verdienenden kapitalistischen Reichtum der Nationen – und zwar sämtlicher Nationen der kapitalistisch geeinten Welt – haben. Noch nie gab es so viel US-Kredit im Angebot, und noch nie so tiefe Zweifel an dessen Stichhaltigkeit. Das stürzt Geldhändler wie -anleger in aller Welt in echte Verlegenheit.
Deren Konsequenzen halten sie – einerseits – in Grenzen, nämlich in den Grenzen des professionellen Interesses am Fortgang des Geschäfts. Die Spekulantengemeinde tut, was sie auch sonst tut – was soll sie auch sonst tun: Sie transformiert alle „weltwirtschaftlichen Verwerfungen“, die möglicherweise erst drohenden inklusive, in quantitative Zu- resp. Abschläge beim Währungsvergleich. Die USA drehen das Geld, das sie überhaupt und für ihr Kriegsprogramm speziell brauchen und sich wie gewohnt durch Eigendruck im hoheitlichen Selbstverlag verschaffen, der ganzen Welt als Geschäftsmittel an, garantieren aber gar nicht mehr uneingeschränkt aller Welt und in aller Welt dessen Tauglichkeit als Geschäftsmittel; sie führen sich statt dessen als strategisch eifersüchtige Zulassungsstelle für eine stets widerrufliche Teilhabe am globalen Konkurrenzbetrieb auf; die diesbezüglichen Beschwerden ihrer Weltwirtschaftspartner ignorieren sie souverän; den Verschiebungen beim Wertvergleich der Währungen begegnen sie, statt mit Beschwörungen einer letztlich einvernehmlichen Kontrolle darüber, ebenso mit offensiver Nicht-Beachtung wie der Warnung vor ‚Abwertungswettläufen‘, vor ‚Deflation‘ und ähnlichem Zeug: Das alles legen sich die Spezialisten für das vergleichsweise Prüfen der Güte von Geldern anhand der Maßstäbe zurecht, die in ihrem Metier gelten. Sie fragen sich, was die Dollar-Schulden jetzt und in Zukunft eigentlich wert sind, mit denen sie wirtschaften und sich ganze Nationen als Amerikas Gläubiger reich rechnen, wie viel in Prozentgraden beziffertes „Vertrauen“ ihnen der Dollar daher noch wert ist. Und sie wissen auf ihre Frage dann immerhin schon einmal eine vorläufige praktische Antwort: Jedenfalls weniger als bisher. So entziehen sie der Weltmacht einiges von ihrem Kredit und lassen deren Geld im Kurs fallen.
So kommt es – andererseits – zu dem dann doch einigermaßen auffälligen Zwischenergebnis, dass der Weltmacht mit ihrem Sieg im Irak ein äußerst eindrucksvolles Exempel ihrer Überlegenheit gelingt – und sie mit ihrem Haushalt und dessen Schieflage
international ins Gerede kommt. Ihr berühmtes Doppel-Defizit
hat sie keineswegs erst heute und auch nicht zum ersten Mal, doch mit einem Mal will man wissen, dass Amerika seine ökonomische Macht überdehnt
(SZ, 20.3.), wenn es in den Krieg zieht. Den größten Anhängern des volkswirtschaftlichen Dogmas vom Kredit als Hebel für optimale Ressourcen-Allokation kommt es auf einmal so vor, als ob mit dem Kapitalimport der USA „der Rest der Welt weiterhin das Haushaltsdefizit (sc. Amerikas) finanziert“ (SZ, 3.5.); sie finden es keineswegs so selbstverständlich, wie Amerika es als Selbstverständlichkeit voraussetzt, dass Nationen und die internationale Spekulantenwelt das auch weiterhin tun und tun sollten, weil Amerika und sein Geld auch in Zukunft als ‚sicherer Hafen‘ einzuschätzen wäre; eher schon sehen sie den „Rest der Welt“ zu seinem Nachteil und Amerikas einseitigem Vorteil über den Dollar der Schuldenpolitik der US-Regierung dienstbar gemacht. Um so mehr Gewicht wird der Tatsache beigelegt, dass Staatsbanken ebenso wie große Privatfonds beträchtliche Vermögensumschichtungen
betreiben, aus dem Dollar ‚aus-‘ und in konkurrierende Weltgelder ‚einsteigen‘. Dem Euro verhilft das just in dem Moment, in dem die führenden EU-Wirtschaftsmächte ihren famosen ‚Stabilitätspakt‘ beerdigen, zu ungeahnten Höhenflügen, was allerdings nicht bloß den Lobbyisten der europäischen Exportindustrie missfällt. Gewissenhafte Beobachter der Szene können sich nämlich glatt vorstellen, dass die Verlegenheit der Dollar-Besitzer außerhalb der USA, denen aus lauter politischen Gründen die ökonomischen Perspektiven für die Vermehrung ihres auf US-Staatsschulden lautenden Reichtums abgehen, am Ende in eine strategische Entscheidung gegen die USA höchstpersönlich umschlagen könnte; und sie befürchten in diesem Fall vorsorglich ein sehr viel fundamentaleres als die Stabilitätsprobleme, die die Spekulantenwelt tagtäglich sowieso schafft und bewältigt: Sollten sich die Investoren eines Tages gegen die USA als Investitionsstandort entscheiden, könnte der Dollarkurs abstürzen – mit verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft.
(SZ, 3.5.)
So weit ist es im Zeichen der „Verunsicherung durch den Irak-Krieg“ also gekommen: Die Freunde der süßen Veranstaltung namens „Weltwirtschaft“ müssen sich schon Sorgen machen, dass eine Ermessensentscheidung namenloser „Investoren“ das ganze Ding kippen „könnte“! Doch wo sie Recht haben, haben sie Recht. Amerikas Schuldenwirtschaft hat den Fortgang des kapitalistischen Weltgeschäfts schon ganz schön untergraben. Alle, die mit US-Schulden herumwirtschaften, bekommen es akut damit zu tun, dass die US-Regierung mit ihrer Kombination aus kriegerischer Weltfriedenspolitik und Kriegs- plus Nachkriegsökonomie eine globale Geldkrise heraufbeschwört. Und was die Sache erst so richtig scharf macht: Von allen „global players“ ist die Bush-Administration offenkundig der letzte, den das stört.
[1] Ein großzügiges Angebot, nachdem Amerika im und mit dem Irak-Krieg für die gegenwärtige aussichtslose ökonomische Lage Syriens gesorgt hat. Eine der ersten Kriegshandlungen war die Kappung der Ölleitung von Kirkuk nach Banjas, durch die Syrien in den vergangenen Jahren täglich bis zu 175.000 Barrel Öl aus dem Irak zu Vorzugspreisen bezog und damit seiner Wirtschaft Kosten in Höhe von 700 Mio. $ ersparte. Im Irak hatte Damaskus zudem seinen Haupthandelspartner; es exportierte dorthin Waren im Wert von 2 Mrd. $ pro Jahr. (Daten aus Washington Post, 2.5.)
[2] Assads Vorstoß, im Sicherheitsrat eine Resolution zu unterbreiten, die den gesamten Nahen Osten zu einer WMD-freien Zone erklärt, findet zwar viel Zustimmung: Alle Araber stellen sich vorbehaltlos dahinter, auch die Europäer begrüßen den Vorschlag „im Prinzip“. Sein damit intendiertes Anliegen, eine Gleichbehandlung aller Staaten der Region – einschließlich Israels – durchzusetzen, halten jedoch alle für völlig „unrealistisch“. Auch wird Syrien eindringlich davor gewarnt, aus dem Argument, die USA dürften nicht „doppelte Maßstäbe“ anlegen, praktische Konsequenzen zu ziehen.
[3] Mit der amerikanischen Forderung, den Hizbullah zu entwaffnen und die libanesische Armee an der Grenze zu Israel aufzustellen, ist Beirut – laut Staatspräsident Lahoud – die Perspektive eines Bürgerkriegs eröffnet. Zumal wenn der Libanon die 350.000 Palästinensern in den Flüchtlingslagern behalten müsse, weil Israel deren Rückkehr strikt verweigert, und die syrischen Truppen abzögen, die bisher die innere Ordnung im Lande garantierten. Wenn sich Beirut auf diese Schritte einließe, könne es gleich amerikanische Truppen zur Ordnungsstiftung im Lande anfordern.
[4] Jordanien bekam von Saddam Hussein Öl zu Sonderkonditionen, die seiner Wirtschaft etwa 200 Mio. $ pro Jahr erspart haben, außerdem exportierte es Güter im Wert von 300 Mio. $ pro Jahr in den Irak (WP 6.5.). Nach Schätzungen der Weltbank „sinkt das BIP Ägyptens infolge des Irak-Kriegs um 1,5 bis zu 2% und verschlechtert sich die Zahlungsbilanz um 2,5 Mrd. $.“ (Jordan Times 15.4.)
[5] Andernfalls – so die Drohung – hätte Ägypten keinen Finger gerührt, wenn Israel Arafat auf die eine oder andere Art erledigt hätte.
[6] Siehe ausführlich dazu den Artikel „Eskalation der Feindschaft zwischen Indien und Pakistan – erwünschte und unerwünschte Beiträge zum Antiterrorkrieg“, GegenStandpunkt 1-02, S.65.
[7] Daher ist die politische Substanz einerseits so recht gar nicht vorhanden, von der die Vertreter des europäischen Viererbeschlusses
in ihrer arteigenen Verlogenheit gleichwohl nicht zu beteuern müde werden, dass sie sich gegen nichts und niemanden, niemals gegen die NATO und schon gleich nicht gegen Amerika richte, vielmehr genau das sei, was man sich dort schon immer an europäischen Beiträgen zur gemeinsamen Sicherheitsarchitektur
gewünscht habe. Ihren Willen zu dieser Substanz aber haben die Vier
andererseits schon zu Protokoll gegeben, und das wird in Washington, wo man bekanntlich keinen Rivalen mehr hochkommen lassen
will, sehr wohl registriert. Der Adressat der europäischen Bekundung, dennoch ein wenig ‚hochkommen‘ zu wollen, nimmt also Stellung, und auch auf der höchsten Ebene der Konkurrenz zwischen Gewalten muss sich eine Seite, die den Schaden hat, um den Spott der anderen nicht besorgen. Sie
, nämlich die Europäer, haben irgendeine Art von Plan beschlossen, um irgendeine Art von Hauptquartier zu entwickeln
: So informiert der Außenminister einer wirklichen Weltmacht seinen Kongress über den aktuellen Stand im transatlantischen Kräfteverhältnis.
[8] Negativer Höhepunkt ist die lakonische Ansage des US-Kriegsministers Rumsfeld, die USA hätten vollstes Verständnis dafür, wenn britische Soldaten wegen der Legitimationsprobleme
nach innen, also im Interesse von Blairs Machterhalt, nicht mit nach Bagdad marschieren könnten; dann würden die USA die Sache eben ohne England erledigen.
[9] „‚Wir möchten Spanien nicht in einem Winkel der Geschichte sitzen sehen, in dem Winkel der Länder, die nicht zählen, die nicht nützen, die nicht entscheiden. Wir möchten Spanien an seinem Platz sehen und dafür haben wir viele Jahre lang gekämpft.‘ Aznar konkretisiert nicht, welches diese Länder sind, die nichts nützen, auch wenn er diejenigen kritisiert, die ‚den Sicherheitsrat der UNO spalten oder die Atlantische Allianz oder die Einheit der Stimme Europas aufs Spiel setzen‘.“ (El País, 4.3.)
[10] Aznar bekräftigt dann mitten im Krieg das Ziel des Landes, als Kriegsachsen-Partner der USA in der Welt und speziell in Europa größeren imperialistischen Einfluss zu erobern: Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat Spanien alle Möglichkeiten, eine der wichtigsten Demokratien von Europa und in der Welt zu sein. (…) Spanien muss rechtzeitig den Zug der Geschichte erreichen. (…) Das neue Spanien kann es zu einer stärkeren Position in der internationalen Szenerie bringen. (…) Wir müssen viele Sachen im Ausland machen. Wir müssen viele Gelegenheiten nutzen
. Um den Rang zu stärken, den Spanien in der Welt besetzt
, so präzisiert Aznar, beteiligt es sich entscheidend an der Konstruktion von Europa und ist fähig, Verantwortung zu übernehmen; es ist die fünftwichtigste Ökonomie der 25 EU-Staaten und Vorbild für die neuen Demokratien (Osteuropas).
(El País, 8.4.)
[11] Der kommunistische Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Alain Bocquet freut sich über die nationale Einheitsfront gegen den amerikanischen Hegemon und sieht gleich die ganze Welt hinter seinem Frankreich stehen: Der amerikanische Druck ist riesig. Man musste ihm widerstehen, und wir sind froh über die Position, die Frankreich bislang verfochten hat. (…) Die kriegerische Politik der amerikanischen Administration geht nicht durch und wird von einer öffentlichen Meinung auf der Welt zurückgewiesen, die mehr von Antihegemonismus als von Antiamerikanismus bewegt wird.
(Le Monde, 28.2.)
[12] Schon die Finanzierung des 1. Golfkriegs der USA hat die damalige Bush-senior-Regierung anders abgewickelt. Von ihren großen Bündnispartnern, die sich nicht mit Soldaten an dem Feldzug zur „Befreiung Kuweits“ beteiligen wollten, von Japan und Deutschland vor allem, hat sie sich schlicht größere Geldbeträge aushändigen lassen. Offenkundig hat sie in dem Krieg ein ernstes Haushaltsproblem gesehen; mit Wirkungen auf „den Steuerzahler“ sowie, ideologisch weniger bedeutsam, ökonomisch dafür um so gewichtiger, auf den Schuldenstand der Nation und ihr Geld, für deren Bewältigung sie sich nicht mehr auf die Leistungen einer von den USA dominierten kapitalistischen Weltwirtschaft verlassen mochte. Dieses Misstrauen in die Gleichung, wonach die globale Konkurrenz automatisch Amerika nützt, war der eine Grund für die Gerechtigkeitsfrage, die die seinerzeitige Administration ihren Partnern eröffnet hat und die zugleich von ihrem Standpunkt zeugt, dass durch die bestehenden Bündnisse, im Rahmen der dort verfochtenen gemeinsamen „westlichen Sache“, nicht mehr quasi von selbst für eine ausgeglichene Lastenverteilung zwischen der Führungsmacht und ihren Alliierten gesorgt wäre. Ziemlich ausdrücklich hat die US-Regierung ihre Partner daran „erinnert“, dass die Beteiligung am Nutzen der von ihr definierten und durchgesetzten „neuen Weltordnung“ den Charakter einer Lizenz hat, den die andern sich stets von neuem durch die Übernahme von Lasten zu verdienen hätten. Im Zuge des 2. amerikanischen Golfkriegs wird dieser Standpunkt ultimativ zu der Alternative ‚Unterordnung oder Lizenzentzug‘ zugespitzt. Was hingegen die Finanzierung des Unternehmens angeht, so besteht die Regierung Bush-junior nicht auf dem ökonomisch halbseidenen Hilfsmittel der Tributzahlung durch Verbündete, sondern in aller Entschiedenheit und offensiv gleichgültig gegen die Folgen auf ihrer Macht, sich unbegrenzt zu verschulden. Von den Konsequenzen dieses Fortschritts ist im Folgenden die Rede.